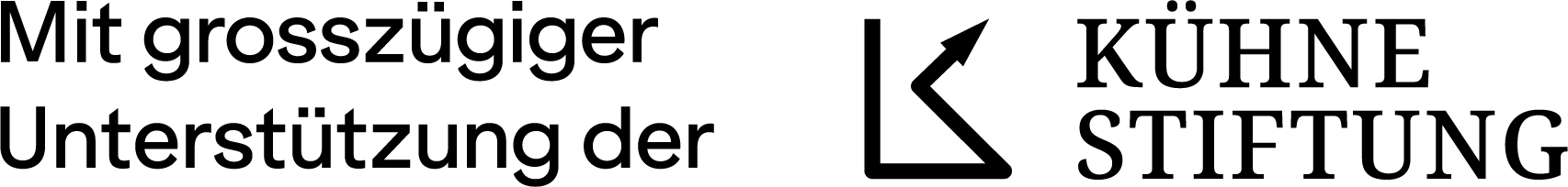...so sagt es die Marschallin im «Rosenkavalier». Für das Magazin geht Schriftsteller Peter Stamm dem komplexen Phänomen der Zeit nach.
Um 7 Uhr stehe ich auf.
Um 8 Uhr beginnt die Schule.
Um 9 Uhr schreiben wir.
Um 10 Uhr beginnt die Pause.
Um 11 Uhr turnen wir.
Um 12 Uhr essen wir die Suppe.
Um 13 Uhr helfe ich der Mutter.
Um 14 Uhr beginnt die Schule wieder.
Um 15 Uhr arbeiten wir mit dem Lehrer.
Um 16 Uhr gehen wir heim.
Um 17 Uhr schreibe ich die Aufgaben.
Um 18 Uhr steht das Nachtessen bereit.
Um 19 Uhr darf ich spielen.
Ich muss diesen Text in einer der ersten Klassen geschrieben haben. Dazu zeichnete ich eine Uhr mit grossem Zifferblatt. Es ging wohl darum, sie lesen zu lernen, denn die Zeit kann man nicht von Geburt an, man muss sie lernen. Bevor ich zur Schule ging, hatte ich keine Uhr und kaum eine Zeit. Ereignisse folgten aufeinander, fanden statt und endeten, wurden angekündigt oder erinnert. Aber gefühlt lebte ich in einer ewigen Gegenwart. Wenn ich spielte, spielte ich, wenn ich schlief, schlief ich, wenn ich wütend oder traurig war, war ich nichts anderes als das, und es gab nicht den Trost, dass die Gefühle vorübergehen würden wie alles andere. Meine Kindheit erscheint mir im Rückblick zeitlos, eher räumlich als zeitlich strukturiert. Ich erinnere mich an Orte und an die Wege dorthin, aber ich habe Mühe, meine Erinnerungen chronologisch zu ordnen. Meine Wahrnehmung von damals scheint jener von religiösen Gesellschaften nah zu kommen, wie sie Mircea Eliade in seinem Buch «Das Heilige und das Profane» beschreibt. Die «heilige Zeit», heisst es dort, biete «den paradoxen Aspekt einer zirkulären, umkehrbaren, wiedererreichbaren Zeit (…) und eine Art mythische ewige Gegenwart.» Sie könne «in gewisser Hinsicht der Ewigkeit gleichgesetzt werden». Das Kirchenjahr wiederholt sich wie das Jahr des Kindes, Weihnachten ist immer Weihnachten, Ostern immer Ostern, der Geburtstag, der letzte Schultag vor den Sommerferien … Und auch im Familienkreis legen wir Wert darauf, diese Feste immer gleich zu begehen im Strom der Zeit, der uns manchmal mitzureissen droht.
Wenn Adam und Eva vom verbotenen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, wird ihnen vielleicht nicht nur ihre eigene Nacktheit bewusst, sondern auch ihre Sterblichkeit. Denn im Paradies steht neben dem Baum der Erkenntnis auch der Baum des Lebens, zu dem sie nach ihrer Vertreibung keinen Zugang mehr haben. Sie lernen, dass die Zeit eine Richtung hat und dass ihre Zeit beschränkt ist. Vor vielen Jahren besuchte ich in Lappland einen Rentierbauern. Er zeigte mir seine überraschend kleinen Tiere, die bewegungslos in einem umzäunten Stück Wald standen. Es war Ende April, und es lag immer noch Schnee. Da fragte ich mich, ob die Rentiere sich nicht furchtbar langweilten, wenn sie monatelang in der Dunkelheit und der Kälte standen und auf den Frühling warteten. Die Frage hätte ich mir natürlich bei jeder Kuh in der Schweiz stellen können, denn auch ihr Leben auf der Alpweide oder im Stall ist nicht sehr ereignisreich, nicht sehr spannend, aber vielleicht hatte ich in meinem Leben zu viele Kühe gesehen, um mich noch über sie zu wundern. Ich glaube nicht, dass Tiere sich langweilen. Ich glaube nicht, dass sie auf den Frühling warten wie wir, auf das Futter oder auf die Sonne nach der Polarnacht. Ich glaube nicht, dass sie wie wir Angst vor dem Tod haben. Vermutlich leben sie ganz in der Gegenwart wie ich als Kind. Wenn ein vor einem Geschäft angebundener Hund jämmerlich heult, dann nicht, weil er seinen Herrn oder seine Herrin ungeduldig zurückerwartet, sondern weil er glaubt, verlassen worden zu sein und nicht weiss, dass er gleich wieder befreit wird. Menschen hingegen können die Zukunft vorausahnen, sie wissen, dass in zwei Stunden Schulschluss ist oder Feierabend, dass die Sommerferien eine beschränkte Dauer haben, dass eine langweilige Theater- oder Opernaufführung noch lange nicht zu Ende sein wird. Vermutlich stand die Dauer der Vorstellung sogar im Programmheft und sie haben gewusst, worauf sie sich einliessen. Umso ungeduldiger erwarten sie das Ende. Inzwischen beurteile ich die Qualität eines Stücks auch danach, wie lange es dauert, bis ich zum ersten Mal auf die Uhr schaue. Wenn wir die Zeit während langweiliger Vorstellungen, öder Sitzungen oder schmerzhafter Zahnarztbesuchen manchmal beschleunigen möchten, so würden wir sie in schönen Momenten am liebsten anhalten wie Faust, der sogar seine Seele dafür zu geben verspricht, wenn er in einem Moment seines Lebens sagen könnte, verweile doch, du bist so schön. Wir wissen alle, dass sich die Zeit nicht anhalten lässt, aber wir haben Wege gefunden, wenigstens ihr Verfliessen etwas weniger erschreckend und schmerzhaft zu machen. In der Musik mit ihren Themen und Wiederholungen fangen wir die Zeit gewissermassen ein, verlängern wir die Gegenwart, die sonst von unserem Gehirn in Einheiten von knapp drei Sekunden wahrgenommen wird. Hören wir ein Lied, eine Arie, eine Fuge, ist die Gestalt des Ganzen in jedem Moment präsent, Töne haben eine Dauer, aber sie schwingen nach, kommunizieren miteinander, verbinden sich zu grösseren, sinnvollen Einheiten. Musik bildet Inseln in der Zeit. Und seit es Tonträger gibt, lassen sich Musikerlebnisse auch jederzeit wiederholen. Es ist wohl kein Zufall, dass demenzkranke Menschen die Musik ihrer Kindheit und Jugend oft länger behalten als die meisten anderen Erinnerungen. Musikstücke sind eben keine Stücke, sondern etwas Ganzes, das eine Form und einen Sinn einschliesst. Literatur ist in einem noch viel direkteren Mass festgehaltene oder wiedergefundene Zeit. In Geschichten können wir beliebig oft und beliebig weit in die Vergangenheit zurückkehren. Vielleicht haben die Menschen deshalb damit angefangen, sich Geschichten zu erzählen. Literatur ist geronnene, geformte Erinnerung. Und wenn wir alte Literatur lesen, alte Musik hören, werden jahrhundertealte Menschen, Worte, Töne, Gefühle wieder zum Leben erweckt. Als ich vor sieben Jahren die Friedrich Dürrenmatt Gastprofessur für Weltliteratur in Bern übernahm, entschloss ich mich, die Zeit zum Thema meines Seminars zu machen. In der ersten Stunde zeichnete ich mit Kreide eine Linie auf die Wandtafel und markierte eine Stelle nach einem Viertel und eine nach drei Vierteln der Strecke. Sie sind ungefähr hier, sagte ich zu den Studierenden und zeigte auf die erste Markierung, und ich bin ungefähr hier, und zeigte auf die zweite. Ich wollte ihnen damit klar machen, dass sie mit ihren gut zwanzig und ich mit meinen fünfundfünfzig Jahren an völlig verschiedenen Positionen auf unseren Lebenswegen standen und ganz andere Perspektiven, ganz andere Aussichten hatten. Sie nahmen meine Bemerkung ohne grossen Kommentar und scheinbar unbeeindruckt hin, während mich selbst diese Linie seither immer wieder beschäftigt. Es liegt auf der Hand, dass man mehr über Dinge nachdenkt, von denen man wenig hat als über jene, die unerschöpflich scheinen. Aber etwas in mir wehrt sich gegen den Gedanken, Zeit sei eine Ressource wie Geld, von der man eine bestimmte Menge zur Verfügung hat, die man nach und nach aufbraucht bis zum Tod. Unsere Position auf der Zeitachse unseres Lebens ist ja auch höchst unsicher, die durchschnittliche Lebenserwartung sagt nicht viel über meine eigene aus. Ich hätte schon mit zwanzig am Ende sein können, könnte es heute, weggewischt mit einem feuchten Schwamm wie die Lebenslinie damals im Seminar am Ende der Stunde. Vor allem aber widerspricht die lineare Vorstellung der Zeit meiner Empfindung von ihr. Das Leben ist kurz, die Stunden sind lang.
«Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiss ich es, wenn ich es aber einem, der mich fragt, erklären sollte, weiss ich es nicht.» Kaum eine Aussage über die Zeit wird so häufig zitiert, wie diese Sätze aus Augustinus «Confessiones» aus dem vierten Jahrhundert. Danach macht sich der Gelehrte aber doch Gedanken über die Zeit und kommt zu erstaunlichen Erkenntnissen. Er geht davon aus, dass die Zeit Teil der Schöpfung ist und mit Himmel und Erde ihren Anfang nahm. Dass es vor der Schöpfung weder Raum noch Zeit gab. «Wenn es also vor Himmel und Erde keine Zeit gab, wie kann man dann fragen, was du (Gott) damals machtest? Denn es war kein Damals, wo noch keine Zeit war.» Diese Vorstellung der Zeit komme jener in der modernen Kosmologie ziemlich nahe, sagte mir einmal ein ungarischer Physiker am CERN. «Im Moment des Urknalls galten keine physikalischen Gesetze», sagte er. «Es gab weder Raum noch Zeit.» Er sei nicht religiös, aber er fände es verblüffend, dass Augustinus schon vor mehr als sechzehnhundert Jahren nur mit Nachdenken darauf gekommen sei. Augustinus meint auch, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gäbe, nur eine Gegenwart der Vergangenheit und eine Gegenwart der Zukunft. Denn das Vergangene sei nur eine Erinnerung und das Zukünftige nur eine Erwartung, die beide in der Gegenwart lägen. Das Vergangene mag in der Gegenwart eine Wirkung haben, aber es existiert nicht mehr. Nichts existiert als die Gegenwart, ein Gedanke der zugleich völlig einleuchtend und tief verstörend ist. Ich schreibe dies, während ich mit dem Zug aus Berlin zurückkehre. Ich war die ganze Woche dort, habe Menschen getroffen, Gespräche geführt. Einige dieser Gespräche werden Folgen haben, aber sie existieren nicht mehr, so wenig wie das japanische Essen, das ich genossen habe, der Sturm, in den ich gekommen bin. Besonders schmerzhaft ist dieser Gedanke nach dem Tod eines geliebten Menschen. In Josef von Eichendorffs berührendem Gedichtzyklus «Auf meines Kindes Tod», den er nach dem Tod seiner zweijährigen Tochter schrieb, heisst es:
Die Welt treibt fort ihr Wesen,
Die Leute kommen und gehn,
Als wärst du nie gewesen,
Als wäre nichts geschehn.
Auch hier hilft uns die Literatur. Sie kann Menschen, die fern sind, näher zu uns holen, kann Tote wieder zum Leben erwecken und so dem Tod nicht seinen Schrecken nehmen, aber ihn erträglicher machen. Nur die Vergessenen sind wirklich tot, sagt man, nur die, über die wir uns keine Geschichten mehr erzählen. Zweihundert Jahre nach dem Tod seiner Tochter, fast so lange nach seinem eigenen Tod, erinnert Eichendorffs Gedichtzyklus noch immer an sie und erinnert uns zugleich an unsere eigene Sterblichkeit und die Unerbittlichkeit der Zeit, die wir im Alltag oft vergessen. Die Vergänglichkeit treibt auch die Marschallin im «Rosenkavalier» um, wenn sie singt:
Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie.
Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.
In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie,
in meinen Schläfen fliesst sie.
Und zwischen mir und dir da fliesst sie wieder,
lautlos, wie eine Sanduhr.
Oh, Quinquin!
Manchmal hör’ ich sie fliessen – unaufhaltsam.
Manchmal steh’ ich auf mitten in der Nacht
und lass die Uhren alle, alle stehn.
Allein man muss sich auch vor ihr nicht fürchten.
Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters,
der uns alle erschaffen hat.
Die Marschallin hat recht, wir brauchen die Zeit nicht zu fürchten. Nicht, weil sie Gottes Werk ist, das ist in unserer säkularen Zeit eine schwache Begründung, aber weil sie uns nichts anhaben kann. Wenn es nur die Gegenwart gibt, liegt der Gedanke nahe, dass die Zeit gar nicht existiert. Dass die ewige Gegenwart, in der Tiere vielleicht leben, die Gegenwart, die wir als Kinder empfunden haben, nicht weniger wirklich ist als die lineare Zeit, durch die wir uns als Erwachsene bewegen. Dass die Zeit eine Illusion sein könnte, wird von Philosophen und Physikern ernsthaft diskutiert. Spätestens seit Einsteins Relativitätstheorie, die unser Bild von der Zeit komplett auf den Kopf gestellt hat, ist die Zeit relativ geworden und ihre Existenz zweifelhaft. Und wie wir gesehen haben, hat schon Augustinus sich einen Zustand vorgestellt, in dem es keine Zeit gab. Dass ich seit bald zehn Stunden unterwegs bin, dass mein Zug mit achtzehn Minuten Verspätung unterwegs ist, ist allerdings unbestreitbar. Dass ich meinen Anschluss in Zürich nicht erreichen werde, ist zumindest wahrscheinlich. Aber es werden andere Züge fahren. In einem meiner Lieblingsbücher, «Ein Mann der schläft» von Georges Perec, soll ein Student zu einer Prüfung und drückt sich davor. Er erzählt niemandem davon, fängt an, ein Leben zu leben, in dem jeder Tag wie der vorige ist. Er zieht sich zurück, öffnet die Tür nicht mehr, wenn jemand ihn besuchen will. Er sitzt in seiner Wohnung, er geht durch die Stadt ohne Ziel. Er isst immer dasselbe, liest völlig interesselos jedes Wort in der Zeitung, beobachtet Passanten. Alles ist ihm einerlei und vollkommen gleichgültig. Es heisst, dass Perec in diesem Buch seine Depressionen verarbeitet habe. Im Grunde tritt seine Figur aus der Zeit, lebt in der ewigen Gegenwart, die ihm nichts anhaben kann, frei von allen Verpflichtungen und Wünschen. Und dann, ganz am Schluss der Geschichte, findet der Mann zurück in die Welt, zurück in die Zeit. Er merkt, dass die Einsamkeit ihn nichts gelehrt hat, dass seine Gleichgültigkeit sinnlos war, gerade weil kein Sinn ist in der Welt. «Du kannst wollen oder nicht wollen, was liegt schon daran! Du kannst eine Partie Flipper spielen oder nicht, irgend jemand wird auf jeden Fall ein Zwanzigcentimesstück in den Schlitz des Apparats stecken.» Der junge Mann hat geglaubt, in seiner Verweigerung unverwundbar zu sein. Aber dann steht er an der Place Clichy, es regnet, und er will nicht nass werden. Georges Perec bietet uns keinen Glauben an, keinen Sinn, keine Ideologie, keinen Regenschirm. Nur die Gewissheit, dass wir die Zeit nicht anhalten können, dass sie weitergeht, zugleich gnadenlos und gnädig. Das muss uns genügen, und es genügt.
---
Peter Stamm ist freier Autor. Nach seinem 1998 erschienenen Debütroman «Agnes» veröffentlichte er weitere Romane und Erzählsammlungen, darunter «Weit über das Land», «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» und «In einer dunkelblauen Stunde». Im Oktober erscheint seine neue Erzählsammlung «Auf ganz dünnem Eis». Peter Stamm lebt heute in Winterthur.