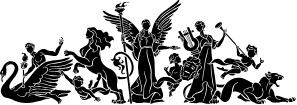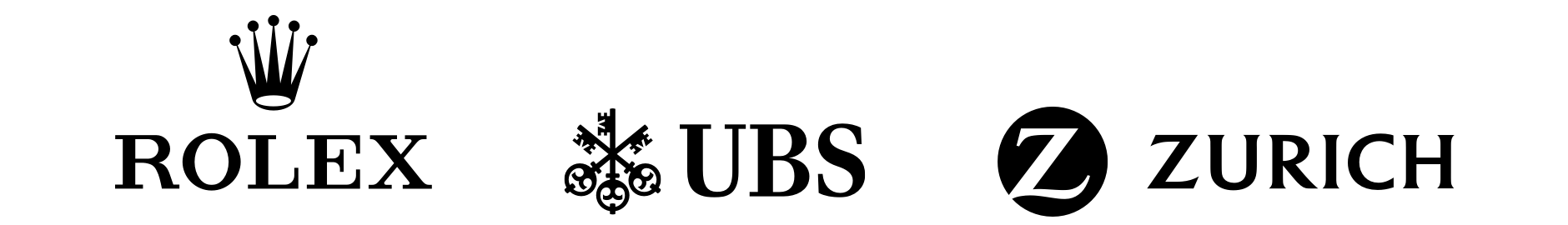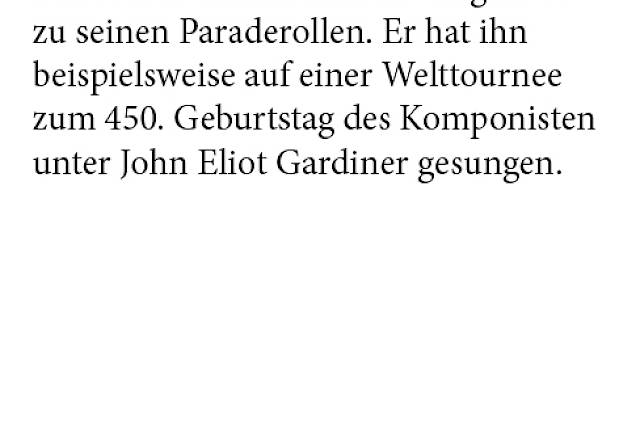Der Regisseur Evgeny Titov inszenierte «L’Orfeo» am Opernhaus Zürich. Für ihn ist die Geschichte um den mythischen Ursänger Orpheus mehr als eine fantastische, antike Sage, in der ein Held in die Unterwelt hinabsteigt, um seine Geliebte wieder ins Leben zurückzuholen.
L'Orfeo
Favola in Musica in einem Prolog und fünf Akten von Claudio Monteverdi (1567-1643)
Libretto von Alessandro Striggio
-
Dauer:
2 Std. 05 Min. Inkl. Pause nach ca. 45 Min. -
Sprache:
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. -
Weitere Informationen:
Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Pressestimmen
Pressestimmen
«Eine Inszenierung, die den Geist unserer Zeit atmet»
Bachtrack, 20.05.24
«Starke dramaturgische Entscheidungen, ein imposantes Bühnenbild und makelloser Gesang»
SRF, 21.05.24
«Er überrascht bis zum Schluss mit doppelten Böden, Hintertüren und 180 Grad-Wendungen.»
Tages-Anzeiger, 18.05.24
«Der ungemein beseelten und in allen Registern differenzierten Orpheus-Partie des polnischen Tenors Krystian Adam gilt es, ein besonderes Kränzchen zu winden»
Südkurier, 21.05.24
«Zwei Stunden die schönste Musik der Operngeschichte für den allumfassenden Tod»
SWR, 22.05.24
«Klar: Man muss das sehen und hören»
Aargauer Zeitung, 18.05.24
Gut zu wissen
Ein Abend in Mantua mit grossen Folgen
( Hintergrund )
Mit «L’Orfeo» von Claudio Monteverdi begann vor über 400 Jahren die Geschichte der Oper. Ein Gespräch mit der renommierten Monteverdi-Forscherin Silke Leopold über den italienischen Pionier der Oper, seine visionären Fähigkeiten und seine gloriose Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert.
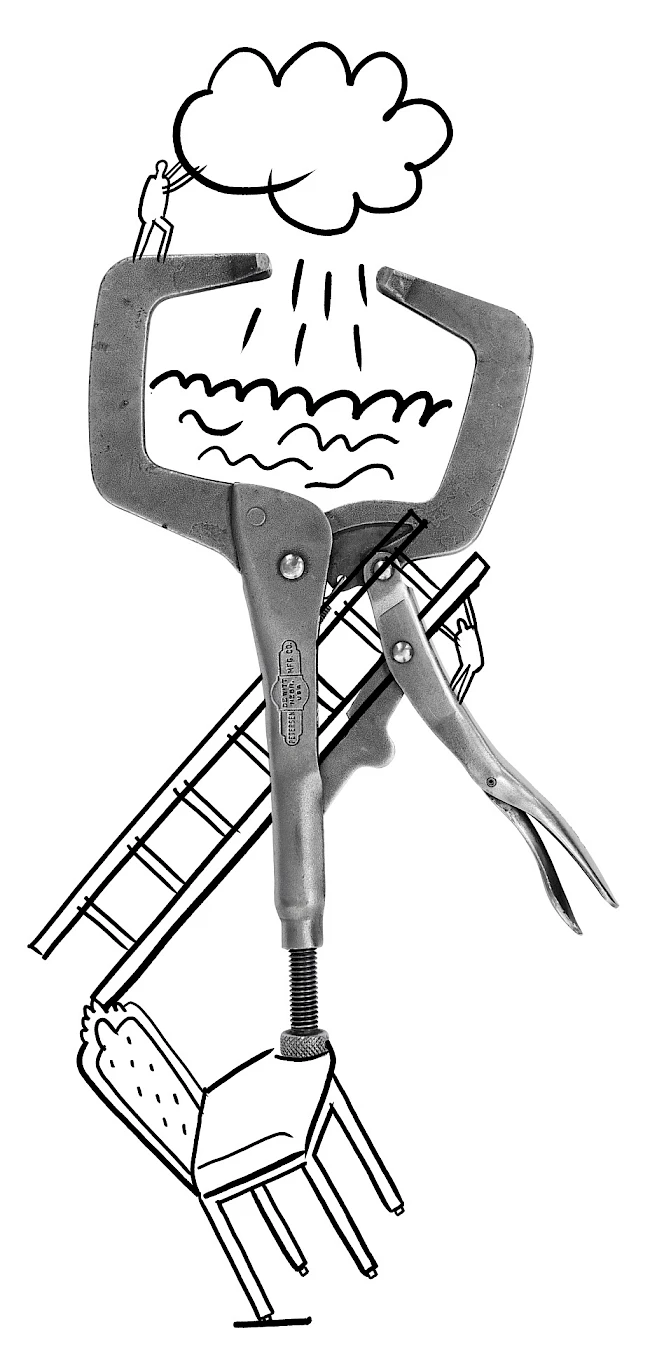
Flysch von Zumaia
( Wie machen Sie das, Herr Bogatu? )
Wissen Sie, was Flysch ist? Das ist ein Begriff aus der Geologie, der dünne Schichten von Tonsteinlagen bezeichnet, die sich mit Schichten aus grobkörnigem Material abwechseln. Eine Bildersuche im Internet mit dem Begriff «Flysch von Zumaia» liefert beeindruckende Fotos von Flysch und eine Vorstellung davon, wie grosse Teile des Bühnenbildes von «Orfeo» aussehen: Riesige, stehende Gesteinsformationen mit scharfen Trennlinien bilden die Kulisse des Bühnenbildes.

Krystian Adam
( Volker Hagedorn trifft... )
Krystian Adam hat in Breslau und Mailand Musik studiert und liebt seine polnische Heimat ebenso sehr wie Italien, wo er auf Sardinien zu Hause ist. Monteverdis Orfeo gehört zu seinen Paraderollen. Er hat ihn beispielsweise auf einer Welttournee zum 450. Geburtstag des Komponisten unter John Eliot Gardiner gesungen.

Claudius Herrmann – Vielseitigkeit als Lebensform
( Zwischenspiel, 16.05.24 )
Der langjährige Solo-Cellist der Philharmonia Zürich gehört zu den prägenden musikalischen Persönlichkeiten des Opernhauses und spielt Continuo in Claudio Monteverdis Oper «L’Orfeo». Woher nimmt er seine ewige Neugier auf Neues? Was gefällt ihm an Monteverdi, Wagner und der Streichquartett-Literatur?

Josè Maria Lo Monaco
( Fragebogen )
Josè Maria Lo Monaco ist eine passionierte Sängerin im Barockrepertoire, steht aber auch in Opern von Rossini und Mozart auf den internationalen Opernbühnen von Mailand bis Paris. Gemeinsam mit dem Ensemble La Venexiana hat sie die drei erhaltenen Monteverdi-Opern auf einer mit dem Gramophone Award ausgezeichneten CD aufgenommen. Kürzlich veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum «All’amore immenso».

Wir haben einen Plan
( Backstage )
Der finstere Caronte ist in der griechischen Mythologie der unbestechliche Fährmann, der mit einem Kahn die Toten über den Fluss Styx in den Hades übersetzt. Kein Lebender kommt an ihm vorbei. In der Oper von Monteverdi aber überlistet Orfeo Caronte, indem er ihn mit seinem schönen Gesang besänftigt und einschläfert...

Jeder Mensch trägt seine Hölle in sich
Interview
Evgeny, du hast dich jetzt lange und intensiv mit L’Orfeo von Claudio Monteverdi beschäftigt. Welche Qualitäten schätzt du an dieser Oper?
Die unglaubliche Sinnlichkeit der Musik. Ich weiss, das ist ein Allgemeinplatz. Das kann man über ganz viele Opern sagen. Aber bei Monteverdi ist die Sinnlichkeit besonders. Sie trifft uns, weil sie von Einfachheit lebt und alles so präzise auf den Punkt bringt. Wie in einem Gedicht. Mir kommt diese Musik kristallklar vor, wie ein tiefer, klarer See. Es geht vierzig Meter runter, und du kannst trotzdem auf den Grund sehen. Diese Oper wirft sich nicht in Pose, will nicht wirken und überwältigen. Sie ist aus einer unfassbaren Ruhe und Konzentration herausgeschrieben, unbelastet von all dem ambitionierten Opernzeug, das später kommt.
Liegt das daran, dass die Gattung Oper mit diesem Werk ihre Geburtsstunde erlebt?
Ich weiss nicht, ob das eine etwas mit dem anderen zu tun hat. Ich denke jedenfalls nicht: L’Orfeo ist so toll, weil es die erste Oper ist. Nach meinem Gefühl hat Monteverdi das Werk nicht in dem Bewusstsein geschrieben, gerade etwas sensationell Neues zu erfinden. Es ist, was es ist. Hier hat jemand die Themen, um die es in dem Stück geht, und die Möglichkeiten einer Form in seiner Essenz begriffen und bringt alles mit wenigen Noten auf den Punkt.
Subjektive Gefühlsregungen aus einer Figur sprechen zu lassen, war zu Beginn des 17. Jahrhunderts etwas Neues. Monteverdi wollte mit seiner Musik nicht nur gefallen und Gott und den Fürsten dienen, sondern die Zuhörenden erschüttern, bewegen und zu Tränen rühren.
Wenn das sein Anspruch war, kann ich nur sagen: Es ist ihm gelungen. Schon in den Proben, nur am Klavier begleitet und szenisch noch gar nicht fertig ausgearbeitet, ergreift diese Musik. Es sind nicht nur starke Emotionen, die man spürt. Es ist eine Wahrhaftigkeit, die dahinter erkennbar wird. Es ist heute schwer nachzuvollziehen, wie die Menschen im 16. und 17. Jahrhundert gefühlt haben. Ich glaube, die Empfindungen waren viel komprimierter und intensiver. Im Nachdenken über den Tod der jungen Euridice im Stück bin ich auf die wahnsinnig schöne Renaissance-Muse Simonetta Vespucci gestossen, in die im Florenz der Renaissance alle verliebt waren, und die immer wieder gemalt wurde, etwa von Botticelli in seinem berühmten Gemälde Die Geburt der Venus. Sie ist mit 23 Jahren an Tuberkulose gestorben. Damals lagen Blüte des Lebens und Tod viel näher beieinander. Heute werden wir 90 Jahre alt und machen immer schön Pilates, damit wir noch ein bisschen länger leben. Aber damals musste man sich oft zu einem Zeitpunkt vom Leben verabschieden, als man nach unseren Massstäben noch sehr jung war. Das Leben war wie eine Sternschnuppe. Kaum aufgeleuchtet, war es schon verglüht. Das hat sicher sich auch auf das Gefühlserleben der Menschen ausgewirkt und auf die Kunstwerke, die damals entstanden sind.
Wovon handelt L’Orfeo?
Von Verlust. Liebe. Tod. Von einem Menschen, der gegen den Tod aufbegehrt. Orfeo hat seine Euridice verloren und akzeptiert den Tod nicht. Was kann man angesichts eines geliebten, verstorbenen Menschen machen? Man kann ihn begraben und betrauern. Man kann heulen, rumschreien, wütend werden, wie man will, aber das ändert nichts. Der Tod ist der Tod. Nun kommt Orfeo und sagt: Nein! Ich nehme das nicht hin. Ich gehe in die Hölle und hole mir meine Euridice zurück. Das sprengt jeden Rahmen. Denn er tut es wirklich. Er steigt hinab in die Hölle. Aber es ist keine fantastische Reise in eine finstere Welt, in der es Totenflüsse und mächtige Höllenfürsten gibt.
Sondern?
Die Hölle existiert im Menschen selbst. Das ist der schrecklichste Ort, an den man kommen kann. Jeder trägt seine Hölle in sich und mit sich durchs Leben. Orfeos Reise führt ins Innere des Menschseins, an den dunkelsten Punkt, den es zu besiegen gilt. Der Mensch ist sich selbst der grösste Feind. Darum geht es in dieser Oper. Du kannst, wie Orfeo, begabt sein, erfolgreich, berühmt und von allen verehrt. Aber wenn es hart auf hart kommt, gibt es nur eins, das es zu überwinden gilt, das ist der Abgrund in dir selbst.
Welchen Abgrund muss Orfeo überwinden?
Die Treue zu seinem Herzen. Dem zu vertrauen, was sein Herz sagt. Er hat es geschafft, ins Totenreich zu kommen. Er hat Proserpina auf seine Seite gebracht; sie bringt Plutone dazu, Euridice wieder frei zu geben. Er führt Euridice zurück ins Leben. Sie ist hinter ihm. Aber er darf sich nicht nach ihr umdrehen, das hat Plutone zur Bedingung gemacht. Und auf einmal kommen Zweifel. Ich weiss, sie steht hinter mir, ich fühle ihre Nähe. Aber eine innere Stimme sagt mir: Soll ich mich nicht besser vergewissern? Vielleicht trügt mich mein Gefühl, vielleicht täuscht mich mein Herz. Die Stimme ist wie die Schlange im Paradies, die sagt: Es ist zwar streng verboten, aber mache es trotzdem. Dreh dich um! Schaue Sie an! Die Versuchung ist einfach zu gross – und dann kommt der fatale Blick zurück. Für diesen Moment der Untreue muss Orfeo den Preis zahlen.
Orfeo ist von sich und seinen Fähigkeiten sehr überzeugt. Er hat das Gefühl, mit seiner Kunst alles erreichen und alle Grenzen überschreiten zu können. Könnte sein Hochmut nicht auch ein Grund für sein Scheitern sein?
Ich finde nicht, dass ihm seine künstlerischen Fähigkeiten zum Verhängnis werden. Für mich steht Orfeo als Liebender im Vordergrund. Du kannst Steine zum Weinen bringen, die Welt erobern und der Grösste von allen sein, aber am Ende bist du nur ein Mensch wie jeder andere. Vor dem Tod sind alle gleich. Es gibt einen schönen Essay von Michel de Montaigne, in dem er sinngemäss sagt, dass man den Menschen nur von seinem Ende her beurteilen kann. Er schreibt über einen Herrscher, der alles hatte, was man sich wünschen kann. War sein Leben gut? Nein. Was einzig zählt, ist der Moment, in dem alles Irdische, aller Reichtum, alle Macht abgefallen ist. An diesem Punkt steht Orfeo. Es geht in Monteverdis Oper um das Essenzielle des Daseins. Orfeo scheitert an seinem Menschsein.
Am Ende der Oper tritt Apollo, der Gott des Lichtes und Künste auf, Orfeos Vater. Er nimmt seinen unglücklichen Sohn mit in den Himmel. Diesen Schluss hat Monteverdi komponiert, obwohl das vorab gedruckte Libretto mit Orfeos Tod endet. Darin wird er von den Bacchantinnen zerrissen.
Wir halten uns an das, was Monteverdi komponiert hat, aber das schliesst ja nicht aus, über den Schluss nachzudenken. Orfeo liebt und leidet bis zum Gehtnichtmehr. Diese Fähigkeit macht uns als Menschen aus. Je heftiger die Ausschläge, desto intensiver ist das Leben. Wir kennen alle Menschen, die ohne Schutzhaut durchs Leben gehen und sich ihren Gefühlen und Leidenschaften rückhaltlos ausliefern. So einer ist Orfeo. Apollo macht ihm klar: Du bist zu viel Mensch. Es gibt noch eine andere Hälfte in dir, nämlich die göttliche. Du bist mein Sohn. Folge dieser Seite.
Der Text in Apollos Arie lautet: Du hast dich zu sehr gefreut über dein Glück, du hast zu sehr geweint über dein grausames Schicksal. Es ist nicht weise, der eigenen Leidenschaft zu dienen.
Genau. Er sagt: Komm mit mir in den Olymp. Betrachte von oben, wie sich die Erdenwesen in ihren Leidenschaften wälzen. Wir Götter stehen darüber und haben die Gelassenheit der Unsterblichkeit.
Kann Orfeo sich auf dieses Angebot einlassen?
Im Stück sagt er zu Apollo: Ich wäre dir als Sohn nicht würdig, würde ich deinem Rat nicht folgen. Aber ich bin sicher, dass Orfeo – so wie er ist und nach dem, was er erlebt hat – es als Verrat empfinden würde, die Erde einfach hinter sich zu lassen. Jemand, der durch die Hölle gegangen ist, kann am Ende nicht sagen, na gut, dann ändere ich jetzt meinen Lebensplan und gehe in den Himmel. Würde er das tun, wäre er nicht mehr Orfeo. Er kann Apollos Angebot nicht annehmen, aus Treue zu sich selbst. Es geht dabei gar nicht unbedingt um Euridice, ohne die er nicht leben will und kann. Es geht um Treue zu dem, was sein Leben ausmacht.
Das heisst, die Himmelfahrt am Schluss der Oper ist für dich als Regisseur nicht akzeptabel?
Nein. Aber das ist nicht meine private Regieentscheidung, weil ich mir etwas Originelles ausdenken wollte. Das ist die Konsequenz aus Monteverdis Komposition. Wenn ich die ernst nehme, geht der Schluss nicht. Orfeo steht vor der Frage, was besser ist – alleine im Himmel zu leben oder zu zweit in der Hölle. Aber der Himmel ist keine Option für ihn. Dafür ist er zu sehr Mensch.
Wenn die Hölle, wie du gesagt hast, der Abgrund im Menschen selbst ist, wie sieht sie dann auf der Bühne aus?
Die Hölle mag aussehen, wie sie will. Mir geht es um den Gedanken, und der muss durch die Darsteller zum Ausdruck kommen und nicht durch das Bühnenbild. Man muss sich klar machen, was Hölle eigentlich meint: Sie ist das, was man unmöglich aushalten kann. Sie ist das denkbar Schlimmste und das auf Dauer gestellt. Es wiederholt sich jede Sekunde bis in alle Ewigkeit. Puh. Man darf Stücke, die so ans Existenzielle rühren, nicht zu oft machen. Manchmal soll man sich auch eine harmlose Oper über einen Mann gestatten, der sich in die falsche Frau verliebt.
Welche Gedanken haben dich und deine Bühnenbildnerinnen bei der Gestaltung der Hölle geleitet?
Wir haben etwas gesucht, das Distanz, Kälte, Unmenschlichkeit ausdrückt, den Schrecken der Sterilität. Es sollte eine tote Materie sein, auch als Kontrast zur Lebenslust, die in Orfeos Hochzeitsfeier mit Euridice zum Ausdruck kommt.
Eigentlich fängt die Oper fröhlich an, mit einer Hochzeit und Hirten und Nymphen, die die Liebe von Orfeo und Euridice preisen, bis Euridices Tod das Glück jäh beendet. Ohne schon zu viel verraten zu wollen, in deiner Inszenierung ist es anders.
Zuallererst tritt Musica in der Oper auf, die Allegorie der Musik, und verkündet im Prolog: Ich werde euch eine Geschichte über einen Menschen erzählen und was es bedeutet, ein Liebender zu sein und seine Liebe zu verlieren. Sie kommt gleich zum Punkt. Der Mensch ist geworfen auf eine unfruchtbare Steinlandschaft. So lese ich das, und so will ich es zeigen, wenn der Vorhang hochgeht. Ein Mensch in seiner existenziellen Not, seiner Einsamkeit, sein Alleinsein vor dem Tod. Das ist für mich das zentrale Thema der Oper, und deshalb hätte ich ein fröhliches Hochzeitsbild zu Beginn falsch gefunden. Ich wollte nicht mit der Illusion beginnen, in der wir leben. Ich wollte das Stück gleich in seinem Kern offenbaren. Die Feier, das Tanzen, die fröhlichen Hirten und Nymphen – das alles ist nicht gestrichen, aber es kommt später und anders. Ich beschäftige mich gerade mit Shakespeares King Lear. Es gibt darin im dritten Akt eine Szene, in der Lear in einer peitschenden Sturmnacht schutzlos durch die Heide irrt, sich die Kleider vom Leib reisst und sagt: Der Mensch ist nicht mehr als ein armes, nacktes, zweizinkiges Tier.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 112, Mai 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Ein Abend in Mantua mit grossen Folgen
Hintergrund
Frau Leopold, es gibt nicht viele Menschen, die sich so lange und so intensiv mit Claudio Monteverdi beschäftigt haben wie Sie. Wenn Sie nur einen Aspekt dieser ausserordentlichen Künstlerpersönlichkeit, mit der die Geschichte der Oper beginnt, hervorheben dürften, welcher wäre das? Was macht Monteverdi aus?
Er ist ein Solitär. Im 16. Jahrhundert sind die meisten Musiker aus Musikerfamilien oder dem Kontext der Kirche hervorgegangen. Monteverdi aber hat keinen biografischen Hintergrund dieser Art. Er stammt aus einer Chirurgenfamilie und ist offensichtlich einfach durch Begabung aufgefallen. Er war nie in einem Kirchenchor, hatte Privatunterricht und war deshalb von musikalischer Tradition unbelastet. Der Herzog Vincenzo Gonzaga von Mantua hat sein kompositorisches Potenzial erkannt. Monteverdi war 23 Jahre alt, als er 1590 an den Hof von Mantua kam. Er war dort eigentlich als Instrumentalist, als Violaspieler, angestellt. Der Herzog hat ihm aber die Gelegenheit gegeben, sich als Komponist mit der Madrigalkunst auseinanderzusetzen.
Welche Fähigkeit hatte Monteverdi, die andere Komponisten seiner Zeit nicht hatten?
Er war in der Lage, sich in die innersten Empfindungen einer Figur hineinzudenken und diese Musik werden zu lassen. Schon als Madrigalkomponist hat er die Texte, die er vertonte, im Hinblick auf Atmosphäre und die Emotionen der auftretenden Charaktere gedeutet. Das war für die damalige Zeit etwas völlig Neues und ohne Vorbild. Monteverdi hat sich mit seinen Madrigalen bis zur Uraufführung von L’Orfeo 1607 selbst beigebracht, wie man das, was den Menschen im Inneren bewegt, durch Musik lebendig werden lassen kann. Die ersten Opern in Florenz um 1600 waren ja der Versuch, die Musik dem Wort konsequent unterzuordnen und so etwas wie ein gesungenes Sprechen zu erfinden. Die Musik sollte nur noch eine dienende Rolle haben, so beschreiben es die Florentiner. Aber Monteverdi hielt das nicht für den richtigen Weg. Er wollte die Musik in dieser Neuentwicklung trotzdem zu ihrem Recht kommen lassen und differenziert in seinem Orfeo, wo die Worte Präferenz haben sollen und wo Musik mit emotionalem Ausdruck, mit Virtuosität und instrumentalem Farbenreichtum hingehört. Damit beginnt im Grunde die Unterscheidung von Rezitativ und Arie. Ich behaupte, dass das zarte Pflänzchen Oper, das in Florenz entstanden war, sofort wieder abgestorben wäre, hätte Monteverdi nicht L’Orfeo geschrieben. Es ist nicht die erste Oper der Musikgeschichte, aber es ist die erste, die diese Gattung zukunftsfähig gemacht hat. Ohne Referenz. Das kam aus ihm heraus.
War Monteverdi ein Umstürzler, ein Revolutionär?
Nein. Er hat die Regeln seiner Zeit beherrscht und nie ihre Abschaffung gefordert. Im Gegenteil, er brauchte das traditionelle Regelwerk, um seine Überschreitungen als solche erkennbar zumachen. Wenn eine Figur ausser sich gerät, hat er sich auch in der Musik über die Ordnung hinweggesetzt und dem Aussersichsein durch Regelbruch im Tonsatz Ausdruck verliehen. Er attackiert die kompositorische Lehre nicht von aussen, sondern überschreitet und erneuert sie von innen.
Basieren seine Erfindungen auf Intuition oder sind sie ein konsequentes Zu-Ende-Denken der neuen musikdramatischen Herausforderungen, mit denen er sich konfrontiert sah?
Es ist bei ihm immer beides: Seine Musik offenbart eine perfekte Kombination aus spontaner Emotionalität und Durchdachtheit, aus sinnlicher Hingabe und kompositorischem Kalkül. Das findet man in dieser Form bei keinem anderen Komponisten der damaligen Zeit. Es gibt bei ihm keinen einzigen Ton, der nicht ganz bewusst gesetzt wäre. Das fasziniert mich bis heute. Ich bilde mir ein, inzwischen fast jede Note von Monteverdi zu kennen und trotzdem passiert es mir immer noch, dass ich ein Stück hervorhole und plötzlich verstehe, warum er eine Note genau an dieser einen Stelle untergebracht hat. Das geht mir nur bei ganz wenigen Komponisten so.
Können Sie ein Beispiel geben für Monteverdis musikdramatisches Gespür?
Er setzt Klangfarben sehr bewusst ein. Sie wirken auf den ersten Blick wie Nuancen, sind aber von grosser Bedeutung, etwa im berühmtesten Moment der Orfeo-Handlung: Orfeo dreht sich auf dem Weg aus der Unterwelt nach Euridice um, obwohl es ihm streng verboten ist. Er sieht sie an mit seiner ganzen Liebe und Sehnsucht – und sie muss zurück ins Totenreich. An dieser Stelle schreibt Monteverdi die Instrumentation präzise vor. Der Weg zum Tageslicht und das Zweifeln von Orfeo, ob sie auch wirklich hinter ihm ist, werden vom Cembalo begleitet. In dem Moment aber, in dem Orfeo sich umdreht und Euridice erblickt, soll ein Organo di legno erklingen. Monteverdi will hier den liegenden Klang der Orgel haben. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Für einen Augenblick wird musikalisch der Eindruck von Ewigkeit erzeugt. Der Anblick Euridices ist für Orfeo ein kurzer Moment der Erfüllung und des grössten Glücks. Aber dann bricht ihr Auge, und Orfeo singt «Ma qual eclissi, ohime, v’oscura» (Doch welches Dunkel umgibt Euch plötzlich). Das Cembalo setzt wieder ein. Monteverdi schafft mit einer einzigen instrumentalen Farbe Theatralität. Es ist ein kleines Detail, aber mit dem Denken, das dahinter steht, hat Monteverdi die Zukunft der musikdramatischen Form möglich gemacht.
Weil man bei L’Orfeo an der Wiege der Kunstform Oper steht, will man natürlich genau wissen, wie die äusseren Umstände der Uraufführung 1607 in Mantua waren. Wie und in welchem Rahmen wurde die Oper gespielt?
Was den genauen Ort der Aufführung angeht, weiss man heute mehr als noch vor zwanzig Jahren. Man ging ja lange davon aus, dass L’Orfeo am Hof der Gonzaga im repräsentativen Spiegelsaal aufgeführt wurde, aber das war nicht so. Die lokalen Musikwissenschaftler in Mantua haben intensiv recherchiert und mit Hilfe einer Beschreibung herausgefunden, dass die Uraufführung wohl in den Gemächern der Schwester des Herzogs, der Herzoginwitwe von Ferrara, in sehr kleinen Räumlichkeiten stattgefunden hat. Der Raum war vielleicht 100 Quadratmeter gross, mehr nicht. In ihm mussten die Sänger und das Orchester unterkommen. Platz für eine grosse Hofgesellschaft blieb da nicht. Es waren also sehr beengte Verhältnisse. Die Raumaufteilung, wie man sie jetzt kennt, legt nahe, dass möglicherweise in einem Raum gespielt und von einem anderen Raum aus zugehört wurde, dass man also gleichsam nur um die Ecke schauend etwas sehen konnte. So ganz genau weiss man das aber nicht.
Waren Sie einmal an dem Ort?
Ja. Aber der Anblick gibt keine Vorstellung mehr vom Zustand zur Zeit der Uraufführung. Der Palast wurde 1630 im Zuge des Erbfolgekriegs beim Sacco di Mantova zerstört, geplündert und regelrecht geschleift und hinterher immer wieder umgebaut.
Die Uraufführung von L’Orfeo war also keine grosse, repräsentative Veranstaltung?
Nein. Der Festanlass fand am Tag zuvor statt. Es war eine akademische Aufführung. Der Herzog und ein enger Kreis aus hohen Hofbeamten und Adeligen war anwesend, und sie waren nicht als Repräsentanten der höfischen Gesellschaft da, sondern als Kenner. Im Rahmen einer Akademie traten Herzog und Herzogin nicht als Herrscherpaar auf, dem man zu huldigen hatte, sondern man begegnete sich auf Augenhöhe. Die Akademien waren in dieser Hinsicht wie eine soziale Utopie, in der Hierarchien vorübergehend keine Rolle spielten.
Fand die Aufführung ohne Bühne und Kulissen statt?
Davon ist auszugehen, alleine wegen der engen Platzverhältnisse.
Monteverdi hat die Szene ausschliesslich musikalisch mit Singstimmen und Instrumenten vor dem inneren Auge der anwesenden Menschen entstehen lassen?
So könnte man sagen. Er verwendet schnarrende Zinken für die Unterwelt, Harfen für den Himmel, weitere Blasinstrumente für die Hirtenszenen – und Violinen, wenn Orpheus singt. Eigentlich ist ja die gezupfte Leier das Instrument, mit dem Orpheus in Verbindung gebracht wird. Zu Monteverdis Zeit war es in Italien aber ein Streichinstrument. Das geht auf das Parnass-Fresko von Raffael im Vatikan zurück, wo Apollo mit einer Lyra dargestellt ist, und diese Lyra war für Raphael die Lira da Braccio, die gestrichen wird.
Wie bedeutend war der kleine Hof von Mantua zu Monteverdis Zeit?
Er war ein kulturelles Zentrum mit grosser Ausstrahlung, vor allem im Hinblick auf Musik und Literatur. Mantua war auch ein religiös liberaler Ort. Es gab da beispielsweise auch eine kulturell bedeutsame, vom Herzog geförderte jüdische Gemeinde, was für die damaligen Verhältnisse ziemlich erstaunlich ist.
Warum hat der Herzog von Mantua L’Orfeo nur im kleinen Kreis aufführen lassen und mit seinem hochbegabten Komponisten nicht prachtvoll repräsentiert?
Monteverdi war sehr wohl für Repräsentation zuständig. Er musste andauernd irgendwelche Instrumentalmusiken und Ballette für Feste und Turnierspiele schreiben. Darüber beklagte er sich immer wieder in seinen Briefen. Nur kennen wir von diesen Musiken heute keine Note mehr. Der Nachwelt sind nur die Werke erhalten, die er in Druck gegeben hat. Man hat das Gefühl, dass da zwei Komponisten am Werk waren: Der eine Monteverdi schrubbt seinen Dienst, sowohl in Mantua wie auch später in Venedig; der andere sitzt nachts am Schreibtisch über der Musik, die er selbst für wichtig erachtet.
Lassen Sie uns über die Wiederentdeckung Claudio Monteverdis im 20. Jahrhundert sprechen. Das ist ja eine grosse Erfolgsgeschichte. Am Opernhaus Zürich fand Mitte bis Ende der 1970er-Jahre ein Aufführungszyklus seiner Opern statt, der von Nikolaus Harnoncourt musikalisch geleitet und von Jean-Pierre Ponnelle inszeniert wurde. War der Zürcher Zyklus ein entscheidender Markstein für die Monteverdi-Renaissance?
Auf jeden Fall war es der Startpunkt für die Opernbühnen. Dass ein Opernhaus, das sonst Mozart, Verdi und Wagner spielt, sich an diesen Komponisten herantraut – das war wirklich etwas Neues. Schallplattenaufnahmen und vereinzelte Aufführungen hatte es schon vorher gegeben. Die erste Aufnahme nach den Kriterien der historischen Aufführungspraxis von L’Orfeo etwa stammt von August Wenzinger aus dem Jahr 1955, bei der übrigens Fritz Wunderlich in mehreren Nebenrollen mitgewirkt hat. Richtig begonnen hat die Wiederentdeckung 1967, zu Monteverdis 400. Geburtstag. Ich selbst habe als Mitglied des Hamburger Monteverdi-Chors bei einer L’Orfeo-Schallplattenproduktion mitgesungen, die 1974 entstanden ist. Sie wurde von Jürgen Jürgens musikalisch geleitet, Nigel Rogers sang damals den Orfeo. Es hatte sich also schon vor Zürich einiges getan. Aber der grosse internationale Erfolg der Zürcher Aufführungsserie hat Monteverdis Opern den Weg in die Spielpläne geebnet. Zu Beginn dieser Renaissance wurde übrigens in erster Linie L’Orfeo aufgeführt, hin und wieder auch Il ritorno d’Ulisse in patria. Seine heute populärste Oper L’incoronazione di Poppea war zunächst völlig aussen vor.
Warum?
Poppea litt einerseits unter dem kargen Materialstand. Es ist ja praktisch nichts aufgezeichnet. Es gibt nur ein gedrucktes Libretto und eine Melodielinie mit beziffertem Bass als Notenmaterial. Man muss jede Aufführung selbst aus dem wenigen Vorhandenen entwickeln. Andererseits gab es noch im 20. Jahrhundert eine starke Ablehnung des amoralischen Stoffes. Man traute sich nicht so recht, das auf die Bühne zu bringen. Heute ist L’incoronazione di Poppea die mit Abstand am meisten aufgeführte Oper Monteverdis, auch kleinere Häuser wagen sich an sie. Eine atemberaubende Entwicklung innerhalb eines halben Jahrhunderts.
L’incoronazione di Poppea hat Monteverdi am Ende seines Lebens geschrieben, und zwar nicht mehr für eine kleine höfische Gesellschaft, sondern für ein öffentliches Theater. Der Stoff musste – anders als L’Orfeo – das Publikum erreichen, was die Sex-and-Crime-Geschichte um den römischen Kaiser Nero ja tatsächlich auch zu leisten vermag. Wie unterscheiden sich die beiden Opern in ihrer instrumentalen Ausgestaltung?
In L’Orfeo sieht Monteverdi einen Reichtum in der Instrumentierung vor, die ein wirtschaftlich kalkulierendes Theater gar nicht hätte bezahlen können. In dem Moment, in dem die Oper kommerziell wird, schrumpfen die Orchester, beziehungsweise sie sind gar nicht mehr vorhanden. L’incoronazione di Poppea wurde lediglich von einem bunten Continuo und ein paar Violinen gespielt. Die reich instrumentierten Sinfonien und Ritornelle und die grossen Chöre, die es im Orfeo gibt, wären für ein kommerzielles Opernhaus einfach zu teuer gewesen.
Welche Entwicklungen haben in den vergangenen fünfzig Jahren in erster Linie zur Wiederentdeckung Monteverdis beigetragen?
Ganz gewiss die mediale Verbreitung seiner Werke auf Schallplatte und CD. Nikolaus Harnoncourt etwa war ja ein unglaublich zugkräftiger Name am Schallplattenmarkt. Und dann natürlich der grosse Innovationsschub in der musikalischen Praxis: Stilfragen wurden erörtert, Quellenstudium betrieben. Es gründeten sich Spezialensembles, die immer virtuoser auf den historischen Instrumenten spielten. Dirigenten wie John Eliot Gardiner, René Jacobs oder William Christie erschlossen das Repertoire und waren sehr erfolgreich damit. Auch eine spezialisierte Gesangs-Ausbildung für Alte Musik entwickelte sich. Eine anspruchsvolle Partie wie den Orfeo konnten in den 1970er-Jahren vielleicht zwei Sänger singen, einer davon war Nigel Rogers, ein ganz wichtiger Pionier für die folgenden Sänger-Generationen, die sich an seinen Einspielungen orientierten. Er hat die Beweglichkeit im Kehlkopf, die man beispielsweise für die virtuosen Verzierungen in Orfeos berühmter «Possente spirto»-Arie braucht, in Indien gelernt. Rogers hatte Unterricht genommen bei Sängern der indischen Gesangskultur. Aber er war auch einer der ersten, die sich mit Verzierungslehren aus dem frühen 17. Jahrhundert beschäftigten und in die Praxis umsetzten, was Giulio Caccini und andere dazu geschrieben hatten.
Heute ist Stilkompetenz längst eine selbstverständliche Voraussetzung für die Aufführung eines Orfeo.
Ja. Man hat zum Glück wieder vergessen, wie sehr die historische Aufführungspraxis zu Beginn als Müsli-, Aussteiger- und Kiffermusik belächelt und bekämpft wurde. Ich kann mich an Hochschulseminare erinnern, an denen interessierte Gesangsstudentinnen und -studenten nicht teilnehmen durften, weil ihre Lehrer der Meinung waren, das würde die Stimme verderben: Da wird ohne Vibrato gesungen, da gehst du nicht hin.
Der Siegeszug der historischen Aufführungspraxis war aber trotzdem nicht aufzuhalten. Hatte er aus Ihrer Sicht auch seine Schattenseiten?
Dem Kult um die exponierten Dirigenten, zu denen ja auch Harnoncourt gehörte, stand ich eher skeptisch gegenüber. Die Alte Musik war doch unter anderem auch angetreten, um von dem Karajan-Starinterpretenkult wegzukommen – und plötzlich fand das hier auch wieder statt. Ich persönlich finde auch schade, dass die Spezialisierung und die immer höher steigenden Qualitätsstandards dazu geführt haben, dass die Chöre das wunderbare Repertoire des Madrigalgesangs mehr und mehr den professionellen, solistisch besetzten Vokalconsorts überlassen haben. Stilistisch war das ein Fortschritt, für die breite Musikkultur eher ein Rückschritt.
Wo stehen wir heute mit der historischen Aufführungspraxis?
Die Bewegung ist akzeptiert und Mainstream geworden. Auch die internen Grabenkämpfe, bei denen man sich die Köpfe heissgeredet hatte und übereinander hergezogen war, gehören der Vergangenheit an. Der Ehrgeiz, in die Archive zu gehen und unbekanntes Repertoire zu entdecken, hat nachgelassen, obwohl man auch sagen muss, dass inzwischen schon viel Spannendes ausgegraben und veröffentlicht ist. Der Einzug in die Mitte des Musikbetriebs hat auch bei der Alten Musik viel Mittelmass hervorgebracht. Aber das stört mich nicht. Ich geniesse es sehr, Barockopern auf dem hohen Niveau, das heute möglich ist, zu erleben. Zu meinen Sternstunden der jüngeren Zeit gehört übrigens eine Aufführung am Opernhaus Zürich von Jean-Philippe Rameaus Platée, die ich im vergangenen Herbst gehört habe.
Und was ist Ihr Traum als Monteverdi-Forscherin? Lassen Sie mich raten: Sie würden gerne noch die verschollene Oper L’Arianna aus irgendeinem Archiv ziehen.
Jeder will L’Arianna finden. Aber ich schätze mal, die Noten sind beim Sacco di Mantova in Flammen aufgegangen, oder irgendjemand hat sie nichtsahnend als Fidibus benutzt. Meine These ist, dass Monteverdi von L’Arianna als Gesamtoper nicht so überzeugt war wie von L’Orfeo. Sie war ein Auftragswerk, bei dem ihm sehr viele Leute reingeredet haben. Er schreibt später auch, dass er sich bei dieser Oper sehr gequält und geärgert habe. Vielleicht war ihm am Ende nur das berühmte, erhaltene Lamento d’Arianna wichtig, das er ja dann auch separat veröffentlicht hat, und der ganze Rest bedeutete ihm nicht so viel. Aber diese These ist genauso spekulativ wie die Hoffnung, dass die Noten noch irgendwo liegen.
Die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold war bis zu ihrer Pensionierung Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg. Ihr Forschungs-Schwerpunkt liegt in der Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts. Ihre Bücher über Claudio Monteverdi sind Standardwerke.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 112, Mai 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Monteverdis Relevanz
Drei Fragen an Andreas Homoki
Herr Homoki, die nächste Premiere ist Claudio Monteverdis Oper L’Orfeo. Mit dieser Produktion haben Sie nun alle erhaltenen Bühnenwerke dieses Komponisten in Ihrer Amtszeit neu präsentiert. Wie wichtig ist Ihnen dieser Werkzyklus?
Monteverdi liegt uns am Herzen, weil das Opernhaus Zürich eine besondere Verbindung zu diesem Komponisten hat, seit Nikolaus Harnoncourt und Jean-Pierre Ponnelle dessen Opern in den siebziger Jahren hier exemplarisch aufgeführt und wieder zu neuem Leben erweckt haben. Aber ich muss gestehen, dass ein neuer Monteverdi-Zyklus nicht ganz oben auf unserer Prioritätenliste stand, als wir hier angefangen haben. Dafür hatten wir, gerade im Barockrepertoire, zu viele andere Ideen. Wir wollten unbekannte Opern entdecken und vernachlässigte Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts aufführen. Umso schöner ist es, dass sich ein kompletter Zyklus nun trotzdem ergeben hat, zumal wir ja dank unseres Ensembles La Scintilla eine unvergleichliche stilistische Kompetenz haben, diesen Komponisten aufzuführen.
Sind Sie zufrieden mit der szenischen und musikalischen Qualität der Monteverdi-Produktionen?
Absolut. Ich finde, wir haben da eine grossartige ästhetische Vielfalt hingekriegt, die zeigt, wie viele musiktheatralische Möglichkeiten in den Opern von Monteverdi stecken und wie relevant dieser Komponist für uns bis heute sein kann. Wenn ich an Willi Decker zu Beginn meiner Intendanz zurückdenke, der Il ritorno d’Ulisse in patria ganz reduziert als Welttheater auf einer nahe zu leeren Drehbühne gezeigt hat oder an die extrem farbige Poppea von Calixto Bieito, der den Theaterraum aufgebrochen hat, indem er das Publikum auch auf der Bühne platzierte und auf einem Steg rund um den Orchestergraben herum spielen liess. Dann hatten wir Christian Spucks fein gezeichnetes, empfindsames Ballett zu den Madrigalen von Monteverdi. Und jetzt kommt wieder eine andere Regieästhetik, wenn Evgeny Titov L’Orfeo inszeniert. Er hat in der vergangenen Spielzeit mit George Benjamins zeitgenössischer Oper Lessons in Love and Violence gezeigt, wie suggestiv seine Bildwelten sind und wie genau gezeichnet er Figuren auf die Bühne zu bringen versteht. So stelle ich mir einen spannenden Werk-Zyklus vor – immer neu, immer anders und immer stark in der Theatralität.
Wie wichtig sind Ihnen grundsätzlich Werkzyklen als programmatisches Gestaltungselement des Spielplans?
Ich bin, ehrlich gesagt, kein grosser Freund davon. Ich bin halt Regisseur und will zunächst, dass jede Produktion für sich musikalisch und szenisch stringent ist und musiktheatralische Glaubwürdigkeit entwickelt. Das ist mir wichtiger als irgendwelche spielzeitübergreifende dramaturgische Konzepte. Die mögen gut fürs Feuilleton sein, aber zum Gelingen einer Produktion tragen sie erstmal nichts bei. Warum soll man Werke, die nicht zwingend zusammengehören, als Zyklus präsentieren, nur, weil sie vom gleichen Komponisten stammen? Warum sollte ich beispielsweise die drei Da-Ponte-Opern von Mozart einem Regisseur anvertrauen und die Stücke, die ja sehr unterschiedlich sind, in eine gemeinsame, übergeordnete Ästhetik zwingen? Ich sehe da den künstlerischen Mehrwert nicht. Das klingt jetzt etwas dogmatischer, als ich es meine. Wir verfolgen in unserer Spielplangestaltung natürlich auch programmatische Linien und haben beispielsweise die drei Tudor-Opern von Donizetti zu einer Trilogie zusammengefasst. Aber ganz grundsätzlich finde ich: Ästhetische Vielfalt macht die Spielpläne spannender, als sie am dramaturgischen Reissbrett zu ertüfteln.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 112, Mai 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
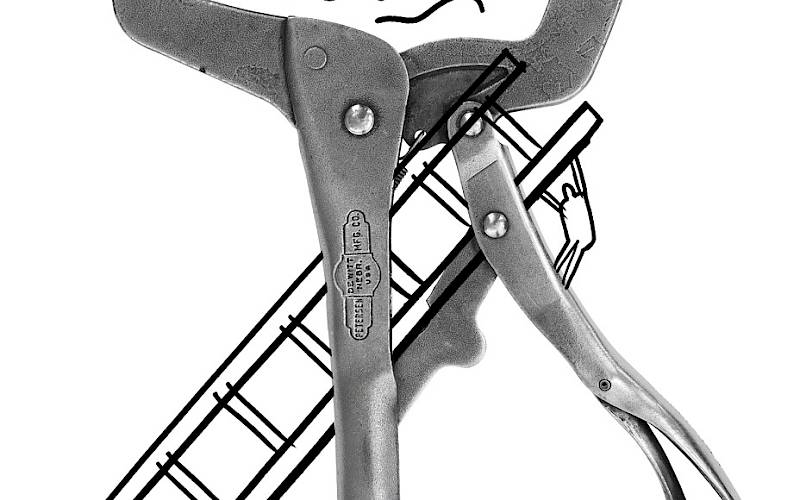
Flysch von Zumaia
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
Das Ganze ist so spektakulär, dass Sie nach dem Besuch der Vorstellung den Wunsch verspüren werden, solche Formationen auch in Ihrem Wohnzimmer einzubauen. Unser Theaterplastiker Andi Gatzka und sein Team wissen, wie es geht:
Davon ausgehend, dass Ihr Wohnzimmer die üblichen Bühnenabmessungen hat, benötigen Sie ca. 50 Kubikmeter Styropor, 500 Quadratmeter Baumwollstoff, 250 Kilogramm Holzleim, 40 Dosen PU Schaum, 1,2 Tonnen Acrylmasse als Überzug und eine Putzmeisterspritzpistole. Kleiner Tipp: Decken Sie vor den folgenden Arbeiten Ihnen wichtige Einrichtungsgegenstände ab.
Beginnen Sie damit, das Styropor zu einer 9 Meter hohen, 16 Meter breiten und 20 Zentimeter tiefen Wand zusammenzusetzen. Nun schneiden Sie aus dieser Wand 5 bis 10 Zentimeter dicke, 20 Zentimeter tiefe und 9 Meter lange Streifen. Möglichst immer unterschiedlich dick. Jede dieser ca. 250 Streifen wird später eine sichtbare Schicht der Felsformation bilden. Greifen Sie nun nach einem Ihrer langen und vor allem scharfen Küchenmesser und schnitzen Sie bei jedem einzelnen Streifen entlang der 9 Meter langen Oberkante eine sehr unruhige Oberfläche: Nehmen Sie mal 15 Zentimeter weg, mal 2 Zentimeter. Hacken Sie mal rein, runden Sie auch mal ab: Möglichst unruhig. Wenn Sie nicht weiterwissen, schauen Sie nochmals auf die Bilder im Internet. Kleben Sie nun mit dem PU Schaum die einzelnen Styroporstreifen mit der nicht geschnitzten 9 Meter langen Rückseite senkrecht stehend direkt auf Ihre Zimmerwand. Die geschnitzte Seite schaut dabei in den Raum. Achten Sie dabei darauf, dass die 250 Schichten deutliche Versätze zueinander haben – erst das macht das typische spannende Spiel der Felsbänder aus.
Da Styropor eine sehr verletzliche Oberfläche hat, die noch dazu schwer zu bemalen ist, bekleben Sie anschliessend die Oberfläche mit einem dünnen Stoff. Wir empfehlen dafür Schleiernessel, den Sie mit dem Holzleim gut auf das Styropor kleben können. Nun ist die Oberfläche wiederum zu glatt. Deswegen füllen Sie die 1,2 Tonnen Acrylmasse in die Spritzpistole und überziehen Ihre gesamte Wand zweimal mit einer dünnen Schicht Acrylputz. Dadurch entsteht eine raue Steinoberfläche, und Sie haben nun typische Flyschschichten erzeugt. Nach dem Trocknen einfach in den gewünschten Farben anmalen – unsere Bühnenbildnerin Chloe Lamfort entschied sich auf unserer Bühne für ein mattes Schwarz, passend zur Unterwelt, aus der Orfeo seine Geliebte Eurydike zurückholen möchte.
Der geologische Begriff Flysch ist übrigens schweizerdeutsch: Er soll aus dem lokalen Dialekt im Simmental stammen und dort schieferartiges, leicht erodierbares Material bezeichnen.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 112, Mai 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Krystian Adam
Volker Hagedorn trifft...
Wenn es etwas gibt, das Sängerinnen und Sänger in Interviews selten tun, dann ist es Singen. Sie sprechen viel und gern über ihre Kunst, manche bis auf historische Details genau oder bestimmte Intervalle, manche lieber über die Gefühle in ihrer Rolle. Aber Töne lassen sie kaum hören. Und die meisten sprechen so, dass ein Aussenstehender nicht auf die Idee käme, sie als Sänger zu identifizieren, also normal, ungestützt, eher leise, wenn auch vielleicht etwas klarer prononcierend als andere Leute. So unauffällig spricht auch Krystian Adam, der Tenor. Aber er singt oft bei unserem Gespräch in der Cafeteria der Oper Zürich, gleichsam ohne seinen Redefluss zu unterbrechen, mezzopiano, akustische Vignetten mit leichter Stimme, um etwas zu verdeutlichen. Das geht von Monteverdi bis, ja doch, Chopin, bis zur Polonaise As-Dur opus 53…
Am ausführlichsten singt Krystian, als er von einem gefährlichen Moment seiner Karriere erzählt, von einer jener barocken Arien, in denen man auch Töne singen muss, die nicht da stehen, selbsterdachte Verzierungen, Koloraturen, Kadenzen. «Das war beim Festival in Santiago di Compostela. Ich hatte noch nicht viel Erfahrung und improvisierte eine Kadenz, begann und wusste nicht mehr, wo ich war.» Er singt, ganz entspannt dasitzend, leise eine Skala aufwärts, setzt neu an, noch eine, es geht treppauf und treppab, bis zu einem Triller … «Wenn diese Note jetzt nicht auf die Tonika passt, habe ich trouble! Ich war so gespannt. Und das Orchester spielte den Akkord, uff, ein 100-Kilo-Gewicht fiel mir von den Schultern! So etwas habe ich dann lange nicht mehr riskiert.»
Es gehe ja auch nicht nur darum, nach Koloraturen richtig zu landen, sondern auch, die Verzierung dem Affekt der Arie anzupassen, Wut brauche andere Töne als Übermut. Inzwischen könne er ganz gut improvisieren, «aber an jedem Abend eine andere Kadenz singen, das mache ich nicht.» Für eine der berühmtesten Arien im Orfeo, mit dem Krystian in Zürich debütiert, habe Claudio Monteverdi ohnehin selbst eine Kadenz geschrieben, für «Possente spirito», den Gesang, mit dem es Orpheus gelingt, in die Unterwelt vorzudringen, um seine geliebte Eurydike zurück ins Leben zu holen. «Es ist meine Lieblingsrolle», meint der Tenor, «superschwierig, nicht nur musikalisch. Was der fühlt, ist unglaublich.» Identifiziert er sich mit diesem Helden? «Das Wichtigste im Leben», sagt Krystian in seinem gepflegten, dezent polnisch gefärbten Englisch, «ist lieben und geliebt werden. Wenn man die Liebe des Lebens findet, tut man alles für sie oder ihn. Jeder von uns ist dieser Orfeo. Nur hat vielleicht nicht jeder diesen Mut.» Einmal seien ihm die Tränen gekommen, als er «Tu se’ morta» sang, «Du bist tot, mein Leben, und ich atme noch?» «Das war mir so nah, und es muss auch real sein. Man kann das nicht schauspielern. Ich glaube, dass in vielen Rollen die wahre Empfindung für das Publikum wichtiger ist, als dass alles perfekt gesungen wird. Ich sah mal Tosca mit einem verheiraten Paar, ein Liebesduett mit Tosca und Cavaradossi, das war nur fake. Sie waren im wahren Leben verheiratet, aber auf der Bühne war gar nichts.» Das ginge ihm mit seiner Frau, der Sopranistin Natalia Rubiś, wohl anders. Die beiden treten mitunter auch gemeinsam auf, aber weder in Orfeo noch in Tosca, denn ihre Domäne ist die Oper des 19. Jahrhunderts und seine die der beiden Jahrhunderte davor. Was keineswegs Krystians ersten Plänen entsprach – gerade Puccinis Tosca hatte ihn schon als kleinen Jungen beeindruckt, «alles war so schön, obwohl ich nichts verstand!» Sein Weg zum Gesang begann im schlesischen Städtchen Jawor, «in einem Haus voller Musik, meine Eltern sind keine Musiker, aber sie hörten alles Mögliche. Eine Tante hatte ein Klavier, auf dem probierte ich ein bisschen und sagte, das möchte ich auch haben, mit sechs. Mein Vater meinte, na gut, wir besorgen ein Klavier und gucken, was passiert.» Krystian lernte schnell, mit elf durfte er auch in der Kirche Orgel spielen, «singen musste ich da auch», ein Gesangslehrer hörte das und schickte ihn zu einem Kollegen ins 70 Kilometer entfernte Wrocław.
Bei diesem Breslauer Lehrer, Bogdan Makal, hat er dann auch Gesang studiert, mit den grossen italienischen Opern im Sinn. «Ich dachte, wer Sänger sein will, muss Tosca und Traviata singen.» Mit dem Ziel setzte er das Studium auch in Mailand fort, am Konservatorium, sang mit im Chor der Scala und war nicht gerade begeistert, als ein Dirigent ihn für ein Programm mit Händel fragte. «Naja, als Student brauchte ich Geld… Danach sagte der, ich glaube, diese Musik ist perfekt für dich. Lass uns noch etwas probieren. Und ich begann die barocke Musik Schritt für Schritt zu lieben. Man öffnet die Tür und sieht mehr und mehr Licht und dann einen schönen Garten…» Es ging noch ein anderes Licht auf in Mailand. Sein polnischer Lehrer rief an und bat ihn, einer seiner Studentinnen, die dort studieren wollte, die Stadt zu zeigen. «Sie war mit ihrem Freund da und ich mit meiner Freundin, also, das war nicht so einfach… es ist sechzehn Jahre her, und seit elf Jahren sind wir verheiratet.» Wie er, hat sich auch Natalia in die Insel Sardinien verliebt, wo die beiden inzwischen ihren zweiten Wohnsitz haben, neben Warschau. «Viele Reisen, ja. Aber nur an einem Ort halte ich es sowieso nicht aus. Ich träumte schon als Junge von grossen Reisen.»
Mir fällt ein, wieviele polnische Künstler Kosmopoliten sind und zugleich sehr ihrem Land verbunden. Gibt es so etwas wie eine polnische musikalische Identität? «Danke für die Frage! Ich könnte die ganze Zeit Chopin hören. Besonders, wenn ich lange weg bin. Schon zwei Akkorde sagen etwas über Polen.» Er singt den Anfang des Themas der As-Dur-Polonaise, so berühmt, dass man darin fast schon das ganze Stück hört. Aber einer wie Krystian – der als Pianist das Stück ja auch selbst spielen kann – hört noch mehr: «It’s so Polish inside! Da fühle ich mich wirklich zu Hause.» Und er singt gleich weiter …
Ein anderes musikalisches Zuhause ist für ihn die Szene italienischer Barockinterpreten, zu der auch Ottavio Dantone zählt, der Dirigent des Zürcher Orfeo. Zeitweise war Dantone auch Cembalist des Mailänder Ensembles Il giardino armonico, für das sich der Sänger schon als Student begeisterte. «Das waren für mich die Götter der Barockmusik! Das ist nicht die höfliche englische Art, tantakadamm…», er deutet singend einen Rhythmus an, «das ist die italienische Art», derselbe Rhythmus mit mehr Kante und Drive. «Sie bringen all diese Musik als Musik von heute. Das ist alles zusammen, Barock, Rock, Pop…» Als er später für einen Auftritt mit diesen Musikern angefragt wurde, konnte er sein Glück kaum fassen und hielt mitten auf der abgelegenen Strasse an, wo ihn im Auto der Anruf seiner Agentur erreicht hatte. «Ich fühle mich noch heute ein bisschen wie ein Schuljunge, wenn ich mit ihnen arbeite.» Indessen war es doch ein Engländer, nämlich John Eliot Gardiner, der Krystian darauf brachte, wieviel Pop auch im Orfeo steckt, etwa in «Vi ricorda, o bosch’ ombrosi». Auch eines der Stücke, die er nur ansingen muss, um alles wachzurufen. «Er sagte, du kommst damit wie Elvis Presley auf die Bühne! Ja, Orfeo ist auch ein Popstar.» Genau deswegen reizte es Krystian auch, beim Projekt Orfeo 2.0 mitzumachen, bei dem das Leverkusener Ensemble L’arte di mondo neben Streichern und Laute auch E-Gitarren und Schlagzeug einsetzt. «Meine Agentur riet ab: Du hast Orfeo mit Gardiner in der Carnegie Hall gemacht – und jetzt so etwas? Aber ich experimentiere gern. Wenn man im Theater weinen kann, ist alles gut, egal mit welchen Instrumenten.»
Wie wahr das ist, merke ich auf der Bühnenprobe nach unserem Gespräch. Es ist die erste Probe auf der grossen Bühne, noch mit einem Klavier im Graben. Schon die ersten Harmonien reissen einem das Herz auf. Dann kniet Orfeo neben dem offenen weissen Sarg, hebt die Hand der Toten hoch, an der der Ehering funkelt, und Krystian Adam erhebt seine geschmeidige Stimme zu jenem «Rosa del ciel», mit dem Orfeo sonst sein Glück besingt. Es ist nur eine Probe. Aber wenn der ganze Abend so wird, werden die Leute mehr als ein Taschentuch brauchen.
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 112, Mai 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Josè Maria Lo Monaco
Fragebogen
Aus welcher Welt kommst du gerade?
Aus der Welt der Kinderlieder! Von den «filastrocche», ein italienischer Begriff, den ich sehr mag. Ich habe sie als Kind gerne gesungen, und sie gehören immer noch zu meinem Alltag, weil ich sie im Moment meinem zweijährigen Sohn vorsinge. Sie sind eine Möglichkeit, ihn zum Einschlafen zu bringen und ihm durch den Gesang meine Liebe zu vermitteln. Letzteres tue ich ja auch auf der Opernbühne.
Was bedeutet dir die Musik von Monteverdi?
Sie ist der Beginn der Oper, aber für mich auch der Beginn meiner Karriere. Ich hatte das Glück, seine Musik bei meinen ersten grossen Debüts und Aufnahmen zu singen. Mit Monteverdi hat für mich alles begonnen. Ich hatte von Beginn meiner Karriere an die Gelegenheit, Monteverdi mit grossen Dirigentenpersönlichkeiten der Alten Musik zu singen wie Jordi Savall, Alan Curtis, Andrea Marcon und natürlich Ottavio Dantone, dem Dirigenten unserer Zürcher Produktion. Ihm habe ich sehr viel zu verdanken, mehr als jedem anderen. Er hat mir so viel beigebracht.
Worauf kommt es an, wenn man Monteverdi gut singen will?
Man muss diesen Komponisten kennen und respektieren. Das Wort ist in seinen Werken Königin, die Musik erhaben. Man muss der Sprache Bedeutung bei messen, aber auch den Pausen und dem Schweigen, als ob man mit der Stimme ein Bild malen würde, indem man die gesamte Farbpalette einsetzt. Das ist die Schönheit der Barockmusik. Sie erlaubt, jeder Phrase Intensität und Ausdruckskraft zu verleihen, um das Publikum und mich selbst zu bewegen.
In L’Orfeo singst du die Messagera, die Todesbotin. Welche Charakterzüge hat diese Figur?
«Silvia, die Freundliche» wird sie an einer Stelle des Librettos genannt. Es ist kein Zufall, dass Monteverdi eine Botin mit der Tugend der Freundlichkeit mit der schweren Aufgabe betraut, Orfeo die Nachricht von Euridices Tod zu überbringen. Ihr Auftritt auf der Bühne verändert die Atmosphäre völlig: Alle, nicht nur Orfeo, hängen an ihren Lippen, wenn sie erzählt, wie Euridice von der Schlange gebissen wurde. Die Messagera hat keine Angst vor dem Tod, aber sie erfährt Orfeos Schmerz so intensiv, dass sie sich selbst schuldig fühlt.
Welches Buch würdest du niemals aus der Hand geben?
Ich werde die Bücher, die aus Worten und Noten bestehen, niemals zur Seite legen – die Partituren!
Welchen überflüssigen Gegenstand in deiner Wohnung liebst du am meisten?
Meine Küchenmaschine! Ich liebe sie, weil sie meine Hoffnung ist. Sie könnte eine grosse Hilfe sein, denn ich bin keine begnadete Köchin. Aber ich benutze sie so selten, dass sie wahrscheinlich der nutzloseste Gegenstand im Haus ist, den ich aber nicht aufgeben würde.
Du kannst Monteverdi treffen. Worüber wirst du auf jeden Fall mit ihm sprechen?
Ich wünschte, ich könnte ihn treffen! Zuerst würde ich ihm unendlich danken, dann würde ich ihn sofort bitten, mit mir zu spielen.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 112, Mai 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wir haben einen Plan
Backstage
In unserer neuen Inszenierung von «L’Orfeo» markiert eine riesige, schwere Metalltür den Übergang ins Totenreich, und Caronte wacht als furchterregender Wappenkopf über dem Eingang. Wie aber bringt man einen Wappenkopf zum Singen? Das ist eine weitere Aufgabe für unsere findige Theaterplastik, die auch schon Drachen, Krähen und Hühner lebendig werden liess. In ihrer Werkstatt haben sie ein mechanisches Gesicht ertüftelt, das zunächst einmal vor allem den Mund öffnen können sollte, wenn der Bass Mirco Palazzi unsichtbar seine finstere Arie orgelt. Und natürlich sollten sich die Augen schliessen, wenn Caronte wegschlummert. Aber das war unseren Theaterplastikern noch nicht genug. Jetzt kann Caronte auch noch grimmig die Augenbrauen zusammenziehen, die Lippen bewegen und einiges mehr.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 112, Mai 2024. Dort ist auch der tatsächliche Plan zu sehen.
Das MAG können Sie hier abonnieren.