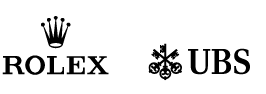Tannhäuser
Handlung in drei Aufzügen von Richard Wagner (1813-1883)
Dichtung vom Komponisten
Die Zürcher Aufführung folgt der Fassung der Wiener Aufführung vom 22. November 1875
In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 4 Std. 25 Min. inkl. Pausen nach dem 1. Akt nach ca. 1 Std. 15 Min. und nach dem 2. Akt nach ca. 3 Std. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Volker Hagedorn trifft …

Stephen Gould
Er trägt schwere Schuhe mit Spikes, um im Schneematsch vor der Semperoper nicht auszurutschen. Ein Mann von dieser Grösse und mit diesem Job darf auf keinen Fall ausrutschen. Stephen Gould ist sehr gross, wie seine Stimme. Die Fachbezeichnung lautet Heldentenor, dramatisches, schweres, deutsches Fach.
Er zählt zu den wenigen, die damit international unterwegs sind, auf grossen Bühnen von Dresden bis New York: Tannhäuser, Tristan, Siegfried. Und noch weniger sind es, die mit den Texten dieser Wagnerhelden derartig sensibel umgehen wie er. Gould steuert das Café Schinkelwache an. «Ein Stück Kuchen?», fragt die Kellnerin. «Absolut! Man muss das haben!» Er lacht tief, körnig und tragend. «Gibt es noch die Waldfruchtbuttermilchtorte?...Okay.»
Das Tortenstück bleibt dann noch lange intakt, weil Gould gern weit ausholt, mit seiner Stimme mühelos sich behauptend im Geklimper aus den Boxen, dem Geschirrklappern, den Gesprächsfetzen von den Nebentischen. Die Dresdner Inszenierung des Tannhäuser, die Peter Konwitschny vor nun schon 22 Jahren ersann, gefällt ihm immer noch, er sieht sie als Vorläufer des legendären Hamburger Lohengrin, mit dem ihn dieser Regisseur restlos überzeugt hat. «Besonders der dritte Akt ist hier stark. Die Gesellschaft ist krank, ehe Tannhäuser sie verlässt, und Konwitschny macht sich auch über die kindische Seite der Menschheit lustig.» Auf die Inszenierung von Harry Kupfer in Zürich ist er gespannt, er, der schon fast hundert Mal den Tannhäuser gesungen hat.
Vielleicht weiss niemand so viel über diese Gestalt wie Stephen Gould, und das nicht, weil er besonders früh angefangen hätte, Wagner zu singen. Er war schon 38 Jahre alt, als er Heldentenor wurde. Er hat lange suchen und kämpfen müssen. 1962 als Sohn eines Methodistenpastors in Virginia geboren, mit einer Pianistin als Mutter, wollte er zur Oper, seit er zum ersten Mal eine gesehen hatte, mit Siebzehn, La bohème. Stephen Gould studierte in Boston Gesang und kam dann ins Nachwuchsprogramm der Lyric Opera von Chicago. «Sie sagten mir, ich sei ein dramatischer Rossinitenor, und ich war in der Lage, das mit Kopfstimme und beinahe Falsett hinzukriegen. Aber das war das falsche Fach. Ich musste lyrischer Bariton werden. Und niemand brauchte einen.»
Um Geld zu verdienen, heuerte er beim Phantom der Oper an, acht Jahre auf Tour quer durch die USA. Das hat schon das Format einer heroischen Irrfahrt. Nebenrollen, tausende von Vorstellungen, alle nicht mit der Stimme, die in ihm schlummerte. Dann traf er John Fiorentino, einen Gesangslehrer, der lange an der MET gesungen hatte. «Er sagte, wir können dich zu einem dramatischeren Bariton machen, aber dann bist du a dime a dozen, man kriegt zwölf von denen für zehn Cent. Oder wir lassen deine Stimme entscheiden, wo es hingeht.» Gould kündigte beim Phantom und wurde Angestellter der New Yorker Telecom, während er sich drei Tage pro Woche bei John Fiorentino alles abgewöhnte, was er bis dahin mit seiner Stimme gemacht hatte. «Ich hatte nie daran gedacht, Wagnersänger zu werden. Wagner fand mich. So war er schon immer. Er fand die Sänger, die seine Musik machen konnten.»
Drei Jahre dauerte die Arbeit am Fachwechsel zum Heldentenor. Dann sagte der Alte: «Such dir in Europa einen Job. Geh an ein deutschsprachiges Haus. In der Praxis lernst du das, was man nicht üben kann.» Gould flog über den Atlantik, Sommer 1998, er sang vor, wo immer er konnte und durfte, «ich wurde nirgendwo akzeptiert. Ich war bereit, aufzuhören und den wirklich guten Job bei der Telecom in New York zu machen. Ich wollte einen Platz im Leben finden. In der letzten Woche, schon im Juni, bekam ich ein Angebot aus Linz. Und das war’s.» Es gab einen wagemutigen Intendanten in Linz, Michael Klügl, der liess einen unbekannten Norweger den Tannhäuser inszenieren und gab die Titelrolle einem unbekannten Amerikaner. In der Regie von Stefan Herheim war Stephen Gould der Kracher. Das fiel nicht nur in Linz auf.
«Klügl», sagt Gould heute, «ist einer der wenigen Intendanten, die Sänger verstehen. Ich konnte meine Vorstellungen in seinem Haus geben und ebenso an anderen Theatern singen.» Die meldeten sich immer häufiger. Es ging steil aufwärts. 2004 debütierte Gould als Erik in Dresden und als Tannhäuser in Bayreuth. «Ich liebte die Produktion von Philippe Arlaud, er interessierte sich wirklich für jeden einzelnen Choristen. Es war ein fantastisches Ensemble, mit grossem Zusammenhalt. So etwas nimmt man mit für immer.» Auch Inszenierungen von Claus Guth und Robert Carsen haben ihn beeindruckt. Bei allen entwickelte sich sein eigener, innerer Tannhäuser weiter. «Reist er wirklich nach Rom? Wie kann der Papst oder Gott dir vergeben, wenn du dir selbst nicht vergeben kannst? Und ist nicht auch etwas Venus in Elisabeth?» Zugleich fndet er Tannhäuser und Tristan sehr shakespearisch. «Alle berühmten Schauspieler, die den Lear gespielt haben, sagen, nach zwanzig Jahren verstehen sie die Rolle immer weniger. Das geht mir mit diesen Partien auch so. Aber genau deswegen ist da immer etwas Neues, wenn du wagst, es auszuprobieren. Es muss ja nicht immer funktionieren. Aber es muss immer der Blick auf etwas sein, das in der Musik schon existiert.» Als «Desaster» hat er den Bayreuther Ring in Erinnerung, den 2006 Tankred Dorst inszenierte: «Ein wunderbarer Künstler, aber kein Opernregisseur. Und mir war nicht klar, dass man total die Technik wechseln muss, wenn man beide Siegfrieds singt, im Siegfried und in der Götterdämmerung. Das hätte beinahe meine Karriere gestoppt…»
Jetzt sorgt er sich vor allem um den Rest der Branche. «Man möchte jüngere, schönere Sänger, und selbst für hochdramatische Stücke werden Leute gecastet, die stimmlich nicht soweit sind.» Als Student stand er neben Carol Vaness auf der Bühne, «sie sang Mozart mit dem schönsten Legato und Kern und Klang. Jetzt haben wir Spezialisten, die singen mit weniger Vibrato, great, aber du kannst sie nicht hören! Nun wird ja schon an vielen Häusern indirekt verstärkt. Der Tag wird kommen, an dem ein Radamès auftritt, fantastisch aussehend, nur einen Lendenschurz tragend, 25 Jahre, Muskeln und alles, mit einem kleinen Mikro am Kopf, und mit der Stimme eines Experten für Alte Musik Celeste Aida singt.» Auch sonst sieht Stephen Gould mit wenig Optimismus in die Zukunft der Oper: zuwenige Häuser, an denen Sänger in Ruhe wachsen können, Dirigenten, die mit Sängern nichts anfangen können, Komponisten, «die unsingbare Linien schreiben und in 150 Jahren keine Rolle mehr spielen.» Umso mehr freut er sich auf die Elisabeth im Zürcher Tannhäuser. «Lise Davidsen ist dabei, eine der Grossen zu werden. Sehr stark, sehr klug, wirklich hochdramatisch.» Sie wird auf einen Kollegen treffen, dem es nicht nur um schöne Töne geht. «Tannhäuser ist in der Romerzählung bitter, müde, erschöpft, zornig, boshaft, ja zynisch, all das auf der Kippe zum Wahnsinn. Das musst du in der Stimme hören, in den Farben. Ich bin kritisiert worden, weil mein Legato durch die Emphase auf bestimmten Worten gestört wird. I don’t care. Wenn man expressiv ist, auf den Text konzentriert, verzeiht einem Wagner gern kleine Brüche im Legato.»
In dieser Welt wird viel gereist. Seine Wohnung in Wien braucht er nur acht Wochen im Jahr, sein Haus in Connecticut vier Wochen. Familie hat er nicht, «da wäre diese Karriere nicht möglich gewesen.» Zum Abschied stehen wir vor dem Café, und Gould, einen Kopf grösser als ich, blickt mit seinen hellen, klaren, türkisfarbenen Augen über den Platz vor der Oper, als stünde er ganz woanders vor weitem Horizont. Als sei die ganze Heldenwelt in ihm, die Essenz all dieser grossen Typen. Man stelle sich vor, dieser Mann sässe an einem Bildschirm der New Yorker Telecom! Unmöglich. Vielleicht sind ja all diese Rollen, Siegfried, Tristan, Tannhäuser, auch geschrieben worden, damit für solche wie ihn die Welt nicht zu eng wird. Dann stapft er durch den Schnee zur Probe.
Text von Volker Hagedorn.
Foto von Kay Herschelmann.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 66, Februar 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die geniale Stelle
Wie seltsam: Wolfram von Eschenbach, der beste und beliebteste Sänger unter den Wartburgrittern, scheint der Aufgabe, das Wesen der Liebe zu ergründen, nicht gewachsen zu sein. Ziemlich blass und unsicher wirkt sein Lied, das zunächst nur eine Reihung abgegriffenster Beschreibungen der lauschenden Wartburggesellschaft bringt: Die Männer sind natürlich «tapfer, deutsch und weise» und werden mit einem grünen Eichwald verglichen, die Frauen sind «hold und tugendsam» und bilden einen duftenden Blumenkranz. Fast scheint der Sänger vor der Aufgabe zu kapitulieren. Wenn er nach einigem nervösen Klimpern auf der Harfe doch fortfährt, ist nicht mehr von Wald und Blüten die Rede, sondern von einem Stern, dann von einem Gebet – und schon scheint die Inspiration erneut zu versiegen.
Ein neuer Anlauf, und nun scheint endlich die Grundtonart des Liedes erreicht zu sein, das Tempo festigt sich, die Melodie schwingt weiter aus: Der Sänger hat den Punkt gefunden, von dem aus er das Thema angehen kann. Er lässt auch das Bild des angebeteten Sterns unvermittelt fallen und singt nun von einem «Wunderbronnen», dessen reines Wasser die Liebe, wie er sie versteht, symbolisiert. Dann scheint sich der Sänger einen Ruck zu geben: Überraschend verdunkelt sich der Klang, die Tonart wechselt abrupt nach Moll, die Gesangslinie gewinnt an Schwung und Sicherheit, der Sänger spricht nun bündig aus, was er zu sagen hat: «Und nimmer möcht’ ich diesen Bronnen trüben, / berühren nicht den Quell mit frevlem Mut!»
Wer Wolfram dieser Worte wegen zu einem Fürsprecher der platonischen Liebe macht, überhört den leidenschaftlichen Ton, in dem sie vorgetragen werden. Hier wird keine lebensferne Ideologie der Entsagung verkündet, hier wagt ein Liebender sein Innerstes herauszukehren, und das ist auch die Erklärung für seine anfängliche Unsicherheit. Er singt von seiner schmerzlichen Lebensentscheidung, die er traf, als er Tannhäuser zu Elisabeth zurückbrachte, zu Elisabeth, auf die er damit aus Liebe zu ihr für immer verzichtet hat. Seine Worte richten sich direkt an die Geliebte und ausser ihr ist wohl niemand im Saal, der sie versteht. Tannhäuser jedenfalls ist viel zu sehr von seiner künstlerischen Sendung eingenommen, als dass er wahrnehmen könnte, was hier gerade geschehen ist. Man darf bezweifeln, dass er, der in seiner unbeherrschten Arroganz den Skandal heraufbeschwört, der Elisabeth vernichten wird, wirklich mehr von der Liebe versteht, wie er lautstark spöttelnd behauptet. Gewiss erfasst er, indem er zum Schrecken der wohlerzogenen Wartburgleute die sexuelle Lust zum Wesen der Liebe erklärt, einen wichtigen Aspekt, den Wolfram ausgelassen hat, aber dem Kern der Sache scheint sein Rivale doch näher zu sein, dessen Leidenschaft nicht besitzergreifend und zerstörend ist, sondern auf Zuwendung, Mitgefühl und Respekt für den anderen Menschen zielt.
Tannhäusers Egomanie mag einer Gesellschaft, die sich die rücksichtslose Selbstverwirklichung des Individuums auf die Fahnen geschrieben hat, vorbildlich scheinen. Wagner schwebte etwas anderes vor, und darum hebt seine Komposition das Bekenntnis zu einer Liebe, die bis zur Aufopferung für den anderen geht (das übrigens genau in der Mitte des Werkes platziert ist), so stark hervor, dass man in ihnen das utopische Moment entdeckt, dessen Verwirklichung der Komponist sich von der Revolution erhoffte: Es ist der Traum von einer Welt der Liebe, der gegenseitigen Achtung und Solidarität, in welcher der Mensch nicht mehr des Menschen Wolf ist.
Text von Werner Hintze.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 66, Februar 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Meine Rolle

In Zürich gebe ich mein Rollendebüt als Elisabeth in Richard Wagners Tannhäuser. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für mich in die Welt von Wagners Musikdramen, denn in diesem Sommer werde ich die Elisabeth auch in der Neuproduktion singen, die bei den Bayreuther Festspielen herauskommt. Gleichzeitig bereite ich die Partie der Sieglinde vor, die ich auch bald auf der Bühne präsentieren möchte. Wie man sieht, nimmt das Wagnerfach einen immer wichtigeren Stellenwert in meinem Repertoire ein.
Ich stehe zwar mit Anfang Dreissig noch eher am Beginn meiner Karriere, aber viele Leute in meinem künstlerischen Umfeld sagen mir schon seit Jahren, dass meine Stimme für Wagner wie gemacht ist. Ich dachte dann oft: Ihr könnt mir viel erzählen, aber was wirklich zu mir, meiner Stimme und meiner Persönlichkeit passt, muss ich erst einmal selbst herausfinden. Ich gehöre nämlich nicht zu den Menschen, die einfach machen, was man ihnen rät. Ich kann nur gut singen, wovon ich auch wirklich überzeugt bin, ich muss eine innere Einstellung und ein Gefühl für die Rollen und die Musik entwickeln, damit ich sie auf der Bühne verkörpern kann. Bei den Werken von Richard Strauss und insbesondere bei Ariadne, die ich sehr gerne singe, ist mir das leichter gefallen. Bei Wagner hat das eine Weile gedauert. Für mich war das zunächst gar nicht so klar, dass ich in diese Richtung gehen muss. Aber inzwischen habe ich diesen Weg gefunden und fühle mich wohl mit den Wagnerpartien.
Ich habe bereits kleinere Partien im Ring des Nibelungen gesungen, Freia etwa, und mich so dem Wagnerkosmos immer mehr angenähert. Jetzt kommt Elisabeth dazu, genau zur richtigen Zeit. Die Partie verlangt einen für Wagner-Massstäbe eher leichteren Sopran und ist nicht ganz so umfangreich und kraftraubend wie die ganz schweren Partien. Es gibt ja immer Leute, die davor warnen, zu früh ins Wagnerfach einzusteigen, aber ich halte diese Sorge für überbewertet. Es ist bei anderen Komponisten nicht weniger gefährlich, wenn man zu früh die falschen Sachen singt. Man muss halt genau hinsehen und ein Gefühl dafür entwickeln, was man sich zutrauen kann. Wer zu früh eine Brünnhilde singt, kann sich tatsächlich seine Stimme ruinieren. Das wäre so, als ob man einen Marathon läuft, obwohl man gar nicht dafür trainiert ist. Ich werde das jedenfalls nicht machen.
Mit der Rolle der Elisabeth habe ich mich schon ganz früh beschäftigt. Ihre Arie «Dich, teure Halle, grüss’ ich wieder» war die erste, die ich von Wagner während meines Studiums studiert habe. Meine Gesangslehrerin gab sie mir sozusagen als Türöffner in die Wagnerwelt, und ich konnte musikalisch gleich etwas damit anfangen. Was ich besonders finde am Charakter dieser Rolle, ist die Entschiedenheit in ihrer Liebe zu Tannhäuser. Elisabeth ist jung und aufrichtig, wahrscheinlich ist Tannhäuser sogar ihre erste Liebe überhaupt, sie will keinen anderen. Es mag uns heute ein bisschen alt modisch vorkommen, dass eine Frau ihr Leben so rückhaltlos einem Mann widmet. Wir leben in wechselnden Beziehungen, trennen uns und verlieben uns neu. Aber in dem Augenblick, in dem man einen Partner wirklich liebt, will man auch heute noch für immer mit ihm zusammen sein, und ist bereit, das Äusserste dafür zu tun – wie Elisabeth. Moderne Frauen könnten über sie sagen: Wie kann man nur so naiv sein. Ich aber glaube, dass alle Liebenden diese Ausschliesslichkeit schon einmal erlebt haben, die Elisabeths Charakter in Tannhäuser offenbart.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 66, Februar 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Tannhäuser
Synopsis
Tannhäuser
Erster Aufzug
Im Venusberg wird ein grosses Bacchanale gefeiert. Der Sänger Tannhäuser, dorthin entflohen vor der Enge der Wartburg und ihrer in erstarrten Konventionen gefangenen Gesellschaft um den Landgrafen Hermann, gibt sich ganz dem Rausch der sinnlichen Liebe hin. Doch bald schon sehnt er sich nach der realen Welt, nach den wechselhaften Gefühlen und dem Leben eines Sterblichen zurück. Venus, die ihm Treulosigkeit vorwirft, versucht vergeblich, sein verwirrtes Gemüt zu beruhigen; Tannhäuser ruft die Jungfrau Maria an und bannt damit den Zauber der Venus.
Ein Hirt besingt den Frühling; seine Weise wird vom Gesang vorüberziehender Pilger auf ihrem Bussgang nach Rom übertönt. Tannhäuser ist ergriffen. Landgraf Hermann und sein Gefolge treffen auf ihn. Misstrauisch nähern sie sich ihm, schieden sie doch im Streit voneinander. Wolfram aber erkennt den desolaten Zustand des einstigen Freundes und fordert ihn auf, in den Kreis der Sänger zurückzukehren. Obwohl auch die anderen in die Bitte einstimmen, widersetzt sich Tannhäuser. Erst als Wolfram ihn an Elisabeth, die Nichte des Landgrafen, erinnert, und ihm – obwohl selbst Elisabeth in Liebe zugetan – freimütig schildert, wie sehr diese unter seiner Abwesenheit leidet, besinnt sich Tannhäuser der Vergangenheit und drängt nun selbst auf Rückkehr in die Wartburg.
Zweiter Aufzug
Elisabeth und Tannhäuser stehen sich nach langer Zeit erstmals wieder gegenüber. Elisabeth offenbart Tannhäuser ihre tiefsten Gefühle: Seine Lieder haben in ihr eine nie gekannte Sehnsucht geweckt. Im gegenseitigen Eingeständnis ihrer Liebe vergessen Elisabeth und Tannhäuser die Welt um sich her.
Wissend um die Gefühle seiner Nichte zu Tannhäuser, hat Landgraf Hermann zu einem besonderen Sängerwettstreit eingeladen, als dessen Preis er Elisabeths Hand in Aussicht stellt. Als Thema stellt er den Sängern die Aufgabe, das Wesen der Liebe zu ergründen. Wolfram eröffnet den Wettstreit mit einem Preislied, das die Liebe als rein geistigen Wert verherrlicht. Durch solche, jegliche Sinnlichkeit verneinende Anschauung herausgefordert, setzt Tannhäuser unter Missachtung des zeremoniellen Ablaufs diesem lebensfernen Ideal sein provozierendes Lied einer die Sinnlichkeit mit einbeziehenden Liebe entgegen. Walther von der Vogelweide beruhigt die in Unruhe versetzten Zuhörer, doch erntet auch seine Verteidigung der hohen Minne von Tannhäuser nur Spott. Als zuletzt Biterolf Tannhäuser in die Schranken von Moral und Sitte zu weisen versucht, fühlt dieser sich provoziert und preist die sinnlichen Wonnen der Venus, mehr noch – er gesteht, in ihrem Reich verweilt zu haben. Die Männer stürzen sich auf Tannhäuser, um ihn zu töten. Da stellt sich Elisabeth, obwohl durch Tannhäusers Ausbruch zutiefst verletzt, schützend vor ihn und bittet um Gnade: Nur Gott dürfe über ihn richten.
Der Landgraf spricht das Urteil: Tannhäuser wird aus der Gesellschaft ausgestossen. Es sei ihm jedoch gestattet, sich den eben nach Rom aufbrechenden Pilgern anzuschliessen, um vom Papst Verzeihung zu erbitten.
Dritter Aufzug
Elisabeths Leben ist bestimmt vom Warten auf die Rückkehr Tannhäusers. Wolfram beobachtet sie sorgenvoll.
Die Pilger, die vom Papst Verzeihung erlangt haben, kehren aus Rom zurück. Tannhäuser ist nicht unter ihnen. Elisabeth bittet die Jungfrau Maria, für ihn sühnen zu dürfen, und entsagt dem Leben. Ohnmächtig, sie von ihrem Vorhaben abbringen zu können, bleibt Wolfram zurück. Trost findet er einzig in seinem Gesang.
Da naht ein weiterer Pilger: Es ist Tannhäuser. Auf Wolframs Bitten erzählt er von seinem harten Bussgang nach Rom und vom vernichtenden Urteil des Papstes, der erklärte, dass ihm nie Erlösung zuteil werden könne – ebenso wie der Stab in seiner Hand sich nie mehr mit frischem Grün schmücken würde. Nun will sich Tannhäuser erneut zu Venus flüchten. Vergeblich versichert Wolfram Tannhäuser, dass ein Engel für ihn gesühnt hätte. Erst als er den Namen nennt – Elisabeth –, löst Tannhäuser sich aus seinem Wahn und bricht tot zusammen. Über seiner Leiche feiert die Wartburggesellschaft das Wunder des grünenden Stabes.