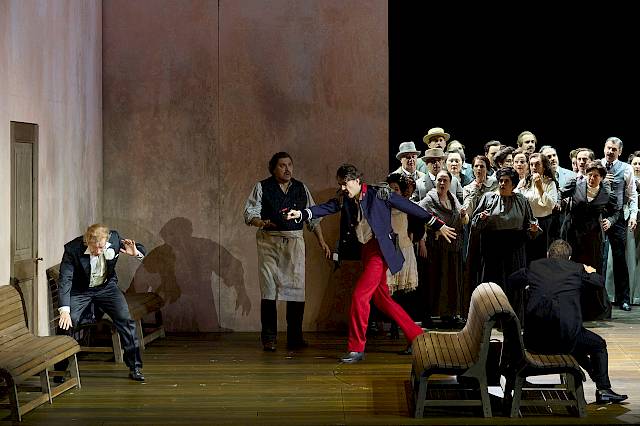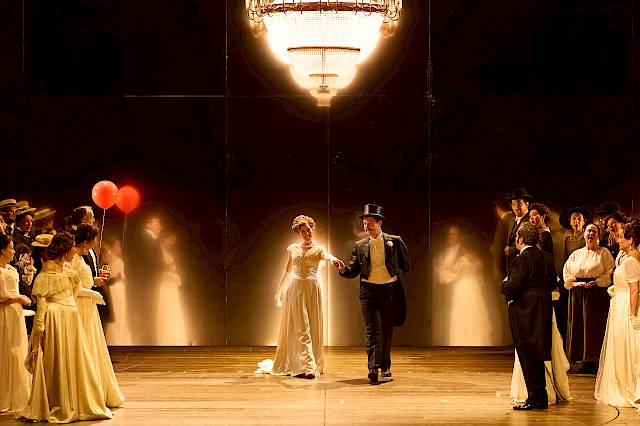Die Titelfigur in Jules Massenets Oper «Manon» geht einen konsequenten Weg: Zunächst ein unerfahrenes Mädchen aus der Provinz, landet sie in der Grossstadt Paris, wo sie schliesslich als Königin der Schönheit gefeiert wird. Doch was genau ist ihr Antrieb? Warum ist Manon von Geld, Glanz und Glamour fasziniert? Und was suchen die Männer in dieser Oper in ihr? Die Zürcher Psychoanalytikerin Jeannette Fischer erläutert im Gespräch mit Kathrin Brunner vor der Premiere 2019 die allumfassende Kraft des Begehrens.
Jeannette Fischer, wir treffen uns, weil wir über das Begehren reden wollen. In der Oper Manon von Jules Massenet wird vieles begehrt: Die Männer begehren Manon, Manon wiederum begehrt Luxus, Reichtum, Schönheit und Anerkennung. Welche Rolle spielt das Begehren grundsätzlich in unserem Leben?
Das Begehren ist der Hauptantrieb menschlichen Handelns! Es ist wie eine Urkraft, die uns vorwärts treibt. Beim Begehren geht es eigentlich immer um das Begehren nach Lust. Das heisst aber nicht, dass das Begehren ausschliesslich sexueller Art sein muss. Das Begehren ist in dem Sinne etwas Lustvolles, indem ich versuche, die eigene Unlust aufzuheben, um erneut Wohlbefinden und Lust am Leben zu erlangen. Diese Lebenskraft beginnt bereits mit dem allerersten Schrei. Das neugeborene Kind drückt damit aus, dass ihm etwas nicht passt. Es empfindet Unlust und will sagen: Unternehmt etwas! Ich will, dass es anders wird, damit ich wieder Lust empfinde, damit ich zufrieden und ruhig bin. Dieser erste Schrei ist keineswegs ein Schrei der Unbeholfenheit. Das Begehren ist also da, um die Unlust, die uns diese Welt permanent verursacht, in Lust zu verwandeln. Dabei geht es auch um ganz banale Bedürfnisse wie «Mir ist kalt», «Ich habe Hunger» oder «Es regnet». Ich bin dann dazu aufgefordert, eine Ich-Leistung zu vollbringen und Eigenverantwortung zu übernehmen, indem ich die unlustvolle Situation aktiv in eine lustvolle verwandle: Wenn es regnet, ziehe ich mir eine Jacke an. Das gilt genauso für grössere Zusammenhänge. Wenn ich nicht damit einverstanden bin, was mir mein Chef sagt, werde ich ihm deutlich machen, dass mir etwas nicht passt. Man lernt in der Eigenverantwortung, die Unlust in Lust zu verwandeln, und dazu hat man grundsätzlich auch die Berechtigung.
Das Begehren ist demnach etwas durchaus Positives.
Absolut! Begehren ist Bewegung: Man bewegt sich, es wird bewegt, man macht neue Erfahrungen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Begehren nach der sogenannten Differenz. Hier geht es auch um ein sexuelles Begehren. Man darf das jedoch nicht rein «genital» verstehen, sondern auch im Sinne einer Neugierde, die erotisch und sinnlich sein kann. In der Psychoanalyse sagen wir: Wir begehren die Differenz. Wir begehren jemanden, weil er anders ist als ich. Das ist grundsätzlich etwas Schönes und Unproblematisches. Schwierig wird es erst, wenn Neid und Missgunst ins Spiel kommen und das Ganze in einen Machtdiskurs mündet. Die Streitereien fangen an, wenn der andere etwas hat, was ich auch will, oder wenn ich will, dass der andere etwas nicht mehr hat. Dann entstehen Wettbewerb, Kampf und Zerstörung.
Davor warnt uns ja das zehnte Gebot: «Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat» …
Ja. Aber wer sagt denn eigentlich: «Du sollst nicht»? Wer nimmt hier für sich ein, zu bestimmen, was richtig und was falsch ist? Was spricht dagegen, den einen und die andere auch noch zu begehren? Absolut nichts! Das tut niemandem weh, ausser, wenn man etwas zu verlieren hat: gesellschaftliche Konventionen wie die eigene Ehre, Macht, das Ansehen, die Männlichkeit … das, was in einer Oper dann das Drama ausmacht.
Von Freud stammt der berühmte Satz: «Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren, können sie nicht lieben.» Manons Situation ist für dieses Dilemma exemplarisch: Nachdem sie in der Provinz den Studenten Des Grieux kennengelernt hat und mit ihm nach Paris durchgebrannt ist, wendet sie sich schon bald dem reichen Steuerpächter Brétigny zu. Sie verlässt Des Grieux, der Manon aufrichtig liebt. Warum tut sie das? Ist sie nicht fähig, zu lieben?
Manon hat möglicherweise erkannt, dass diese Amour fou gar nicht das Höchste der Gefühle ist und irgendwann einmal enden wird. In einer Beziehung bewegt man sich anfangs, im Verliebtsein, ja immer in einer Art Projektion, in einem kleinen Wahn, indem man sich und den Partner idealisiert. Nach einer gewissen Zeit fällt diese Projektion der totalen Liebe jedoch zusammen, da sie zwangsläufig an der Realität scheitern muss. Manon und Des Grieux haben kein Geld, sie leben in armseligen Verhältnissen. Nun würde es darum gehen, eine Form der Beziehung mit und in dieser Realität zu finden. Doch Manon ist offenbar nicht dazu bereit, sondern sucht nach etwas Neuem, nach einem neuen Projektionsfeld. Sie glaubt, dass ihr das die erhoffte Erfüllung bringen wird: Glamour, Geld, Luxus.
Kann denn ein Begehren je erfüllt werden? Kann Begehren zur Zufriedenheit führen?
Bedürfnisse können punktuell und zeitlich befriedigt werden. Das Begehren jedoch kann a priori nicht erfüllt werden, denn sonst gäbe es kein Begehren mehr und wir wären gleichsam tot. Im Roman, im Film oder der Oper wird natürlich immer mit der Idee gespielt, dass ein Begehren auch zur Erfüllung führt. Doch kaum ist dieser Punkt erreicht, endet der Film meistens. In unserer Fantasie spielen wir immer mit der Erfüllbarkeit unseres Begehrens. Dem liegt letztlich etwas sehr Aggressives zugrunde: Wie gesagt, ist das Begehren immer das Begehren nach der Differenz. Wird die Differenz aufgelöst, bin ich oder der andere vernichtet. Man glaubt, komplett zu sein, wenn man sich den anderen einverleibt. Das kann aber nicht stattfinden, weil sich der andere nicht vereinnahmen lässt. Selbstverständlich kann ich jemanden vereinnahmen, aber dann gibt es ihn nicht mehr als eigenständiges Subjekt, sondern nur noch als einen Teil von mir. Damit kann ich mich gross machen, und der andere ist mein Objekt. Kürzlich bin ich auf ein Zitat von Dalí gestossen, in dem er sagt, dass seine Frau Gala das Grösste und Beste sei, sein Motor, seine Liebe. Dann macht er einen Bindestrich und schreibt – er schreibt «ich» gross: – «Ich». Gala war für ihn also kein eigenständiges Subjekt mehr, das different ist, sondern ein Teil von ihm, das ihm zur Vergrösserung und Komplettierung diente. Hier findet kein Begehren mehr statt, da man jemanden inkludiert hat und die Differenz nicht mehr begehren muss. Im Grunde ist das die Personifikation eines Narzissten. Man muss niemanden mehr begehren. Das ist zwar fürchterlich langweilig, aber man kann sich in dieser Grösse einbetten und von diesem Punkt aus der Welt begegnen.
Manons Begehren zielt in dieser Oper primär auf Geld und Luxusobjekte. Wie interpretieren Sie das?
Es geht hier um das Begehren nach Macht. Um das zu verdeutlichen, möchte ich den umstrittenen Begriff des «Penisneids» von Freud ins Spiel bringen. Freud hat behauptet, dass die Frau neidisch auf den Penis sei. Nun, das stimmt. Sie ist aber nicht neidisch auf den Penis als Organ und will auch gar nie ein Mann sein, sondern sie ist neidisch auf die Attribute, die mit diesem Phallus in Zusammenhang gebracht werden: der Fels in der Brandung zu sein, die Dinge und Emotionen im Griff zu haben, keine Schwäche, Angst oder Schuldgefühle zu haben – mächtig zu sein. Im Kontrast dazu steht die Frau, die alles andere verkörpert: Angst, Schuldgefühle, Anpassungsfähigkeit, Abhängigkeit und so weiter. Noch heute, im Jahr 2019, sind Machtattribute sexy. Und ich kann mich noch gut an eine Umfrage in den 1980er-Jahren erinnern, als 67 Prozent der Frauen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl als hoch attraktiv einstuften … Die Frau kann sich diese Machtattribute über die Verführung gewissermassen aneignen. Manons Begehren ist nicht das Begehren nach der Differenz, sondern nach der Projektion von Macht. Das betrifft Männer wie Brétigny in Manon genauso: Sie begehren Manon, weil sie so schön ist, und glauben, sie als Person zu begehren. In Tat und Wahrheit meinen sie aber nicht Manon als Person, sondern sie meinen Manon in ihrer Schönheit zur Vervollkommnung ihrer selbst.
Manon kehrt ausgerechnet in dem Moment zu Des Grieux zurück, als sie erfährt, dass sich Des Grieux entschieden hat, in den Priesterstand zu treten. Warum ist Des Grieux in dieser Situation für Manon erneut interessant?
Ich denke, dass sie es nicht ertragen kann, nicht mehr begehrenswert zu sein und dass man sich von ihr abwendet. Es gibt nun jemanden, der ein anderes Leben hat und anderes begehrt als sie. Das verträgt sich nicht mit ihren Grössenansprüchen. Grundsätzlich ist es ja schön, begehrt zu werden. Diese Kraft zu empfangen oder damit zu spielen, ist auch gar kein Problem. Gefährlich wird es erst, wenn man sich gänzlich damit identifiziert und glaubt, dass einen die ganze Männerwelt zu begehren habe.
Was bezweckt denn Des Grieux, wenn er sich für einen Weg als Priester entscheidet? Schwört er dem Begehren tatsächlich ab?
Wenn er sich in ein Kloster zurückzieht, ist das natürlich der beste Platz, um das Begehren aufrecht zu erhalten. Das Begehren bleibt immer in der Fantasie, denn es gibt nie ein reales Gegenüber. In der Fantasie kann Des Grieux alles machen, sich alles vorstellen. Zwar entsagt er mit der Priesterlaufbahn dem Sex, hat aber natürlich das Kopfkino. Hier kann er sich voll entfalten, weil das Gegenüber nicht als eigenständiges Subjekt mit eigenen Ansprüchen real anwesend ist und möglicherweise sagt: Heute will ich nicht, heute werde ich ins Kino gehen … In seiner Fantasie kann Des Grieux die Differenz aufheben, und ein Leben im Kloster kann ihm das erfüllen. Diese Projektionen laufen in solchen Fantasien wie wild, aber es sind immer Projektionen, die das Gegenüber idealisieren. Sie fallen immer irgendwann zusammen, es sei denn, man ist, wie im Kloster, von der Realität des anderen Menschen abgeschnitten.
Manon und Des Grieux kommen später tatsächlich wieder zusammen. Doch dann fängt die Misere an: Manon scheint vollends von der Gier, ja Sucht nach Geld beherrscht zu sein. Im «Begehren» steckt etymologisch gesehen tatsächlich das Wort «Gier». Wie spielen Begehren, Gier und Sucht ineinander?
Das Begehren an sich ist nicht destruktiv und auch nicht selbstdestruktiv. Wenn das Begehren hingegen in eine Gier kippt, geht es nicht mehr darum, die Differenz im anderen zu sehen oder mit dieser Differenz einen Umgang zu finden, sondern es geht um den Versuch, sich etwas anzueignen, das einen beruhigt, das einen sättigt. Das ist aber aussichtslos, da man nie vollständig gesättigt sein kann. Diesen Wunsch nennen wir in der Psychoanalyse regressiv. Es ist der Wunsch nach einem embryonalen Zustand. Im Mutterleib kann man gesättigt sein, denn da gibt es immer genügend Nahrung, und man hat meist Ruhe. Es ist ein Wunsch nach einem Zustand, in welchem man keine Eigenverantwortung übernehmen muss.
In der Differenz hingegen muss ich Arbeit leisten …
Ja, ich muss mich darum kümmern, wie ich zu meinem nächsten Essen, zu meiner nächsten Liebschaft komme. Von einem Suchtverhalten spricht man dann, wenn ich davon ausgehe, dass es etwas gibt, das mich für immer und ewig zufriedenstellt und ich nichts mehr dafür tun muss. Es ist in diesem Falle die Verweigerung, Eigenverantwortung zu übernehmen, eine Verweigerung, sich als einen banalen Teil dieser Welt zu sehen. Damit ist es selbstzerstörerisch. In diesem Zustand geht dann auch der Genuss verloren. Übernimmt man hingegen Eigenverantwortung, kann man durchaus Genuss erlangen: Indem man mit der Differenz spielt, den anderen zu verführen versucht, indem man herausfindet, wie weit man den anderen in sein Begehren einbinden kann. Auf diese Art ist dieses Spiel lustvoll und für keine Partei destruktiv.
Ein berühmter Satz der amerikanischen Konzeptkünstlerin Jenny Holzer lautet: «Protect me from what I want.» Wie würden Sie diesen Satz interpretieren?
Ich habe ein Pyjama-Oberteil, auf dem dieser Satz steht, und ich finde ihn wirklich lustig! Ich weiss nicht, wie Jenny Holzer ihn gemeint hat, aber ich glaube, dass damit einerseits zum Ausdruck kommt, wie machtvoll das weibliche Begehren sein kann – das lyrische Ich ist hier ja Jenny Holzer. Andererseits impliziert der Satz, dass man sich vor seinen eigenen Wünschen schützen soll, weil man die gesellschaftlichen Widerstände dagegen kennt. Lebt eine Frau ihre Wünsche aus, verlässt sie automatisch die weibliche Rolle und wird möglicherweise in eine pathologische Ecke gestellt, gilt vielleicht als nymphomanisch, als überdreht …
Also ist ein Wunsch nichts, was man sich grundsätzlich selbst verbieten müsste.
Richtig. Wir Psychoanalytiker gehen ja davon aus, dass der Wunsch Teil des Begehrens ist. Der Wunsch ist immer eine Kraft. Wenn nun der Wunsch als Wunsch nicht anerkannt wird, stellt das in unseren Augen die sogenannte Kastration dar. Hier gilt es zwischen Kastration und Frustration zu unterscheiden. Wenn sich zum Beispiel ein Kind ein Eis wünscht, ist dieser Wunsch nach einem Eis zunächst einmal eine grosse Kraft. Wenn wir dem Kind sagen: «So ein blöder Wunsch!», brechen wir den Wunsch. Das ist eine Kastration. Erklären wir dem Kind hingegen, dass es heute kein Eis gibt, weil es bereits Schokolade bekommen hat, und stellen ihm für übermorgen ein Eis in Aussicht, ist das nicht problematisch. In diesem Falle darf der Wunsch weiterbestehen, und die Frustration ist ganz einfach die Begegnung mit der Realität. Frustration ist für den Menschen also kein Problem, die Kastration hingegen schon. Da wir in einer Gesellschaft leben, die streng hierarchisch organisiert ist, muss man diese Wünsche immer auch innerhalb eines Herrschaftsdiskurses betrachten, denn Wünsche sind naturgemäss subversiv und halten sich nicht an Konventionen. Sie haben eine solche Kraft, dass man sie in den bestehenden Machtdiskurs irgendwie integrieren muss, damit man den Wunsch unter Kontrolle bringen kann, will man die bestehenden Herrschaftsstrukturen nicht gefährden. Oft gibt es nur einen engen Kanal, der kontrollierbar ist. Die Leute glauben, dass man mit Gewalt und totaler Anarchie rechnen müsste, würde man den Wünschen freien Lauf lassen. Das ist aber völliger Unsinn. Ganz im Gegenteil: Da durch die Domestizierung und Repression von Wünschen das kreative Potenzial eingeschränkt wird, wird viel mehr kaputt gemacht.
Könnte man abschliessend sagen, dass es Manon über lange Zeit eigentlich gar nicht so schlecht macht? Sie nimmt sich, worauf sie Lust hat, lebt ihre Wünsche und Begierden innerhalb der vorherrschenden gesellschaftlichen Möglichkeiten frei aus. Ihr Weg ist über längere Zeit doch eigentlich ganz bewundernswürdig.
Durchaus. Sie versucht, sich innerhalb dieses gesellschaftlichen Diskurses zu bewegen und mitzuspielen, ihre Dinge zu erreichen. Und da ist sie scheinbar erfolgreich.
Bis sie ihren alten Liebhaber Des Grieux wieder zurückhaben will, der sich von ihr losgesagt hat.
Oft braucht es nur eine kleine Stelle, die das Ganze ins Rollen bringt: Er, der sie nicht mehr will, oder es könnte auch sein, dass sie älter wird und Runzeln bekommt … Aber in der Oper wird man ja eigentlich nie alt!
Das Gespräch führte Kathrin Brunner.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 67, März 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.