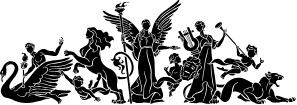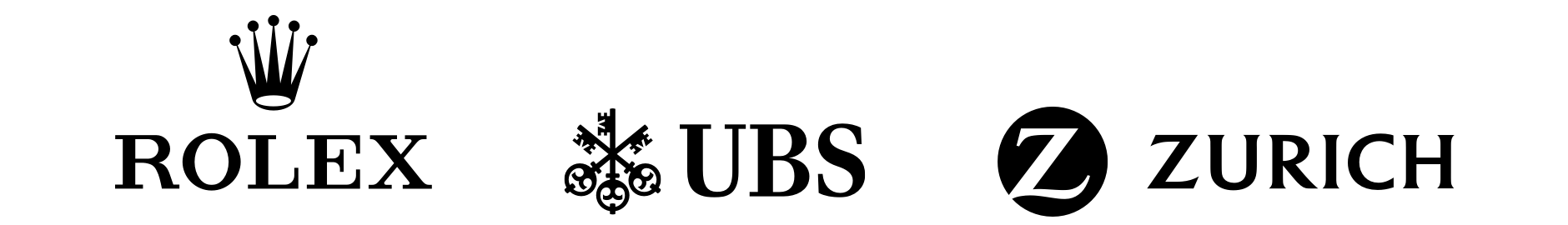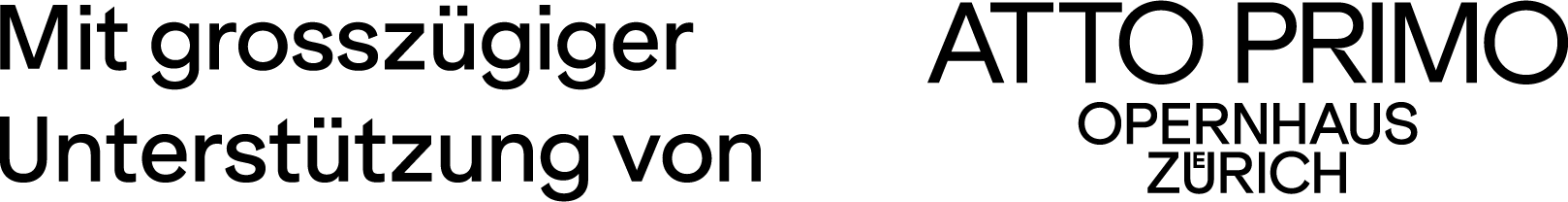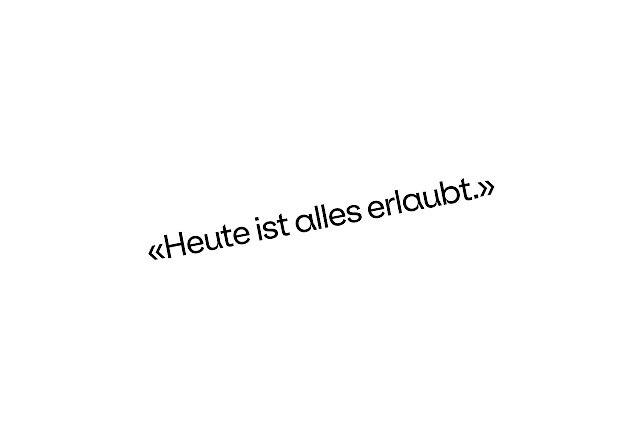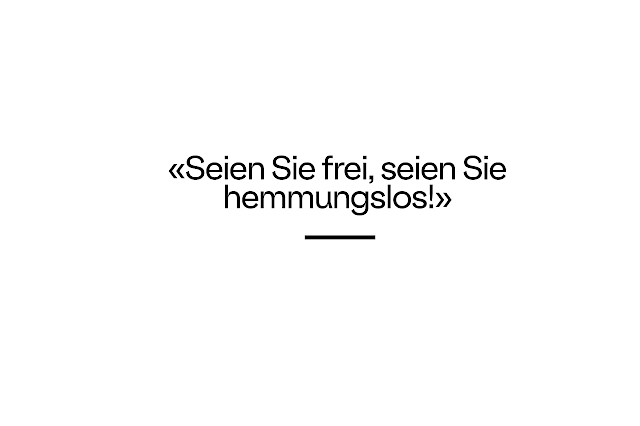Die Sopranistin Golda Schultz widersetzt sich als Interpretin einem System, das die Arbeit von Frauen, Schwarzen und People of Color über Jahrhunderte unsichtbar gemacht hat. Stattdessen eignet sie sich Geschichten an und schafft Gegenerzählungen. In Zürich gibt sie in der Neuproduktion von «Die Fledermaus» ihr Rollendebüt als Rosalinde. Ein Porträt von Hannah Schmidt.
Eigentlich wollte Golda Schultz Journalistin werden. Ein perfekter Beruf für eine neugierige Person wie sie, die gerne liest, die sich recherchierend in Themen und Biografien einarbeitet, die das Reisen liebt, Menschen und die Interaktion mit ihnen. «Journalismus war eine einfache Entscheidung», sagt sie im Gespräch, «ich versuche immer, meiner Neugier zu folgen.» Bis kurz vors Diplom hat sie damals ihr Studium an der Rhodes University in der Stadt Makhanda in der südafrikanischen Provinz Ostkap gebracht, als die Zweifel kommen: «Es war das letzte Jahr vor meinem Diplom, und ich habe mich in meinem WG-Zimmer umgeschaut», erzählt die Sopranistin. «Da waren so viele Bücher über Sängerinnen und Oper, über die Idee und Philosophie von Musiktheater, über Dirigenten und Komponisten – so viele Informationen darüber und gar keine Zeitungen, kein Magazin, nichts Journalistisches. Ausser natürlich das, was ich für das nächste Seminar lesen musste.» Ihr ist schlagartig klar: «Du hast entweder gar keine Lust darauf oder dich interessiert eigentlich etwas anderes.»
Einen eigentlich fest eingeschlagenen Weg zu verlassen, erfordert Mut. Heute bezeichnet sie die Entscheidung, statt Journalistin Opernsängerin zu werden, als «zufällig» – als habe es sie halb gezogen, als sei sie halb hingesunken: Als Golda Schultz ihre Sachen packt, um aus dem WG-Zimmer auszuziehen, ahnt sie noch nicht, wie diese Entscheidung ihr gesamtes Leben umkrempeln wird. Erst zieht sie aus der Provinz Richtung Grossstadt – Kapstadt –, dann raus in die Welt: an die Juilliard School in New York, an die Bayerische Staatsoper, zu den Salzburger Festspielen, an die Mailänder Scala, zurück an die Metropolitan Opera. Sie hat sich schnell einen Namen gemacht, aber nicht nur durch ihre makellose Technik, ihre ästhetische Wandlungsfähigkeit, ihre atemberaubende Stimme – Golda Schultz steht herausragend für ihren reflexiven interpre tatorischen Umgang mit den Rollen, die sie verkörpert.
«Die Interpretation ist nie nur eine musikalische, sondern immer auch eine menschliche», sagt sie im Gespräch. «Es geht am Ende in meiner Arbeit darum, Lebenserfahrungen von Frauen anzuschauen. Das eine ist der Text. Das andere ist das, was dahinter steht: Warum machst du, was du machst, Adina, Clara, Dido? Warum sagst du, was du sagst, Pamina, Anna, Almaviva?» Dass diese Geschichten von weissen Männern geschrieben wurden, die damit ihr Verständnis von der Welt und ihrer patriarchalen und rassistischen Ordnung reproduziert haben, «können wir nicht ändern», sagt Schultz: «Aber wie wir damit weiterhin umgehen, das können wir beeinflussen. Wie schaffe ich es zum Beispiel, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, meinen Widerstand in meine Interpretation zu mischen, um etwas Interessantes dabei herauszukitzeln? Wie spiele und singe ich meine eigenen Ideen von einer Rolle?»
Problematische Frauenrollen gibt es in der Oper zuhauf. «Carmen, Vi olet ta, Pamina, Aida und die an deren zeigen vor allem, dass Frauen selten in ihrer Komplexität, ihrer Unabhängigkeit, ihrem Können, also selten jenseits von Geschlechterstereotypen dargestellt werden», schreibt die Journalistin und Musikwissenschaftlerin Aliette de Laleu. Dazu werden sie von den Komponisten ermordet: «In der Oper sterben die Frauen. Ihnen wird Gewalt angetan, sie werden ange griffen, geschändet, in den Selbstmord getrieben, umgebracht.» Sie entsprechen «einem übermäch tigen und gewalttätigen männlichen Blick». Doch, schreibt de Laleu: «Manchmal kann ein subtiles Detail in einer Inszenierung alles verändern.»
Exemplarisch dafür steht vielleicht Schultz’ Debütalbum «This be her verse» – «Das hier sei ihr Vers» –, das sie im Frühjahr 2022 veröffentlicht hat, genau wie die Konzertprogramme, mit denen sie tourt. Die Sopranistin Golda Schultz widersetzt sich als Interpretin einem System, das die Arbeit von Frauen, Schwarzen und People of Color über Jahrhunderte unsichtbar gemacht hat. Stattdessen eignet sie sich Geschichten an und schafft Gegenerzählungen: In Clara Schumanns Ver tonung der Heine’schen «Loreley» etwa erschafft Golda Schultz in ihrem Album eine Protagonistin, die eben nicht böse und verführerisch Männer in den Abgrund zieht, sondern im Gegenteil eine Frau, die ganz bei sich ist, die sich in aller Ruhe die Haare kämmt und gedankenverloren vor sich hin singt. Dass der Mann im Boot von den Wellen «verschlungen» wird, ist in der Folge einzig und allein seine Schuld: Er denkt, die Frau auf dem Felsen existiere für ihn und seinen Blick, geifert sie «mit wildem Weh» an. Der anklagende Schluss: «Das hat mit ihrem Singen / die Lore-Ley getan», klingt in Schultz’ Version auch eher nach den letzten Worten des Untergehenden, der in gewohnter Manier einer Frau die Schuld für sein eigenes Versagen gibt. Hier wird klar: Schultz’ Loreley bekommt von all dem noch nicht einmal etwas mit.
Wenn man so will, ist Golda Schultz’ Ansatz ein journalistischer: Sie geht kritisch an die Texte heran, schaut auf die Probleme und all die komplizierten Implikationen, sie analysiert die Musik, sie stellt Fragen – und verbindet ihre Erkenntnisse mit den Tönen und Worten, die sie singt. «Meine Lieb lings frage als Kind war immer ‹warum?› – und das bleibt auch meine Lieblingsfrage als Frau», sagt sie. «Wenn jemand sagt, etwas sei Tradition, frage ich: Warum? Warum ist Tradition wichtiger als im Moment zu sein, warum ist Tradition wichtiger als Weitergehen? Wenn jemand es mir gut erklärt, mache ich das gern.»
Dabei endet die Analyse für sie allerdings nicht bei der Feststellung, dass viele der von Männern geschaffenen Frauenfiguren problematische Stereo type verkörpern: «Wie wäre es, wenn wir die Frage anders stellen? Sind die Männer in den Geschichten nicht genauso problematisch?» Bizet, Verdi, Strauss, sie alle haben für Schultz Archetypen von Männern geschrieben, die «scary» sind. «Viele Komponisten haben komplett gruselige Welten für Frauen erschaffen.» Sie wechselt vom Deutschen ins Englische, wenn sie diesen Gedanken formuliert: «Bei den Männerfiguren führen wir diesen Diskurs darum nicht.» Man müsse die Werke in diesem Aspekt beim Wort nehmen: «Wenn man das einfach so spielen würde, also die Männerfiguren so scary zeigen würde, wie sie geschrie ben sind, würden wir auf ein ganz anderes Niveau im kritischen Gespräch darüber kommen.»
In Zürich singt sie jetzt die Rolle der Rosalinde aus Johann Strauss’ Operette «Die Fledermaus»: «Ich finde, sie ist sehr klug, sehr lustig, aber auch ein bisschen rachsüchtig», sagt Golda Schultz. «Aber genau im richtigen Mass, nicht zu stark, nicht zu wenig. Das gibt der Figur eine schöne Würze, was ich toll finde.» Die Rolle studierte sie in den vergangenen Monaten mit grosser Konzentration – für die Mozart-Sängerin Schultz ist die Rosalinde nämlich ein Debüt: «Ich musste mir die Rolle sehr langsam und Schritt für Schritt erarbeiten», erzählt sie. «Es war fast wie damals im Konservatorium: Ich habe meine Stimme in dieser Rolle ganz neu kennengelernt. Wie funktioniert meine Stimme in Strauss’ musikalischer Welt? Was schafft sie, was schafft sie nicht? Wo sind die grossen Herausforderungen, wo muss ich mich ranhalten, wo kann ich lockerlassen? Und nach und nach kommt die Leichtigkeit.» Allein: Den «Wiener-Walzer-Schmalz» in den Körper zu kriegen, sei eine Herausforderung gewesen, wie sie lachend erzählt: «Das war mir sehr wichtig, aber ob ich das erreicht habe, weiss ich noch nicht.»
In ihrer Erarbeitung der Rosalinde, sagt Golda Schultz, habe sie besonders das Verhältnis von Identität und Maskerade interessiert: «Es gibt diese Szene, in der Rosalinde bei einem Csardas beim Orlofsky-Fest, ver kleidet, ihr Temperament feiert», sagt Schultz. «Da hat sie die Chance, jemand anders zu sein. Aber ist sie wirklich die Frau hinter der Maske? Wer sind wir hinter unseren Masken – wir tragen sie ja tagtäglich –, und helfen uns Masken nicht auch dabei, wirklich ehrlich zu sein?»
Ihr Job, sagt Golda Schultz, sei nicht, einfach nur schön zu singen, sondern das Publikum zum Denken und Reflektieren anzuregen, ihm im wahrsten Wortsinn etwas Interessantes zu zeigen, ihre eigene Geschichte und Lebensrealität in die Interpretation einzubringen: «Sonst sind wir alle Gesangsmaschinen, dann braucht es keine echten Menschen auf der Bühne», sagt sie. «Aber diese Kunst existiert mit echten Leuten auf der Bühne, weil wir unterschiedlich sind, weil wir diverse Realitäten und Perspektiven mitbringen. Wir kommen aus der ganzen Welt, aus Russland, Amerika, Malta, Südafrika, Nigeria, Portugal, Spanien, wir sind alle Teil dieser Gegenwart und Geschichte. Wie schaffen wir es, miteinander umzu gehen, ohne zu explodieren, mit unseren unterschiedlichen Meinungen und Blickwinkeln?» So betrachtet, wird die Opernbühne auf einmal zum politisch utopischen Ort. Zu einem Raum, in dem alle ohne Angst verschieden sein können. Zu einem Bollwerk gegen die Polarisierung, auf deren Rücken autoritäre Kräfte momentan stärker und stärker werden. Gegen spaltende Projektionen hilft ein empathischer und offener Blick, schreibt die Journalistin Gilda Sahebi – und benennt damit das, was Golda Schultz in ihrer Arbeit verkörpert: «Mir geht es nicht darum, einen Kommentar abzuliefern, ich bin keine Politikerin», sagt sie im Gespräch. «Mein Job ist es, Fragen zu stellen, wie eine Archäologin zu kratzen, zu kratzen und weiter zu kratzen. Ich stelle eine Frage, und die Welt antwortet mir.»
Hannah Schmidt ist freiberufliche Musikjournalistin. Sie schreibt unter anderem für DIE ZEIT, das VAN-Magazin, WDR3, SWR2, Die Deutsche Bühne und Deutschlandfunk.