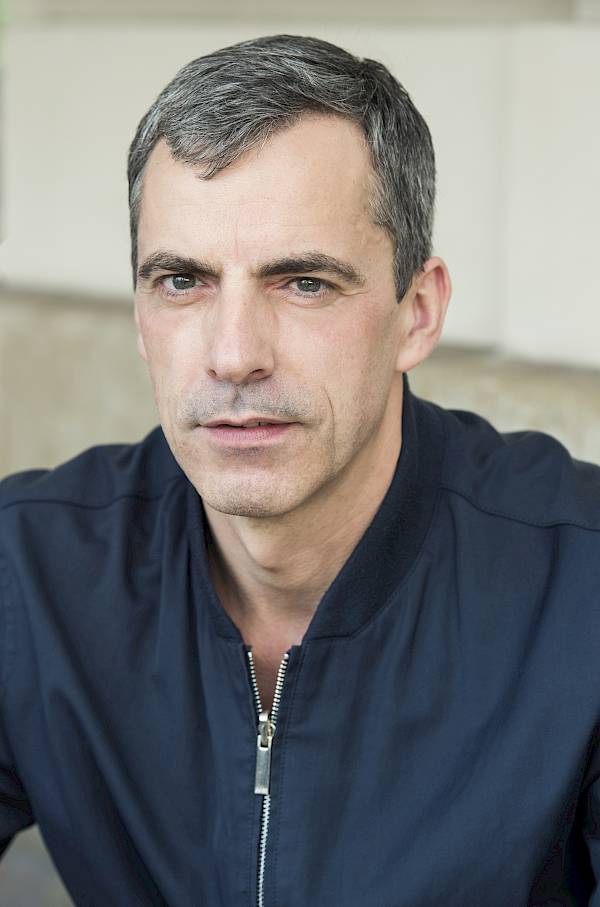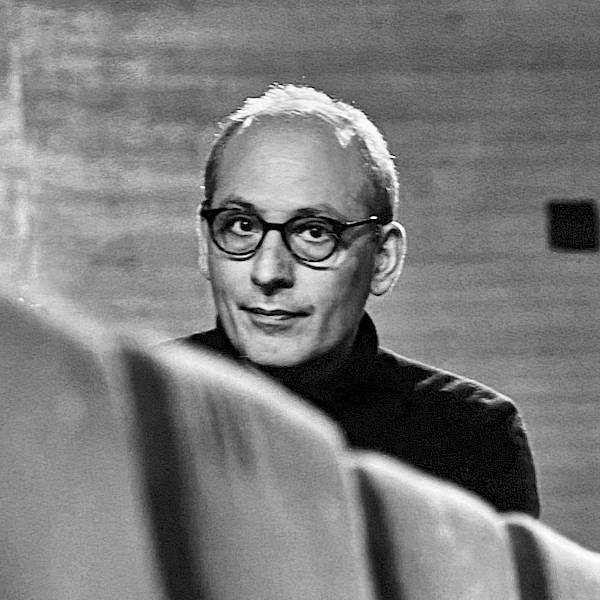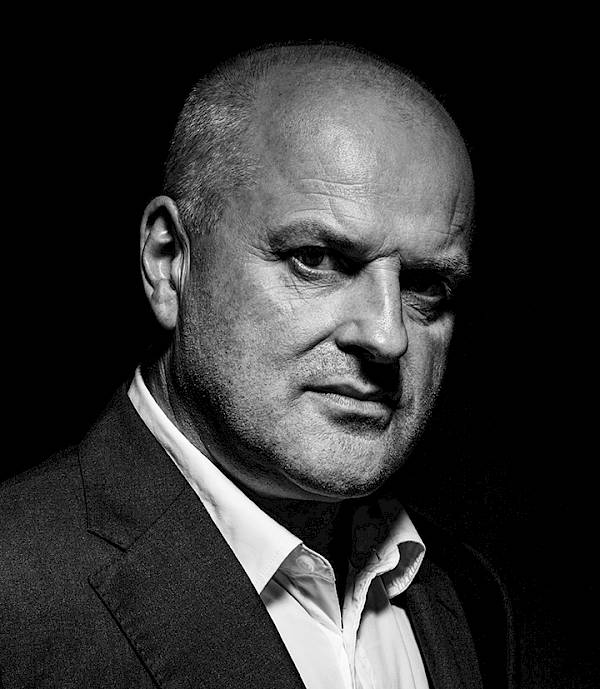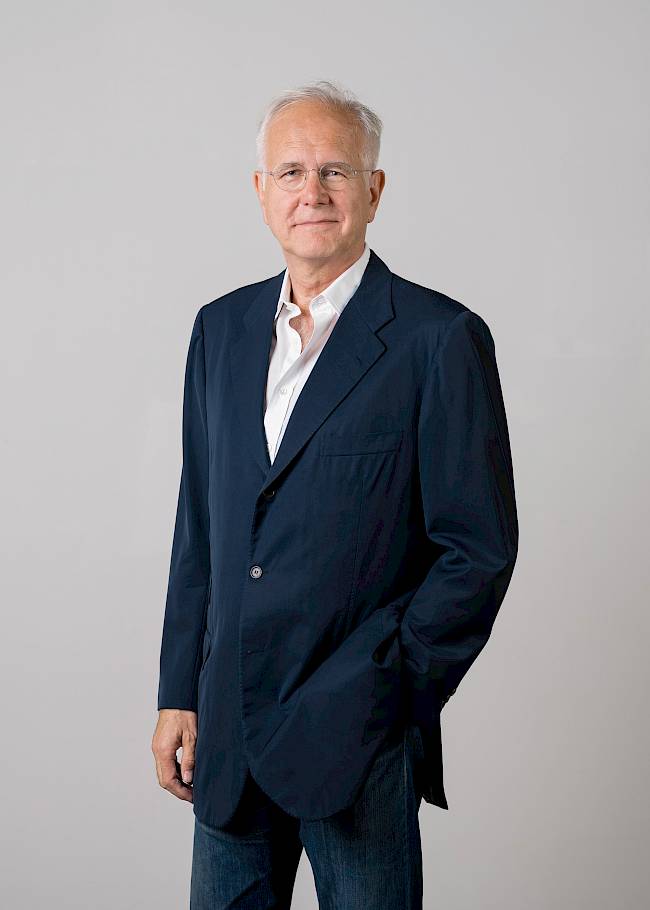Vorgeschichte
Wotan hat der Welt eine auf Verträgen basierende Ordnung gegeben und sich so zu ihrem obersten Herrscher gemacht. Von den Riesen Fasolt und Fafner liess er sich eine prachtvolle Burg bauen, die er mit einem dem Nibelungen Alberich entwendeten Goldschatz bezahlte. Aber er stahl Alberich nicht nur den Schatz, sondern auch den aus dem Rheingold geschmiedeten Ring, der seinem Besitzer masslose Macht verleiht. Der Preis für diese Macht war hoch: der ewige Verzicht auf Liebe. Auch Wotans Raub hatte bedeutsame Folgen, denn Alberich verfluchte den Ring: Er soll jedem seiner künftigen Träger den Tod bringen. Von der Urmutter Erda vor diesem Fluch gewarnt, war Wotan bereit, den Ring den Riesen zu überlassen. Im Streit um das verhängnisvolle Kleinod erschlug Fafner seinen Bruder Fasolt – das erste Opfer des Fluchs.
Aber Wotan konnte sich mit dem Verlust des Ringes nicht einfach abfinden, denn nach wie vor lauerte Alberich darauf, ihn zurückzugewinnen. Wotan selbst konnte ihn sich nicht aneignen, ohne als oberster Hüter der Gesetze gegen seine eigene Weltordnung zu verstossen. Also zeugte er ein menschliches Zwillingspaar, Sieglinde und Siegmund, die an seiner Stelle agieren sollten. Er verschaffte Siegmund das göttliche Schwert «Nothung», mit dem dieser vermeintlich von Wotans Willen freie Held Fafner erlegen und den Ring für Wotan erringen sollte.
Aber Wotans Gattin Fricka machte ihm klar, dass er Siegmund nicht in seinem Sinne handeln lassen konnte, ohne seine eigene Machtposition zu untergraben. Mehr noch: Er hatte dafür zu sorgen, dass Siegmund zur Wahrung der Gesetze im Zweikampf mit Sieglindes betrogenem Ehemann Hunding fiel.
Wotans Lieblingstochter jedoch, die Walküre Brünnhilde, versuchte Siegmund entgegen Wotans Befehl zu retten. Wotan zerstörte Nothung, der wehrlose Siegmund fiel, aber Brünnhilde verhalf seiner Schwester und Braut Sieglinde, die bereits Siegfried im Schoss trug, zur Flucht. Als Strafe für ihren Ungehorsam sah sich Wotan gezwungen, Brünnhilde auf dem Walkürenfelsen in einen tiefen Schlaf zu versetzen, der ihr den göttlichen Status nahm und aus dem sie jeder zufällig des Weges kommende Mann wecken könne, dem sie als einfache Menschenfrau zu folgen hätte. Auf Bitten Brünnhildes umgab Wotan den Felsen jedoch mit einem Feuerring, den nur ein furchtlos freier Held durchschreiten kann: Siegfried.
Sieglinde gelangte auf ihrer Flucht zu Mimes Höhle und starb dort bei der Geburt ihres Sohnes. Mime zog den Knaben auf, in der Hoffnung, dass dieser Fafner – der sich in Gestalt eines Lindwurms mit Alberichs Schatz in eine Höhle zurückgezogen hatte – erschlagen und ihm den Ring überlassen würde. Aus den Trümmern Nothungs, die Mime nicht reparieren konnte, schuf sich Siegfried ein Schwert, mit dem er Fafner erschlug. Ein Waldvogel warnte Siegfried vor Mime, der ihn ermorden wollte. Siegfried tötete Mime und folgte dann dem Rat des Vögleins, aus dem in der Höhle liegenden Hort einen Tarnhelm und den Ring an sich zu nehmen. Der Vogel tröstete den Einsamen, indem er ihm von der schlafenden Brünnhilde erzählte. Als Siegfried sich dorthin aufmachte, vertrat ihm Wotan den Weg. Doch der kühne Recke war nicht aufzuhalten: Mit dem Schwert Nothung zerschlug er den göttlichen Speer, erstieg den Walkürenfelsen und gewann Wotans Tochter.
Vorspiel
Die drei Nornen, Erdas Töchter, spinnen das Seil des Schicksals und singen vom Weltgeschehen: Wie Wotan einen Ast von der Weltesche brach, um den Speer daraus zu fertigen, in den die Runen der die Welt ordnenden Verträge gegraben wurden; wie die Weltesche an der ihr von Wotan beigebrachten Wunde zugrunde ging und der Quell der Weisheit versiegte; wie Wotan sie fällen und das Holz um die Götterburg aufschichten liess, in der er nun sein Ende erwartet. Als die Nornen die Frage nach der Zukunft stellen, reisst das Seil, und sie kehren in den Schoss ihrer Mutter zurück.
Siegfried fühlt den Drang nach neuen Heldentaten. Brünnhilde kann und will ihn nicht zurückhalten, auch wenn sie fürchtet, dass er für die Begegnung mit der Menschenwelt ungenügend vorbereitet ist. Als Zeichen seiner Liebe überlässt Siegfried ihr den Ring, und sie schenkt ihm dafür ihr Pferd Grane. Während Siegfried den Rhein entlang nach Abenteuern sucht, bleibt Brünnhilde allein zurück.
Erster Aufzug
Gunther ist sehr stolz auf den Glanz seiner Herrschaft am Rhein und auf das grosse Ansehen, das er und sein Stamm der Gibichungen geniessen. Sein Halbbruder Hagen dämpft den Überschwang: Der Ruhm der Gibichungen ist unvollständig, solange Gunther und dessen Schwester Gutrune unverheiratet sind. Doch er weiss Rat: Er erzählt von der herrlichsten Frau der Welt, die auf einem von Feuer umgebenen Felsen wohnt. Da niemand ausser dem stärksten Helden Siegfried das Feuer durchdringen kann, muss dieser dafür gewonnen werden, die Felsenfrau an Gunthers Stelle zu freien.
Als Siegfried tatsächlich bei den Gibichungen eintrifft, reicht Gutrune ihm einen von Hagen beschafften Zaubertrank: Siegfried vergisst Brünnhilde und verliebt sich auf der Stelle in Gutrune. Gunther eröffnet Siegfried, dass auch er eine Frau begehrt, die jedoch für ihn unerreichbar ist. Als Gegenleistung für Gutrunes Hand bietet Siegfried an, mit Hilfe seines Tarnhelms Gunthers Gestalt anzunehmen und die Felsenfrau an seiner statt zu entführen. Gunther und Siegfried schwören Blutsbrüderschaft und brechen sofort auf.
Hagen schaut ihnen höhnisch nach: Sein Plan geht auf. Siegfried wird Gunther seine eigene Frau zuführen und mit ihr den magischen Ring holen. Diesen will Hagen in seinen Besitz bringen – im Auftrag seines Vaters, der ihn einst geschmiedet hat: des Nibelungen Alberich.
In der Zwischenzeit sucht Waltraute ihre Schwester Brünnhilde auf. Brünnhildes Hoffnung, Wotan habe ihr verziehen, verfliegt schnell, als Waltraute ihr den zerrütteten Zustand der Götter und Helden in Walhall schildert. Sie glaubt, dass es nur noch eine Rettung gibt: Brünnhilde muss den Rheintöchtern den Ring übergeben. Aber Brünnhilde ist nicht bereit, auf Siegfrieds Liebespfand zu verzichten, und bricht endgültig mit der Götterwelt, aus der sie stammt.
Kaum ist Waltraute verzweifelt davongestürmt, ertönt Siegfrieds Hornruf. Aber zu Brünnhildes Entsetzen scheint es ein Fremder zu sein, der den Weg zu ihr gefunden hat: Siegfried, in Gunthers Gestalt und nicht ahnend, wie er mit der anscheinend fremden Frau verbunden ist. Er entreisst ihr den Ring und teilt mit ihr das Bett, legt aber sein Schwert zwischen sich und die Frau.
Zweiter Aufzug
In der Nacht erscheint Alberich seinem Sohn Hagen und erinnert ihn eindringlich an den Sinn seiner Existenz: Der Nibelung hat ihn einzig zu dem Zweck gezeugt, den Ring zu erobern und ihn seinem Vater zu übergeben. Hagen beruhigt ihn: Siegfried ist ihm schon ins Netz gegangen.
Im Morgengrauen taucht Siegfried auf und kündigt die baldige Ankunft von Gunther und Brünnhilde an. Gutrune empfängt ihn erfreut, kann ihm jedoch ihr Unbehagen bezüglich des genauen Hergangs der Entführung nicht verhehlen. Schliesslich werden die Mannen und Frauen des Hofes zum festlichen Empfang des Paars und zur anschliessenden Doppelhochzeit herbeigerufen.
Als Brünnhilde mit Gunther eintrifft, erkennt sie zu ihrem Entsetzen Siegfried an der Seite Gutrunes; dieser gibt jedoch vor, Brünnhilde nicht zu kennen. Als sie an Siegfrieds Hand den Ring entdeckt, den dieser ihr in Gunthers Gestalt entrissen hat, durchschaut Brünnhilde nach und nach den Betrug und erklärt öffentlich, dass nicht Gunther, sondern Siegfried sie überwältigt und zur Frau genommen habe. Siegfried beteuert seine Treue zu Gunther und wird von Hagen genötigt, seine Unschuld bei der Spitze von Hagens Speer zu beschwören. Brünnhilde schwört ihrerseits bei Hagens Speer, dass Siegfried des Meineids schuldig ist.
Hagen bietet Brünnhilde an, den Verrat zu rächen, worauf sie ihn mit der Unmöglichkeit konfrontiert, Siegfried im Kampf zu besiegen. Er müsse ihn schon feige im Rücken treffen, dies sei die einzige verwundbare Stelle. Mit dieser neuen Erkenntnis fasst Hagen den Plan, am folgenden Tag eine Jagd zu veranstalten, bei der Siegfried getötet werden soll; sein Tod soll im Nachhinein als Jagdunfall dargestellt werden. Gunther stimmt dem Plan widerwillig zu.
Dritter Aufzug
Siegfried hat sich auf der Jagd verirrt und trifft auf die Rheintöchter, die ihn um den Ring bitten, was er zunächst ablehnt. Als die Mädchen ihn daraufhin als geizig verspotten, besinnt er sich und ist bereit, den Ring herauszugeben. Doch nun warnen sie ihn vor dem Fluch, mit dem der Ring belegt ist. Er zieht sein Angebot trotzig zurück, denn einschüchtern lässt er sich nicht.
Die Jagdgesellschaft hat Siegfried aufgespürt, und man lässt sich zur Mahlzeit nieder. Um den düster vor sich hinbrütenden Gunther aufzuheitern, erzählt ihm Siegfried aus seinem Leben. Hagen reicht Siegfried einen Zaubertrank, der ihm die Erinnerung an Brünnhilde zurückgibt. In dem Augenblick, da er von seiner Begegnung mit ihr auf dem Felsen berichtet, stösst ihm Hagen den Speer in den Rücken. Er erklärt gegenüber Gunther und den entsetzten Mannen den Mord zur Sühne für Siegfrieds Meineid.
In der Nacht wird Gutrune von bösen Ahnungen verfolgt, die sich aufs schlimmste bestätigen, als die Jagdgesellschaft mit dem toten Siegfried zurückkehrt. Gutrune klagt ihren Bruder an, Siegfried ermordet zu haben, der wiederum Hagen die Schuld gibt. Hagen rechtfertigt seine Tat erneut mit der Rache für Siegfrieds Meineid und fordert als die ihm rechtmässig zustehende Beute den Ring an Siegfrieds Hand. Als Gunther sich ihm entgegenstellt, streckt Hagen ihn nieder. Einzig Brünnhilde kann Hagen davon abhalten, den Ring und dessen Macht an sich zu reissen. Gutrune beschuldigt Hagen als Schöpfer der Intrige gegen Siegfried und bekennt ihre eigene Schuld, Siegfried den Vergessens-Trank gereicht zu haben.
Brünnhilde, die von den Rheintöchtern über die Hintergründe des Geschehens und Siegfrieds Unschuld unterrichtet wurde, lässt einen Scheiterhaufen für Siegfrieds Leiche errichten und will selbst in dem Feuer sterben. Die Rheintöchter sollen den dann vom Fluch gereinigten Ring an sich nehmen. Hagen macht einen letzten verzweifelten Versuch, sie daran zu hindern, und wird von den drei Nixen in die Fluten gerissen. Aus der Ferne leuchten die Flammen der verbrennenden Götterburg.