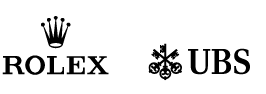Die Aufführungstradition von Opern ist eine männliche
Die Regisseurin Tatjana Gürbaca nimmt das Opernrepertoire aus der Sicht einer inszenierenden Frau wahr. Sie findet, dass die alten Stoffe sehr wohl noch Spannendes über unsere heutige Zeit zu erzählen haben, fordert aber dringend neue Werke
Tatjana, wie viel männliche Hegemonie steckt in unserem Opernrepertoire?
Sehr viel natürlich. Die meisten Werke, die wir spielen, wurden von männlichen Librettisten geschrieben, von männlichen Komponisten vertont und bis vor noch nicht allzu langer Zeit fast ausschliesslich von männlichen Regisseuren und männlichen Dirigenten aufgeführt. Daraus ist eine Aufführungstradition der Werke erwachsen, die sich in den Köpfen des Publikums festgesetzt hat. Es gibt eine kollektive Prägung: Man glaubt, zu wissen wie das Werk auf der Bühne zu klingen und auszusehen hat, in welcher aktuellen Inszenierung man es auch immer gerade sieht und hört. Das spüre ich als Regisseurin auch an mir selbst. Wenn ich ein Stück neu lese, tue ich das mitunter mit einem Filter, der nicht aus mir kommt, sondern durch die Aufführungstradition geprägt ist. Und diese Aufführungstradition ist natürlich eine männlich geprägte, etwa im Blick auf weibliche Figuren. Ich versuche diesen Filter auszuschalten, wenn ich eine neue Produktion vorbereite. Karl Kraus hat mal gesagt, in der Kunst kommt es nicht so sehr darauf an, was man bringt, sondern auf das, was man umbringt. An dem Satz ist, insbesondere was das Regieführen angeht, etwas Wahres dran. Es geht immer auch darum, Sehgewohnheiten im eigenen Kopf abzuschaffen und sich einem musikalischen Text so unverstellt wie möglich zu nähern.
An die Welt der Oper wird in letzter Zeit vermehrt ein Unbehagen herangetragen, dass die Geschichten, die in den Stücken erzählt werden, nicht mehr genug mit unserem Leben im 21. Jahrhundert zu tun haben. Spürst du dieses Unbehagen auch, etwa im Hinblick auf die Bilder, die die Oper von Frauen entwirft?
Ich spüre das nicht nur, was Frauenbilder angeht. Das gibt es auch bei vielen anderen Aspekten, etwa welche Rolle die Masse in der Oper spielt. Wir leben ja heute in einer völlig anderen Gesellschaft, die eher von der totalen Vereinzelung geprägt ist. Es ist nicht nur das Frauenbild, bei dem man das Gefühl haben kann, dass es aus der Zeit gefallen ist. Das heisst aber für mich nicht, dass man mit diesen historischen Stoffen nichts Spannendes mehr über unsere heutige Zeit erzählen kann. Allerdings brauchen wir auch dringend neue Stücke für das Opernrepertoire. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Mit ihnen und durch sie können wir dann auch wieder unbefangener auf alte Stücke schauen.
«Ich finde es keine feministische Haltung, zu klagen: Die armen Frauen sind immer nur Opfer»
Es gibt ein Buch der französischen Schriftstellerin und Feministin Catherine Clément aus den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, in dem vielleicht zum ersten Mal grundsätzlich das Frauenbild in der Oper kritisch thematisiert wurde…
O Gott, dieses Buch. Darüber habe ich mich wahnsinnig geärgert. Ich fand das völlig pseudofeministisch, wenn darin anklagend behauptet wird: Wir gehen doch alle nur in die Oper, um Frau sterben zu sehen, und ziehen daraus auch noch Genuss. Ich finde das keine feministische Haltung, wenn man klagt: Die armen Frauen sind immer nur Opfer. Es stimmt auch nicht, das ist viel zu einseitig. Man tut weder den Frauen noch der Welt etwas Gutes, wenn man in Schwarz-weiss-Schemata denkt, Männer generell kriminalisiert und Frauen grundsätzlich zu Opfern erklärt. Gerade was die Oper angeht, greift die Opfer Argumentation auch viel zu kurz. Es gibt ja nicht nur Stücke, in denen Frauen sterben. Und nicht jeder Frauentod sieht gleich aus. Lucia di Lammermoor beispielsweise stirbt nicht einfach. Sie wird vorher wahnsinnig und ist in ihrer berühmten Wahnsinnsarie kraftvoller als andere Figuren zusammen, mit ihren Koloraturen nimmt sie sich Raum und erobert ihre Freiheit zurück. Ausserdem wird sie zur Täterin, genau wie Tosca. So viele Frauen, die in Opern einfach nur unglücklich und einsam sterben, kommen im Opernrepertoire gar nicht vor. Ich habe mal gemeinsam mit einigen Kollegen einen Abend gemacht, der hiess: «Der schöne Tod». Darin haben wir ausschliesslich weibliche Sterbearien inszeniert. Ich habe im Vorfeld dazu eine grosse Tabelle mit allen weiblichen Toden in Opern erstellt und musste feststellen, dass mein eigenes Bild ziemlich schief war. Ich dachte zum Beispiel, es gebe viele weibliche Figuren, die an Schwindsucht sterben. Es gibt aber tatsächlich nur zwei, nämlich Mimì in der Bohème und Violetta in La traviata, mehr nicht. Man muss sich die einzelnen Geschichten schon im Detail anschauen, bevor man generalisiert. Ich finde auch, dass sich das Problem anderswo viel dringlicher stellt: Ich halte zum Beispiel den Tatort nicht mehr aus. Ich mag mir nicht mehr jeden Sonntagabend eine schöne Frauenleiche anschauen. Das nervt mich wahnsinnig. Auch wie die Frauen kategorisiert werden: Da gibt es das Bild von der jungen, meist liebenden Frau, die sexy ist und zum Opfer wird, und dem wird die freudlose, desillusionierte, sich meistens schon in den Wechseljahren befindende, kluge Kommissarin gegenübergestellt. Beim Tatort wäre dringend eine kritische Überprüfung der Weiblichkeitsklischees fällig.
Ich habe das Clément-Buch erwähnt, weil ich dich auf ein Bild ansprechen wollte, das die Autorin darin entwirft, nämlich dass die Oper ein Männerhaus sei, gemeint ist das durchaus in einem ethnologischen, tribalistischen Sinn. Clément ist ja eine Schülerin des grossen französischen Ethnologen Claude Lévi Strauss.
Ich finde es komisch, dass sie das so schreibt. Es gab doch immer ein weibliches Publikum, das mit Genuss in die Oper gegangen ist. Es war vielleicht sogar in den vergangenen Jahrhunderten einer der wenigen Orte, an dem es auch für Frauen selbstverständlich war, öffentlich zu erscheinen – im Zuschauerraum und auf der Bühne! Die Geschichten betreffen Männer und Frauen gleichermassen und sind absolut nicht nur zum Genuss der Männer geschrieben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass es immer mehr weibliche Regisseure gibt. Die alten Geschichten müssen nicht zuletzt wegen der männlichen Aufführungstradition auch von Frauen erzählt werden. Aber – ich sage es nochmal – wir brauchen in der Oper auch dringend neue, zeitgemässere Rollenmodelle.
Du sagst, Frauen müssen die Geschichten erzählen. Gibt es denn den sogenannten weiblichen Blick auf Stücke? Und repräsentierst du ihn mit deinen Regiearbeiten?
Ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, wenn ich darauf reduziert werde. Ich bin ja noch vieles anderes als nur Frau. Aber natürlich bin ich auch weiblich, und das macht gewiss meinen Blick auf die Stücke aus – aber eben nicht nur.
Was macht den weiblichen Blick auf eine Figur wie beispielsweise Cio-Cio San in Giacomo Puccinis Madama Butterfly aus?
Das finde ich ein schwieriges Beispiel, denn auf Madama Butterfly trifft meiner Meinung nach der Begriff des Toxischen tatsächlich zu. Ich habe schon zwei Angebote bekommen, die Oper zu inszenieren, aber jedes Mal abgelehnt, weil ich keine Antwort auf die Frage habe, wie man mit diesem Stoff umgehen könnte. Es geht in Madama Butterfly für mich nicht nur um das Bild der passiven, immerzu wartenden und völlig auf einen Mann fixierten Frau. Da ist auch dieses exotische, vom Kolonialismus bedrohte Japan, das eine Ungleichheit auf mehreren Ebenen schafft, der sich diese sehr junge Frau völlig ausliefert. Alles opfert sie nur für diese völlig fehlgeleitete Liebe. Das ist einfach nur schrecklich. Man kommt auch kaum an den ganzen Asien-Klischees vorbei. Ich habe keine Idee, wie man daraus etwas Spannendes machen könnte. Das ist eine ganz ungute Geschichte.
Bei dem Komponisten Puccini kommt hinzu, dass er im richtigen Leben einen nicht gerade sympathischen Umgang mit Frauen pflegte und man manchmal das Gefühl nicht los wird, er lebe in den Opern seine privaten Männerfantasien aus. Ist das ein Problem?
Das Leben der Komponisten muss man ausblenden, sonst kann man gar keine Oper mehr inszenieren. Wagner war auch unsympathisch.
Findest du, man sollte Madama Butterfly canceln und ganz aus den Spielplänen nehmen?
Wenn ich damit nichts anfangen kann, heisst das ja nicht, dass niemand sonst eine tolle Idee dafür haben kann. Wäre ich Intendantin, müsste allerdings schon ein Regie-Team mit einem überzeugenden Konzept kommen, bevor ich es in den Spielplan nähme.
Kann der weibliche Blick eine Figur wie Arabella von Richard Strauss retten? Sie sehnt sich nach dem einzigen für sie bestimmten Traummann, dem «Richtigen», der dann auch in der Person von Mandryka tatsächlich erscheint. «Und er wird mich anschau’n und ich ihn», singt sie. «Und selig, selig werd ich sein und gehorsam wie ein Kind.» Bei einer solchen weiblichen Unterwerfungsgeste muss doch jede moderne Frau vor Empörung an die Decke gehen.
Die moderne Frau geht in dieser Oper auch schon vorher an die Decke. Deshalb finde ich das Stück ja so grossartig. Es erzählt die ganze Zeit davon, wie die beiden Schwestern Arabella und Zdenka versuchen, ihren Eltern zu entkommen, die turbokapitalistisch versuchen, ihre Töchter meistbietend zu verscherbeln. Die Oper erzählt die Tragödie des Menschen in einer reinen Geldwelt. Arabella wünscht sich etwas anderes vom Leben als das, war ihr die Eltern vorleben. Sie wünscht sich etwas Schlichteres und Ursprünglicheres.
Und das ist die Vorstellung vom Gatten als Überfigur und Wundermann und die Frau davor auf den Knien? Du hast die Oper ja inszeniert. Lässt sich dieses reaktionäre Bild von einer Paarbeziehung durch Interpretation umwerten und retten?
Nein, das muss man auch nicht. Man kann aber erzählen, dass es ein allzu naiver Traum ist, den Arabella da träumt, und dass das Leben nicht so rosig wird, wie sie sich das vielleicht gedacht hat. Man darf die Geschichte halt nicht als ungebrochenes Happyend erzählen. Die Musik legt das auch nicht nahe. Sie ist am Ende seltsam fragil. Wie auf Eis. In meiner Inszenierung erstarrt das Glück von Mandryka und Arabella in einer Art Bewegungslosigkeit. Arabella erscheint in einem schwarzen Kleid mit diesem Glas Wasser, das Hoffmannsthal ins Libretto geschrieben hat. Ab jetzt wird nur noch Wasser getrunken – das finde ich ja schon mal eine Ansage. Und darüber hinaus wissen wir ja nicht, wie glücklich die beiden jetzt zusammen leben und ob ihr Beziehungskonzept funktioniert.
Das Frauenbild, das durch die Stücke nahelegt wird, ist also das eine, die Inszenierung auf der Bühne aber etwas anderes.
Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Interpretation in der Oper alles ist. Die Werke gibt es ja nur, wenn wir sie realisieren. Die Partitur ist ja nicht das Werk, sondern das Aufführungsmaterial, das wir lesen und interpretieren und auf die Bühne bringen müssen.
Lastet nicht ein grosser Druck auf der Regie, wenn sie immerzu gegen das Unzeitgemässe und die Stereotypien der Stoffe aninszenieren muss?
Klar liegt da ein grosser Druck auf uns Regisseurinnen und Regisseuren. Nicht nur weil wir mit jedem Stück so umgehen müssen, dass es für uns heute relevant ist, sondern vor allem auch weil unser Repertoire so klein ist und wir deshalb meist schon zehn andere Interpretationen des Stücks kennen. Man muss sich jedes Mal kritisch fragen: Muss dieses Werk gespielt werden? Und wenn ja, warum will ich es auf die Bühne bringen? Es kann ja sein, dass ich schon eine Interpretation kenne, von der ich überzeugt bin, dass sie zu dem Stück alles erzählt und auf den Punkt gebracht hat. Wenn man keinen starken inneren Impuls spürt, eine Oper neu zu erzählen, sollte man es lieber lassen. Ich bin inzwischen ganz gut im Neinsagen. Wir können die Stücke nicht wie am Fliessband ausspucken. Dann ist es keine Kunst mehr, sondern nur noch Handwerk und Routine. Und das Publikum spürt sehr genau, ob etwas eine Dringlichkeit hat.
Ist es nicht inzwischen auch ein Problem, dass die Regiekniffe, mit denen man beispielsweise ein weibliches Rollenklischee ins Gegenteil wenden kann, selbst Gefahr laufen, zu Klischees zu gerinnen?
Natürlich. Man hat schnell vor Augen, was starke Regisseurinnen und Regisseure mit prägenden Handschriften in der Vergangenheit aus einer Szene gemacht haben oder machen würden. Von solchen Vorprägungen muss man sich freimachen. Es war ja schon immer so, dass die Künstler sich aus einer Tradition erstmal herausschaufeln mussten, um einen freien Blick zu bekommen. Das war bei den Malern der Renaissance bestimmt auch nicht viel anders.
«Ich mag mir nicht mehr jeden Sonntag eine schöne Frauenleiche im Tatort ansehen. Das nervt mich wahnsinnig»
Sollten wir in der Oper mehr Mut haben, die Werke zu überschreiben, neu zu montieren oder mit anderen zu verschränken, um dem Problem des Veralteten zu entgehen?
Am Ende rechtfertigt der gelungene Theaterabend alles. Der muss es erweisen. Wenn er spannend konzipiert ist und mich packt und berührt, ist alles erlaubt. Aber in der Oper ist es viel schwieriger als im Schauspiel, in das Material einzugreifen. Da braucht es kompositorische Expertise und starke Begründungen dafür, den musikalischen Text zu verändern. Ich finde, es muss im Opernrepertoire von heute alles geben – alte Stücke, neue Stücke und die Möglichkeit, mit alten Stücken anders umzugehen.
Wie stehen die Opernhäuser im Vergleich zu den Schauspielbühnen da?
Dass die Schauspielhäuser oft näher an der Gegenwart sind, wissen wir ja alle. Sie spielen mehr neue Stücke und sind viel offener in der Form. Obwohl man auch dort eine gewisse Not spürt, neue dramatische Stoffe zu finden. Es herrscht ja gerade die Tendenz, jeden halbwegs aufsehenerregenden Roman sofort als Theater-Adaption auf die Bühne zu bringen.
Sitzt ein veraltetes Denken, was beispielsweise Frauenbilder angeht, nicht nur in den Werken, sondern auch in Leitungsetagen der Opernhäuser?
Ich spüre da, ehrlich gesagt, im Moment eine gewisse Schieflage. Die Theater und Opernhäuser führen die Debatten über zeitgemässe weibliche Rollenbilder, männliche Dominanz, Diversität, Genderoffenheit oder kulturelle Aneignung mit grosser Leidenschaft, weil es zu ihrem Selbstverständnis gehört, sich grundsätzlich Gedanken zu machen und sich selbst infrage zu stellen. Sie stehen im Moment im Fokus. Aber die Themen müssen natürlich auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaft diskutiert und bearbeitet werden. Veraltetes Denken nistet nicht nur im Repertoire der Opernhäuser, sondern auch in Banken, Universitäten, Fernsehanstalten, Krankenhäusern und Supermärkten. Überall.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 97, November 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.