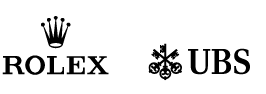Eine Kunstform im gravierenden Umbruch
Die klassischen Handlungsballette seien veraltet und diskriminierend; die Ausbildung baue immer noch auf Duldsamkeit und Gehorsam auf; den Compagnien fehle es an Offenheit für ethnische Vielfalt und alternative Lebensmodelle – das sind Vorwürfe, denen sich das Ballett ausgesetzt sieht. Sind sie berechtigt? Und was folgt aus ihnen? Eine Bestandsaufnahme von Dorion Weickmann
Grosse Veränderungen kündigen sich häufig eher beiläufig an. Ende 2018, also rund 350 Jahre nach der Gründung der «Académie Royale de Danse» und seiner Erhebung in den Stand eines königlichen Metiers durch Ludwig XIV., erlebte das Ballett einen solchen Moment. Der Wandel betrifft ein Utensil, das als Hauptaccessoire weiblicher Virtuosität gilt – den Spitzenschuh. Egal welches Fabrikat, egal ob in West oder Ost hergestellt, bis zu diesem Zeitpunkt kamen die satinierten Hochleistungswerkzeuge ausnahmslos in zartem Rosé auf den Markt, um die Illusion ewig langer Beine zu erzeugen, was bei hellhäutigen Tänzerinnen anstandslos funktioniert, nicht aber bei dunkler pigmentierten Kolleginnen. Hier passende Produktlinien zu entwerfen, kam jahrzehntelang niemandem in den Sinn. Also behalfen sich afroamerikanische und asiatische Ballerinen mit aufwändigen Kolorierungsprozeduren, um Schuhe und Textilien typgerecht einzufärben. Erst 2018 war Schluss mit diesen Provisorien, nachdem die Hersteller ihre Markenpolitik korrigiert und die Angebotspalette um alle erdenklichen Farbnuancen erweitert hatten. Eine Massnahme, die sich durchaus als Reaktion auf neue Realitäten und Spielregeln deuten liess: Seit 2015 die erste Person of Color der Social-Media-Ära, Misty Copeland, den Rang einer Solistin beim American Ballet Theatre erobert hatte, wurde ethnische Exklusion als rassistisches Delikt gebrandmarkt. Mit guten Gründen.
Genau wie die Oper ist das Ballett ins Gerede gekommen: als eurozentrische, mit jeder Menge Kolonialkolorit bemalte und nach wie vor feudal getrimmte Kunst, die auf den Prüfstand gehört. Ob Repertoire, Rekrutierung des Nachwuchses oder Rollenprofile – #MeToo und #BlackLives Matter haben rasante Umwälzungen angestossen. Aber ist die Entwicklung nachhaltig oder allein dem woken Zeitgeist geschuldet, dem eine alle Fortschrittsbewegungen irgendwann ereilende Gegenbewegung den Garaus macht?
Die Disziplinierung von Körper und Geist gehen auf Ludwig XIV. zurück
Die Ballettlandschaft der Gegenwart kennt alle Richtungen, hier den Vorwärtsdrang, dort Stillstand oder den Rückwärtsgang. Wir müssen nur nach Russland schauen, das mit den berühmten Ballett-Partituren von Pjotr Tschaikowski und Marius Petipas Choreografien – etwa La Bayadère oder Dornröschen – den Traditionsfundus dominiert, aber seit Putins Angriff auf die Ukraine wieder in weiter Ferne liegt: neuerlich abgekoppelt vom Westen und zurückgeworfen auf sich selbst. Ein beispielloser Rückschritt, der die Kultur von Moskau über Paris bis New York empfindlich trifft. Die dramatischen Konsequenzen dieser Zäsur können wir allenfalls erahnen. Anders verhält es sich mit Problemen, deren Begutachtung, Bewertung und Lösung allen ein Anliegen sein muss, die das Ballett nicht in die «War-schön-kann-weg»-Schublade stecken wollen.
Als der tanzbegeisterte Sonnenkönig zur Gründung der Akademie schritt, stand ihm der Sinn nach höfischem Pläsier und Leibesertüchtigung seiner Entourage (sprich: künftiger Kriegsvasallen). Drill und Körperkunst gingen also von Anfang an Hand in Hand, über das Corps de ballet wurde ein geradezu militärisches Ordnungs- und Unterordnungsgebot verhängt: Wer aufmuckt, fliegt. Diese hierarchische Struktur begleitet das Ballett seit seinen Anfängen, gehört zu ihm wie die Disziplinierung von Körper, Seele, Geist und Verhalten. Autoritäres Regiment und eine allmächtige Direktion waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein kein Grund zur Aufregung. Erst in den letzten Jahren türmen sich die Schlagzeilen. Ausbildungsstätten, die machtmissbräuchlich geleitet werden und unqualifiziertes Lehrpersonal beschäftigen, das wiederum die Eleven zur Unmündigkeit erzieht im Rahmen einer Berufsvorbereitung, die Krankheiten wie Anorexie, Depression, Burnout und Verletzungen aller Art Vorschub leistet. Von den Spätfolgen ganz zu schweigen.
War das nur ein Erbteil der absolutistischen Ära? Nein. Was hier genauso zu Buche schlägt, ist die athletische Dimension des Gegenwartstanzes. Die berühmte «6-Uhr-Position», das Stehen im Spagat, das noch in den 1970er- und 80er-Jahren fast ausschliesslich Ausnahmeballerinen wie Sylvie Guillem beherrschten, ist inzwischen in jedem Ballettsaal zu beobachten. Sprünge, Drehungen, Dehnungen? Die Devise lautet: höher, schneller, weiter. Anders als in den Schwesterkünsten Oper und Schauspiel startet die Berufsausbildung im Ballett noch vor der Pubertät, fällt also in eine der empfindlichsten und prägendsten Phasen des Lebens. Allen Versuchungen zum Trotz sollen künftige Profis einerseits Maximalverzicht in puncto Freizeitspass, andererseits Maximalleistung beim Lernen erbringen. Ein Profil, das der Überzeugung entspricht, im Namen der Kunst sei mehr oder minder alles erlaubt. Diese Gewissheit ist deutlich ins Wanken geraten. Während sich Coaching und Feedback-Formate an vielen Theatern etabliert haben, hinken die Ballettakademien häufig hinterher. Gute bis sehr gute Ex-Tänzerinnen und Tänzer unterrichten – mit Schmalspur-Lehrdiplom – letztlich nach den gleichen Prinzipien, die einst ihre eigene Dressur bestimmt haben. Nicht umsonst berichten junge Tanzende immer wieder von Erniedrigungen und Traumata nach Abschluss eines Studiums, das ihnen vor allem die Tugend unbedingten Gehorsams abverlangt habe.
Stillhalten und immer nur lächeln ist für viele keine Option mehr
Tummeln sich überall schwarze Schafe? Natürlich nicht. Seit einigen Schuldirektionen die Trümmer ihrer Pädagogik-Fassaden um die Ohren flogen, sind vielerorts neue Konzepte, Aufnahmekataloge und Ausbilderinnen und Ausbilder im Einsatz. Jenseits solcher Aufbruchsszenarien bleibt dennoch die Frage: Was ist ästhetisch und mental unverzichtbar für das Dasein auf der Bühne? Eine superschlanke Linie ohne weibliche Rundungen galt lange als conditio sine qua non für Ballerinen. Mehr als 50 Kilo sollte keine auf die Waage bringen, schon mit Rücksicht auf die hebungsbeanspruchten Bandscheiben der Ballerinos. Selbst dieses Dogma bröckelt: Gut trainierte Frauen haben mehr Power, verursachen weniger Rückenstrapazen und dürfen über das 50er-Limit hinauswachsen. Auch wenn die Neigung zu XXS vorherrscht, lässt sich mittlerweile vielerorts eine grössere körperliche Bandbreite in den Compagnien beobachten. Zusehends an Bedeutung gewinnen auch die mentale Gesundheit und psychisches Wohlbefinden. Die Zukunft gehört selbstbewussten Tänzerinnen und mündigen Künstlern statt Insassen einer Dauerkindheit, die im Hamsterrad reibungsloser Routine festsitzen. Denn was wäre die Alternative? Die Verbannung der Tanzkunst in die «War-schön-kann-weg»-Schublade.
Der Theaterbetrieb läuft nach Corona wieder auf Hochtouren, in Sachen Hierarchie ist fast alles beim Alten. Aber stillhalten und «Immer nur lächeln»? Ist für viele Tänzer keine Option mehr. Beschwerdemanagement, Krisenintervention, Vertragsausgestaltung, Proben- und Ruhezeiten – mancherorts ist die to-do-Liste von beachtlicher Länge. In anderen Fällen ist die Ensemblekultur mit regelmässigen Teamsitzungen schon einen Schritt weiter.
Jenseits aller Organisationsfragen ist freilich eine karrieretechnische Besonderheit ins Visier geraten: die alljährlich durch Nicht-Verlängerung auflösbaren Arbeitsverträge. Ein Direktionswechsel berechtigt in Deutschland ohne weitere Begründung zu Tabula rasa. Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Das Modell begünstigt maximale künstlerische Flexibilität, kompliziert aber die Stabilität des Compagniegefüges und erschwert das blinde Vertrauen, das Tänzerinnen und Tänzer bei jedem Auftritt ineinander setzen müssen. Wer an Familie denkt oder anders geartete längerfristige Verpflichtungen eingehen will, wird angesichts eines Damoklesschwerts namens Nicht-Verlängerung nichts überstürzen. Gleichwohl verwirklichen immer mehr Tänzerinnen ihren Kinderwunsch – vor zwanzig, dreissig Jahren noch reine Utopie. Obwohl jenseits des 40. Geburtstags kaum jemand problemlos weitertanzt, nehmen Ballerinen die schwangerschaftsbedingte Karriereverkürzung in Kauf. Elternschaft gestaltet sich auch im Ballett zusehends als Normalität, vor allem wenn der Arbeitgeber massgeschneiderte Wiedereinstiegs- und Trainingsangebote liefert. Gern auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben wird dagegen das Wann, Wo und Wie der sogenannten Transition: Was kommt nach dem Bühnenabschied? Das Nachdenken über ein zweites Berufsleben setzt idealerweise schon am Start ein, während der Ausbildung. Die Akademien stellen entscheidende Weichen, und zwar nicht nur für jeden einzelnen ihrer Schützlinge, sondern für die Tanzwelt insgesamt. Wo sonst sollen Vielfalt, Fantasie, Teamfähigkeit und Geschmeidigkeit – auch im Denken – angelegt werden? Allesamt Qualitäten, die das Ballett der Gegenwart auf- und abruft, so etwa wenn statt purer Interpretation die choreografische Ko-Kreation gefragt ist. Was immer öfter vorkommt. Auch deshalb ist ein simples «Immer nur lächeln» schlicht passé.
Mehr Respekt für individuelle und kollektive Identitäten
Ein Signal, auf das viele gewartet haben: Erst vor wenigen Wochen wurde die erste Person of Color als Danseur étoile ans Firmament des Pariser Opernballetts versetzt. Guillaume Diop, Sohn eines französischen Vaters und einer senegalesischen Mutter, schreibt Geschichte. Der an die Spitze der Weltklasse-Compagnie promovierte Ballerino hat noch vor drei Jahren zu einer Handvoll Rebellen gehört, die der Opéra de Paris die Leviten lasen. Gemeinsam mit vier weiteren Kollegen und Kolleginnen verfasste Diop ein Manifest über Rassismus an der elitären Institution: «De la question raciale à l’Opéra de Paris». Damit hatten die Ausläufer des Protests nach der Ermordung George Floyds und die weltweite Unterstützung für #BlackLivesMatter auch die Traditionsfront des Balletts erreicht. Die Streitschrift schlug gemässigte Töne an und unternahm zugleich eine harsche Abrechnung mit Zu- und Missständen vor wie hinter den Kulissen des Palais Garnier, Stammsitz und Spielstätte des Ballet de l’Opéra. Die Liste der Verfehlungen reichte von der Benennung bestimmter Gebäudeteile («Carré des négresses») über die Praxis des Yellow- und Blackfacing (dem Überschminken heller Hautfarben für exotische Rollen) bis zu entgleisten Umgangsformen. Auch das Repertoire geriet ins Zwielicht, angefangen von Teilen der Nomenklatur (etwa Danse des négrillons in La Bayadère) über die uniforme Beschaffenheit ganzer Choreografien (namentlich der Ballets blancs, der weissen Akte, in La Sylphide oder Giselle) bis zu orientalischen Schauplätzen, Plots und Personaltableaus.
In diese Kategorie fallen sowohl einzelne Passagen, etwa Danse arabe und Danse Chinoise im Divertissement von Tschaikowskis Nussknacker, als auch historische Prunkstücke wie La Péri, La Source, La Bayadère, Raymonda oder der von Sergej Diaghilew 1911 produzierte Petruschka, dem ein Jahrhundert später die Rolle des «Mohren» zum Verhängnis wird. Als weiterer Negativposten schlug die mangelnde Diversität der Truppe zu Buch: Nur zwei dunkelhäutige von insgesamt 78 Tänzerinnen? Man muss nicht progressiv sein, um derartige Zahlen in einer multiethnischen Gesellschaft wie der französischen für anachronistisch zu halten. Aber wie umsteuern? Das Manifest rannte in gewisser Weise offene Türen ein, und das nicht nur in Paris. Die Zeit war reif für Revisionen, getriggert von Initiativen wie «Final Bow for Yellowface», die das Ballett kritisch durchleuchten. Ziel ist nicht das Wegsperren problematischer oder missliebiger Werke, sondern ihre inhaltliche und ästhetische Begutachtung sowie feineres Fingerspitzengefühl bei Besetzungsfragen. Mehr Respekt, mehr Sensibilität für individuelle und kollektive Identitäten lautet die Forderung, mit der Phil Chan schon 2019 die Ballettöffentlichkeit aufgerüttelt hat. Der Choreograf und Mitbegründer von yellowface.org hat soeben unter dem Titel «Banishing Orientalism» sein zweites Buch publiziert. Es argumentiert ähnlich wie der Bericht, den der Generaldirektor der Pariser Oper, Alexander Neef, 2020 als Reaktion auf die Philippika des Ballett-Quintetts in Auftrag gab.
Das Ergebnis lag im Januar 2021 auf dem Tisch. Der Historiker (und heutige französische Bildungsminister) Pap Ndiaye und die Politikerin und Schriftstellerin Constance Rivière erarbeiteten einen «Rapport sur la Diversité à l´Opéra National de Paris», der nicht nur die Kritik der Beschwerdeführer in der Sache bestätigte, sondern auch Gegenmassnahmen vorschlug. Zu den Neuerungen fürs Ballett zählten eine Veränderung des Aufnahmeverfahrens für die Akademie mit dem Ziel, schon den Nachwuchs und damit auch das künftige Ensemble ethnisch, sozial und kulturell diverser aufzustellen. Mehr Vielfalt, personelle und stilistische Öffnung des choreografischen Spektrums, dazu kritische Sichtung des Repertoires und umgehende Abschaffung von Blackfacing & Co. – all das schrieben die Wissenschaftler dem Opernhaus ins Stammbuch.
Papier ist geduldig. Von der Stellungnahme bis zur sichtbaren Veränderung ist es ein weiter Weg. Und natürlich gibt es eingeschworene Liebhaber der Balletttradition, die sich mit der Idee ihres Verlusts nicht befreunden können. Aber sind derart einschneidende Eingriffe überhaupt notwendig? Ist Cancel Culture das einzig probate Rezept?
Die Ballett-Klassiker zwischen «Weg damit» und «Alles muss bleiben»
Ted Brandsen, Direktor von Het Nationale Ballet in Amsterdam, hat 2017, 2019 und 2023 Kollegen und Kolleginnen aus aller Welt eingeladen, um über die Positionierung des Balletts zu beraten: Wie kommt der klassische Tanz in die Zukunft? Schon bei der ersten Ausgabe signalisierte die Führungsrunde Handlungsbedarf. Statt Top-down-Ansagen mehr Austausch und lebendige Gesprächskultur verankern, Spielpläne erweitern und modernisieren, Diversität stärken und neue, nicht zuletzt jüngere Publikumsschichten ansprechen – das sind die vier wesentlichen Ziele, die (stark sponsorenabhängige) US-Compagnien genauso anvisieren wie ihre europäischen, staatlich besser subventionierten Pendants.
Es hat sich herumgesprochen, dass auch eine mit grandiosen Erbstücken ausgestattete Kunst nicht zum verstaubten Museum verkommen darf und auf die Gemengelage des 21. Jahrhunderts antworten muss. Gesellschaft und städtische Soziotope verwandeln sich rasant. Die Kunst kann diese Metamorphosen nicht ausblenden, ohne ihren Resonanzboden und ihre finanzielle Legitimation zu riskieren. Sie muss sich öffnen, muss mit den zusehends sprunghaften Aufmerksamkeitsökonomien der Digitalära zurechtkommen, dazu barrierearm und möglichst allgemein zugänglich sein. Die bildungsbürgerliche, auf Repräsentation geeichte Klientel wird die Theater nicht mehr füllen. Sie ist eine aussterbende Spezies. Wie aber korrespondiert das kultivierte Vermächtnis mit jungen Menschen, die in dauerfluiden Verhältnissen, rapidem Wertewandel und Krisenszenarien gross werden?
Das ererbte Ballettrepertoire, das sich heute nicht mehr ohne weiteres durchwinken lässt, ist nicht sehr umfangreich. Aber es konserviert den Kernbestand des Fachs. Die Kritik differenziert zwischen verschiedenen Aspekten. In erster Linie geht es um die Geschlechterklischees der Romantik, ausserdem stehen wegen Exotismus und Orientalismus nicht wenige Klassiker unter Rassismus-Verdacht. Die einschlägige Klage ist kein Novum. So sorgte etwa der Nussknacker schon 1981 für Empörung. Ying Hope, kanadischer Staatsbürger mit chinesischen Wurzeln, stiess sich seinerzeit an der Chinoiserie-Episode des zweiten Akts und rief die Menschenrechtskommission von Ontario an. Journalisten beschrieb er den Schock angesichts von Tänzern mit Fu-Manchu-Bärtchen und umherfuchtelnden Zeigefingern.
Die Rekonstruktionen historischer Ballette werden zur Stolperfalle
Mit Blick auf die Kinder im Publikum erklärte Hope, ihnen werde hier keine Darstellung chinesischer Lebensart zuteil, sondern eine rassistische Lektion verpasst. Die Kritik verpuffte, aber seitdem kehrten ähnliche Vorwürfe in regelmässigen Abständen wieder und gipfelten schliesslich während der Corona-Pandemie in einem Schlagabtausch zwischen Vertretern der «Alles-muss-bleiben-wie-es-ist»-Fraktion und dem gegnerischen «Weg-damit»-Lager. Die Ausgangslage verlangt nach differenzierter Betrachtung: Während etwa das Ballett Zürich mit Christian Spucks Version einen einwandfrei unanstössigen Nussknacker präsentierte und auch andere zeitgenössische Fassungen, etwa von John Neumeier oder Jeroen Verbruggen, kein Ungemach heraufbeschwören, stehen alle am «Original» von Petipa/Iwanow orientierten Choreografien auf der Watchlist. Wobei im klassischen Tanz das «Original» häufig ohnehin nur in Umrissen erhalten ist, weitergegeben von einer Generation zur nächsten und mit jeweils zeitgeistigen Anpassungen versehen.
Indes wird dem Nussknacker zur Stolperfalle, was vor wenigen Jahren noch als grosse Errungenschaft galt: Rekonstruktionen, also die möglichst weitgehende Annäherung an den szenischen Urzustand, bezeugen eben auch das unbekümmerte Jonglieren verblichener Librettisten, Choreografen und Bühnenbildner mit kolonialen Fantasien. Selbst Nussknacker-Nachbauten wie Rudolf Nurejews Inszenierung schwelgen in pittoresker Pracht. George Balanchines Nutcracker, der stets Rekordsummen einspielt und zahlreichen US-Compagnien das Überleben sichert, wurde von «Final Bow for Yellowface» attackiert – mit dem Resultat, dass der nachlassverwaltende Trust die Bearbeitung der inkriminierten Passagen freigab. Ein bis dato undenkbares Vorgehen.
Gleich doppelt betroffen ist das Staatsballett Berlin, das seinen sündteuren, mit dem Bolschoi koproduzierten Nussknacker vorerst ebenso eingemottet hat wie Alexei Ratmanskys 2018 herausgebrachte Nachschöpfung der Orient-Fabel schlechthin: La Bayadère. Das Dreiecks-Melodram um die Tempeltänzerin Nikja, den Krieger Solor und die Herrschertochter Gamzatti nennt mit dem «Königreich der Schatten» eine der grössten Attraktionen des Repertoires sein eigen: zweiunddreissig weiss verschleierte Ballerinen, die sich in chorischen Arabesques-Serpentinen von der Hinterbühne aus an die Rampe schlängeln. Wie aber trifft ein Publikum, das sich per Spielkonsole, Virtual Reality-Brille und Gaming-Plattform tagtäglich durch Pixel-Universen schleust und mit fremden Imaginationen vollpumpt, auf die filigranen Geschöpfe aus Solors opiumberauschten Träumen? Auf weibliche Trugbilder, deren Habitus alle Errungenschaften der Emanzipation verneint? Das ist die spannende Frage: Sollen oder müssen sich die Bewohner des 21. Jahrhunderts von bestimmten Abschnitten des Ballettkanons verabschieden, die heutigen Standards zuwiderlaufen? Haben sie das Recht oder gar die Pflicht, Kunstwerke aus politischen, gesellschaftlichen, moralischen Gründen zu korrigieren – oder verstösst eine derartige Lizenz gegen die Autonomie der Kunst? Wie so oft haben beide Argumentationslinien etwas für sich.
Choreografien wie La Bayadére sind Zeitzeugnisse, die das Denken einer feudalen, kolonialen Weltordnung und eine polarisierte Geschlechterideologie überliefern und beides mit jeder ans «Original» angelehnten Einstudierung aktualisieren. Urheber wie Marius Petipa und Impresarios wie Sergej Diaghilew haben ihr Fantasia-Land nie gesehen, sondern aus Büchern, Bildern und Berichterstattung farbige Impressionen collagiert. Dass solche Erfindungen keine Wirklichkeit spiegeln und Menschen irritieren, deren Herkunftskultur in diesen «Otherness»-Konstrukten bis zur Karikatur verzerrt und auf Schaueffekte reduziert wird, lässt sich ohne Weiteres nachvollziehen. Der gern bemühte Museums-Vergleich – «niemand wird Gemälde von Gauguin, Otto Mueller oder Ernst Ludwig Kirchner als unbotmässig abhängen» – läuft ins Leere, weil es der lebendige Körper ist, der Tanz in die Gegenwart bringt. Jede Aufführung in den Umrissen des «Originals» beatmet und erweckt die ihm zugrundeliegenden Ideen. Ist das unter allen Umständen zumutbar?
Klare Umgangsformen statt strikter Verbote als mögliche Lösung
Ingeborg Bachmanns Diktum «Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar» weist die Richtung. Jedes Kunstwerk verrät eine oder mehrere Wahrheiten über die Epoche seiner Entstehung. Für Betroffene mag der Anblick diskriminierend und eine unerträgliche Zumutung sein, aber was wird mit strikten Verboten erreicht? Nichts als grobkörniges Vergessen, kulturelle Amnesie. Stattdessen gilt es, klare Umgangsregeln zu formulieren. Dazu gehören neben der Aussetzung jeder Art von Ethnoschminke und -kostümierung aufführungsbegleitende Kampagnen, die das Publikum mit Wissen versorgen und zu einer historisch informierten Sichtweise befähigen. Hier wird das Ballett liebgewordene und lukrative Gewohnheiten ablegen müssen: Kunst erschöpft sich nicht im schieren Genuss, ist mehr als lukullische Ausschweifung und sinnenfrohes Amüsement. Wer die Genialität einer Petipa-Choreografie vor aller Augen beweisen will, verzichtet am besten auf jedes Dekor und lässt sie als reines Körpernarrativ spielen. Dem Publikum werden die Augen übergehen.
Ausgesprochen hilfreich ist auch eine Erweiterung des Werk-Horizonts. Häuser, die opulente Grossproduktionen wie La Bayadère programmieren, sollten parallel eine zeitgenössische Neuinterpretation in Auftrag geben. Eine Übertragung des Stoffs ins Hier und Heute, wie sie dem argentinischen Choreografen Daniel Proietto 2020 mit Rasa beim Königlich Flandrischen Ballett in Antwerpen geglückt ist. Im Übrigen lässt sich die kulturelle Aneignung, die das Abendland ebenso ausgiebig mit dem Orient praktiziert hat wie es Mehrheiten mit Minderheiten, Unterdrücker mit Unterdrückten taten, aufs Überzeugendste umkehren.
Das beste Beispiel dafür stammt von 2019 und zeigt zwei Weltstars mit allen modischen Insignien der Blackness als Herrscherpaar des Pariser Louvre: Beyoncé und Jay-Z in Apeshit, choreografiert von keinem anderen als Sidi Larbi Cherkaoui. Der Clip ist die bis dato cleverste und eleganteste Kampfansage an das weisse Establishment und seine hochkulturelle Hegemonie. Kunst im 21. Jahrhundert? Ist ein ständiges Spiel mit Identitäten.
Dorion Weickmann ist Feuilletonautorin und Tanzkritikerin, arbeitet unter anderem für die «Süddeutsche Zeitung» und ist Redakteurin der Fachzeitschrift «Tanz»
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 101, April 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.