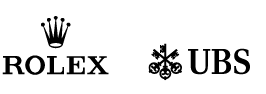In den Opernhäusern gibt es noch viel zu tun
Studentinnen und Studenten der Fachbereiche Regie und Dramaturgie in Bern und Berlin äussern ihren Stadndpunkt zu struktureler Diskiminierung im Opernbetrieb.
Misogynes Verhalten kostet Leben, das Patriarchat verhindert Chancengleichheit, Vergewaltigungen und andere Formen von Gewalt gehören zum unsichtbaren Alltag vieler, und die Stimmen von Minderheiten werden konsequent kleingehalten. Diese Realität lässt sich in Zahlen abbilden, in Studien zeigen, von Betroffenen schildern; sie hat sich als kollektives Trauma über Generationen eingeschrieben.
Im Opernrepertoire gibt es Geschichten (alte Geschichten!), die mit dieser Realität (heute!) zu tun haben. Die Gegenwart ist das Problem, und Oper sollte sich mit ihren Geschichten zu dieser Gegenwart verhalten. Oper sollte hinterfragen, verschiedene Perspektiven einnehmen und möglichst viele Menschen meinen. Sollte das gängige Repertoire das nicht erfüllen können, lohnt es sich, nach anderen Geschichten zu suchen – die gibt es. Der Debatte um die Oper und das Opernrepertoire fehlt es an Selbstverständlichkeit, sich zur Gegenwart verhalten zu wollen und diese ernst zu nehmen. Es braucht keinen Trend, keinen Wokeness-Begriff, keinen Blick für Toxizität, um einschätzen zu können, ob das, was man erzählt, Menschen diskriminiert, ausschliesst oder unnötig Gewalt reproduziert.
Marlene Schleicher studiert Dramaturgie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
«Misogynes Verhalten kostet Leben.»
«Toxisch» ist ein sehr grosses Wort, und es ist schwierig, dieses Wort auf die Werke anzuwenden. Denn ein Werk wird oder wird nicht toxisch durch die Umsetzung und Interpretation des Teams, das sich mit diesem auseinandersetzt.
Ganz generell kann man sagen, dass die meisten im deutschsprachigen Raum gespielten Opern von «weissen, europäischen Männern» geschrieben und komponiert wurden, allein daher wird eine sehr männlich geprägte Sichtweise auf den Bühnen gezeigt. Auch am Opernhaus Zürich finde ich keine Komponistin unter den inszenierten Opern dieser Spielzeit.
In der Vergangenheit und auch heute noch wird dadurch ein Weltbild vermittelt, das von Männern gestaltet wurde. Die Wahrnehmungen, Konflikte, das Denken und Fühlen von beispielsweise Frauen oder anderen Geschlechtern und gesellschaftlichen Gruppen kommt auf den Opern- und Theaterbühnen quasi nicht vor (siehe den Beitrag auf neuedeutsche.org: «Es ist für BIPoC wesentlich schwieriger, in Deutschland Zugang zur klassischen Musik zu finden als für weisse Menschen»).
Daher ist toxisch vielleicht das falsche Wort, ich würde eher das Wort einseitig verwenden. 7:2 ist in dieser Spielzeit das Verhältnis von männlich-gelesenen zu weiblichen-gelesenen Opernregisseur:innen in Zürich. Die musikalische Leitung kommt sogar auf 100% männlich-gelesene Menschen. Wie können wir es da schaffen, nicht nur männliche Weltbilder zu vermitteln?
Dazu kommt, dass es, im Gegensatz zum Schauspiel, nicht so einfach ist, Opern entgegen der «Gender-Vorgaben» zu besetzen, denn es kommt noch die Stimmlage, die einer Rolle zugeschrieben wurde, hinzu. Auch ist es weitaus schwieriger zu kürzen. Im Schauspiel haben wir da häufig freie Hand, können kürzen, umschreiben und Fremdtexte hinzufügen, um den bestehenden Text zu kommentieren, Haltung zu beziehen und den Fokus eines Stücks zu verschieben – das ist in der Oper anders. Jeder Text hängt mit der Musik zusammen, die Interpretation eines Stücks ist dementsprechend komplizierter und das Streichen von diskriminierenden Textstellen nicht so einfach möglich. Das alles führt dazu, dass die Opern (jedenfalls die klassischen) im Licht der aktuellen Debatten (Sexismus, Rassismus, Diskriminierung jeglicher Art) schnell in der Kritik stehen. Ich denke, es ist an der Zeit, nicht-männlichen, nicht-weissen Sichtweisen mehr Raum zu geben und gesellschaftliche Gruppen, die bis heute nicht oder nur selten einen Platz in bildungsbürgerlichen Kunsträumen bekommen, selbst zu Wort kommen zu lassen.
Nola Friedrich macht zurzeit ihren Master Expanded Theatre an der Hochschule der Künste Bern
«Gerade durch die Aspekte einer Oper, die Widerspruch hervorrufen und uns zwingen, eine Haltung einzunehmen, bleiben die Werke lebendig.»
Der Opernbetrieb muss sich immer wieder scharfen Vorwürfen stellen. Das Repertoire sei eingestaubt, der Betrieb träge, die Kunstform veraltet. Sicherlich haben all diese Vorwürfe einen Ursprung und eine Berechtigung, aber die Auseinandersetzung mit unserem relativ klar definierten Opernrepertoire bietet auch Chancen. Es gibt schliesslich einen Grund, warum diese Kunstform noch immer faszinierend ist. Eines ist klar: Auf der Opernbühne begegnen wir zurzeit den immer gleichen Narrativen in immer gleichen Stücken, die wir schon in zehn verschiedenen Interpretationen kennen, die besonders häufig von mittelalten weissen Männern inszeniert werden. Oft beschleicht mich bei diesen Inszenierungen das Gefühl, dass sich die Regie wenig für die tatsächliche Geschichte der Figuren interessiert. Im Inszenierungsprozess befindet man sich immer auch auf einer Gratwanderung: Reproduziert man altbackene Stereotype vom leidenden weiblichen Opfer auf der Opernbühne, von exotisierenden oder gar rassistischen Zuschreibungen? Oder nutzt man die Auseinandersetzung mit dem Stück dazu, fehlgeleitete Tendenzen zu entlarven, das Patriarchat auszustellen und toxische und fragile Männlichkeit auflaufen zu lassen? Ich bin gelangweilt (und genervt), wenn ich zum 100. Mal eine leidende Frau auf der Bühne sterben sehen muss oder tatsächlich noch jemand einen «hysterischen» Anfall inszeniert! Denn schliesslich thematisiert die Oper vielleicht gar nicht die Frau als alleiniges Opfer, sondern zeigt das Scheitern des Patriarchats anhand ihrer Geschichte auf.
Vielleicht könnte man sich vom heiteren Musiktheater eine Scheibe abschneiden – die Frauenfiguren in manchen Operetten sind weitaus selbstbestimmter, freier und vielleicht auch vielschichtiger, sie müssen nicht unbedingt am Ende sterben oder anderen den Tod bringen, sondern können freier mit ihrer Identität und Sexualität umgehen. Natürlich liegt diese Freiheit auch in den Stoffen, aber auch im Umgang damit. Die Musik und der Text werden häufiger als Material betrachtet, mit dem man frei umgehen darf oder sogar muss, um das Stück überhaupt spielbar zu machen.
Ich würde mir wünschen, dass man sich neben der eingehenden Auseinandersetzung mit den Problematiken eines Stücks auch die Freiheit erlaubt, mit dem Werk als Material umzugehen. Schliesslich werden die Werke nur durch ihre Aufführung am Leben erhalten – und diese Aufführung gestalten wir heute, in unserer Gesellschaft, aus unserer Weltsicht.
Die Auseinandersetzung mit den immer gleichen Stücken bietet die Möglichkeit, toxische Aussagen zu entlarven und neue Perspektive aufzuzeigen. Alle denken, sie kennen die Zauberflöte in- und auswendig, aber den genauen Inhalt hat man vielleicht vor lauter Zauber-Märchenoper-Eindrücken verdrängt. Das erfordert auch den Einsatz von diverseren Regieteams, die verschiedene Perspektiven berücksichtigen und sich mit echtem Interesse am Stück diesem nähern – um vielleicht auch gegen die Publikumserwartung an zu inszenieren. Inszenierungen haben die Aufgabe, sich all diesen uns bekannten Problemen zu stellen, sie zu bemerken, zu interpretieren und damit auch das Werk neu aus der Taufe zu heben. Mein Wunsch ist es, gegen veraltete Topoi anzugehen oder sie in ihrer ganzen Härte zu zeigen und damit zu entlarven, bei all den Herausforderungen aber nicht die Leichtigkeit und Freude am Stück und an der faszinierenden Form Oper zu verlieren. Ich wünsche mir, dass wir Regie nicht mehr als Alleinherrschaft, sondern als gemeinsame Entwicklung verstehen. Als künstlerischen Entstehungsprozess im Austausch mit vielen Perspektiven. Das ist in der Probenarbeit ja sowieso angelegt – Regie allein erweckt ein Werk nicht zum Leben, sondern ein ganzes Team tut es. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir weiter neue Opern schreiben, die sich mit einem heutigen Blick den Themen widmen, die uns beschäftigen. Die darin vielleicht auch über Genre-Grenzen gehen und so neue Blickwinkel ermöglichen, tradierte Rollenverteilungen umkehren, Erwartungen an Stimmfächer aufheben.
Sicherlich hilft es, dass wir uns mittlerweile mit diesen Themen beschäftigen und sie Einzug auch in die Opernwelt erhalten haben. Das kritische Hinterfragen und der Wille zur Modernisierung der Kunst sind auch belebend. Ich finde es äusserst aufregend, sich den Problemen zu stellen und so die Oper am Leben zu erhalten. Schliesslich verhandeln wir noch immer Themen, die auch abgesehen von ihrem historischen Kontext für uns interessant und relevant sind – und es durch die Musik noch immer schaffen, uns zu bewegen.
Pia Syrbe studiert Produktionsdramaturgie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
«Viele Opern schliessen einen riesigen Teil der Gesellschaft von vornherein aus.»
Viele Stücke des gängigen Opernrepertoires sind zweifelsohne aus unserer heutigen Perspektive antifeministisch, rassistisch und heteronormativ. Im Falle nicht weniger Dauerrenner von Mozarts Zauberflöte über Verdis Otello und Aida bis zu Puccinis Madama Butterfly treffen sogar gleich mehrere der Problematiken zu – und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass uns diese Stücke nach wie vor etwas angehen und auch in ihrer Unzeitgemässheit zeitgemäss auf die Bühne gebracht werden können. Gerade die Aspekte an einem Werk, die unseren Widerspruch provozieren und uns zwingen, eine Haltung ihnen gegenüber einzunehmen, halten dadurch ein Stück lebendig. Das Theater muss keine gesellschaftliche Utopie formulieren, unsere Realität widerspiegeln oder Konsens erzeugen, vielmehr sollte es uns die Möglichkeit geben, eben eine eigene Haltung den Dingen gegenüber zu entwickeln oder die bisherige zu hinterfragen. Sucht man eine Antwort, was heutzutage auf einer Bühne noch gezeigt werden kann, sollte man sich an dieser Maxime orientieren und szenische Lösungen entwickeln, die einen inhaltlichen Gehalt haben und auch spielerisch überzeugen.
Dabei halte ich für genauso wichtig, dass das Theater auch weiterhin Grenzen der Darstellbarkeit ausloten darf, um mit der Heftigkeit des Bühnengeschehens auf die Heftigkeit eines Stückes reagieren zu können. Dennoch sind diskriminierende oder stereotype Darstellungsweisen keine notwendigen Konsequenzen eines Stückes, sondern in den meisten Fällen Ergebnis einer unkreativen Regie oder falsch verstandenen Werktreue, die in beiden Fällen einer inhaltlichen Auseinandersetzung im Wege steht. Beispielweise haben nicht zuletzt die medienwirksamen Black-Facing-Skandale um die Arena di Verona in den letzten Jahren eindrücklich vor Augen geführt, wie sehr man in manchen Teilen des Opernbetriebes vom Erhalt der Flamme zur Anbetung der Asche übergegangen ist. Inzwischen sollte es selbstverständlich sein, Körperformen und Hautfarbe nicht mehr an bestimmte Klischeevorstellungen von Rollendarstellung zu koppeln, sondern mit dem zu arbeiten, was Sänger:innen darstellerisch individuell mitbringen. Der Oper wünsche ich deshalb für ihre Zukunft auch weiterhin differenzierte und leidenschaftliche Diskussionen über Inhalte und einen Betrieb, in dem respektvoll und einvernehmlich im Bewusstsein der gesellschaftlichen Verantwortung der Theater geprobt und gearbeitet werden kann. Denn struktureller Rassismus, Sexismus und Machtmissbrauch sind reale Baustellen in unserer Gesellschaft, und die Frage, was wir auf einer Bühne zeigen beziehungsweise sehen möchten, muss unser Miteinander, mit dem wir Theater machen wollen, einbeziehen. Das, was hinter der Bühne geschieht, ist nicht minder wichtig als das, was auf ihr zu sehen ist.
Max Nattkämper studiert Regie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
«Der männliche Blick ist in allen Bereichen des Opernbetriebs immer noch vorherrschend.»
In welcher Welt wollen wir leben? Diese Frage mag auf den ersten Blick kitschig klingen, ist für mich allerdings die grundlegende Fragestellung bei der Beschäftigung mit «toxischem» Opernrepertoire. Träumen wir nicht alle von einer Gesellschaft, in der jede:r die gleichen Chancen hat und Wertschätzung erfährt, in der niemand aufgrund von Ethnie, Herkunft, Geschlecht und/oder Sexualität ausgegrenzt wird? Ich wünsche mir, dass sich diese Welt auf der Bühne spiegelt. Theater muss nicht immer eine moralische Anstalt sein, die ein Publikum erzieht, aber es sollte sich stets seiner gesellschaftlichen Kraft bewusst sein.
Bei nahezu allen Opern des klassischen Kernrepertoires sehe ich die Gefahr des «Toxischen». Denn alle diese Werke sind ein Konstrukt der Zeit, in der sie verfasst wurden, und die Gesellschaft hat sich seitdem glücklicherweise weiterentwickelt. So beispielsweise die Frauenfiguren, alle von Männern geschrieben, komponiert und rezipiert – alle mehr Männerfantasien als authentische Charaktere, wie sollte es anders sein. Ausserdem gibt es zahlreiche andere Diskriminierungen, die in diesem Repertoire vorliegen: Allen voran Sexismus und Rassismus, aber auch andere stereotype und diffamierende Darstellungen. In der Oper sind die Frauen oft schwach und dankbar, die Männer dominant und stark, sowieso sind alle cisgeschlechtlich, heterosexuell, nicht behindert und weiss. Gibt es People of Color, werden diese meist exotisiert und ihre ethnische Identität als Alleinstellungsmerkmal ausgestellt, das sind klar rassistische Fremddarstellungen. All diese unterschiedlichen Ausgrenzungen schliessen von vornherein einen riesigen Teil der Gesellschaft aus, entsprechen und entsprachen noch nie der Realität. Die Welt um die Häuser verändert sich stetig, und dieser Wandel sollte auch nicht mit dem Mantel an der Garderobe abgegeben werden. Durch die «Me-too»-Bewegung haben wir eine Sache schmerzlich gelernt: Viele Menschen streben nach Macht und benutzen diese, um sie zu missbrauchen. Wir haben leider sehen müssen: Wer auf der Bühne keine Grenzen kennt, beachtet sie oft auch in der Probe oder hinter der Bühne nicht. Es ist wohl eine der extremsten Erkenntnisse, dass wir als Menschen nicht zureichend zwischen unserer (kreativen) Arbeit und unserem Leben unterscheiden können.
Ich plädiere also dafür, die Debatten der Welt auch in die Oper zu lassen. Die Oper hat meiner Meinung nach so viele Jahrhunderte überdauert, weil sie urmenschliche Konflikte zeigt und uns Empathie lehrt: Wir begegnen dort Liebe, Hass, Eifersucht, Schmerz, Tod, anderen menschlichen Abgründen und Konflikten, die für uns als Gesellschaft immer relevant und aktuell bleiben werden. Aber der ganze Ballast darum ist absolut zweitrangig, die Musik steht deutlich an zentraler Stelle – denn diese Musik kann etwas, was andere Kunst nicht kann: Uns in ihren Bann ziehen, unseren Körper im Konflikt anderer Figuren mitschwingen lassen, uns Ausnahmesituationen erleben lassen, ohne sie wirklich erleben zu müssen, und so als kulturtechnischer Ort Gesellschaft stützen. Die Opernfiguren befinden sich in solchen Extremsituationen, dass sie schon gar nicht mehr sprechen können, sondern singen müssen. Ich finde, man kann das klassische Repertoire durchaus als Steinbruch verwenden, denn auch ich möchte auf keinen Fall auf die fantastische Musik der Carmen, La bohème oder Zauberflöte und ihre ureigenen Grundkonflikte verzichten müssen – ich wünsche mir aber die Entschlackung der Stoffe und eine Aufführung, die die zeitlosen Konflikte extrahiert, versteht und den nicht mehr zeitgemässen Ballast mutig fallen lässt.
Dagegen den Kampfbegriff der «Werktreue» zu setzen, empfinde ich als nicht zielführend, denn Theater sollte kein Museum, sondern ein Ort der kulturellen Praxis und wandelbar sein. Oper muss ein aktueller Ort, ein Schutzraum und für jede:n sein.
Und dann ist da noch die Sache mit der Empathie. Andere zu verstehen, ist wohl die grösste Aufgabe in unser aller Leben — in Partnerschaft, Familie, Arbeit — immer ist man damit konfrontiert, dass wir alle unterschiedlich sind, anders denken und sprechen, uns andere Dinge bewegen, wir von anderen Erfahrungen geprägt sind. Und genau dort sehe ich die Chance der Oper: Indem mir in der Kunst Geschichten von Menschen vermittelt werden, die anders sind als ich, lerne ich Empathie — ich begleite sie auf ihrem Weg, in ihrer Emotion und kann diese plötzlich nachvollziehen. Das ist der Kern friedlichen menschlichen Zusammenlebens: Unser Interesse füreinander.
Viele Menschen haben nicht das Privileg, sich aussuchen zu können, ob sie heute politisch sind oder nicht — aufgrund ihrer vermeintlichen Hautfarbe, ihrer gelesenen Geschlechtsidentität oder anderen Merkmalen werden sie immer als politisch wahrgenommen. Wenn die Oper weiter existieren will (was ich mir unbedingt wünsche!), muss sie sich dem Aussen öffnen, sich den aktuellen Debatten stellen und deren Erkenntnisse auch auf der Bühne verarbeiten. Denn wenn wir Dinge auf der Bühne nicht mehr reproduzieren, werden sie auch hinter / vor / um die Bühne herum schneller verschwinden. Wir müssen alle am gleichen Strang ziehen, Theatermacher:innen und Publikum, vor, hinter und auf der Bühne, und gemeinsam daran arbeiten, dass Oper kein Museum, sondern ein aktueller Raum bleibt, der die Gesellschaft in ihrer Komplexität spiegelt. Denn spätestens seit es Filmaufnahmen gibt, liegt der Wert ja sowieso nicht mehr darin, Stücke genauso «toxisch» darzustellen wie zu ihrer Entstehungszeit — der freie, aktuelle Umgang mit den Stücken muss nicht zum Regietheater führen, aber zu einem Theater von allen für alle. Denn so könnte die Oper als Kunstform sich immer wieder in neuer Gestalt zeigen, könnte unterschiedliche Gesellschaften weiter überdauern und uns alle mit ihrer unvergleichlichen Kraft immer wieder verzaubern und berühren.
Clara Freitag studiert Regie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
«Die Opern müssen in Form und Inhalt einer radikalen Öffnung unterzogen werden.»
Ich will von meiner Erfahrung als Regieassistentin bei einer Produktion von La forza del destino im Jahr 2019 erzählen. Die Produktion wurde von einem älteren, weissen Cis-Mann inszeniert. Im Rahmen des ersten Treffens mit der Kostümbildnerin startete bereits früh die Debatte, wie das Anders-Sein der Figur Don Alvaros gekennzeichnet werden soll. In der Originalgeschichte ist er eine Person of Color, doch der Sänger dieser Produktion war weiss. Der Regisseur äusserte die für ihn naheliegende Idee, sein Gesicht dunkel anzumalen und ihm langes schwarzes Haar aufzusetzen. Black-Facing nach aller Kunst. Um ihn davon abzuhalten, erzählte ich von der Tradition des Black-Facings in Minstrel-Shows und wie es dazu benutzt wurde, sich über Schwarze Menschen karikaturistisch lustig zu machen. Ich sprach über den Mangel an Selbstrepräsentation von People of Color auf der Bühne und über kulturelle Aneignung. Das Argument, das schliesslich zu einem Sinneswandel geführt hat, war der Ausblick auf den Vorwurf des Backlash in der Kritik.
Das zeigt mir zwei Dinge: Erstens, dass es zum Glück bereits einen Diskurs über das Thema gibt, der in der Rezeption von Inszenierungen eine Rolle spielt. Zweitens, dass es bei diesem Regisseur kein Verständnis für die soziopolitische Bedeutung von Black-Facing gab. Ein Phänomen, das ich hier nicht zum letzten Mal antraf. Weitere Stolperfallen, die sich u. a. auch durch Exotismus und klischeehafte Charakterisierung von Frauen auszeichnen, sind Opern wie Madama Butterfly, Lakmé oder Turandot. Die Bühnenkunst darf natürlich fordern, dass jede:r jede:n spielen darf. Dabei darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass marginalisierte Gruppen noch immer keine Chancengleichheit auf Jobs haben. In unserer Produktion wäre die Lösung gewesen, entweder ein anderes Symbol für das Anderssein Don Alvaros zu finden, oder wirklich eine Person of Color zu engagieren. Man könnte hier natürlich argumentieren, dass Hautfarbe beim Casting keine Rolle spielen sollte. Doch wenn Hautfarbe zum blossen Make-up Konzept reduziert wird, verrennt man sich schnell in eine Doppelmoral. Denn in der Realität hat Hautfarbe konkrete strukturelle Konsequenzen. Die Idee der Frauenquote ist keine neue und wird bereits flächenübergreifend angewendet. Doch was ist mit Quoten für People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund? Ein Denkanstoss, der von der Galeristin Anahita Sadighi aufgeworfen wird, denn noch bis vor kurzem belief sich die Quote in Leitungspositionen von Berliner Kulturbetrieben auf genau null Prozent. Man müsste die Strukturen der Betriebe selbst verändern, damit sich das Bühnengeschehen ändern kann. Einer der Vereine, der solche Änderungen vorantreibt, ist Pro-Quote-Bühne. Gegründet 2012, wurde er ins Leben gerufen mit der Forderung, eine 50% Quote von FLINTA* (also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender) Personen an allen Theaterressorts zu erreichen.
Dass dies absolut notwendig ist, kann man an den folgenden Zahlen ablesen. Sehen wir uns eine Studie des Deutschen Kulturrats zur Genderaufteilung in Bühnenbetrieben aus dem Jahre 2014 an, eine aktuellere liegt momentan nicht vor. In der Intendanz machten Frauen damals einen Anteil von 22% aus, ebenso wie Dirigent:innen. Im Bereich der Regie war man 2014 bei 30%, obwohl durchschnittlich 66% der Regiestudierenden weiblich waren. Erst auf der Ebene der Regieassistenz befanden wir uns mit 51% in einem Gleichgewicht. Vorstände von Kunsthochschulen wurden bis 2014 nur zu 20% von Frauen besetzt. Es lässt sich hier also deutlich erkennen, dass Männer vorwiegend die Entscheidungsträger sind, sowohl was Ausbildungsstätten als auch die Produktion von Opern betrifft. Das Repertoire selbst besteht zu 7% aus Werken von Komponistinnen, bei Uraufführungen verdoppelt sich der Wert immerhin auf 15%. Durch diese Besetzung ist der männliche Blick in Komposition, Betriebsleitung und Inszenierung absolut vorherrschend. Es werden also Geschichten hauptsächlich von (weissen) Männern komponiert, ausgewählt, dirigiert und inszeniert. Ich bestreite daher, dass die Oper die conditio humana angemessen widerspiegelt, wenn ihr jegliche Multiperspektivität in der Entstehung und Umsetzung fehlt. Die männliche Perspektive behauptet schon lange eine vermeintliche Allgemeingültigkeit für sich, die einfach nicht wahr ist. Deswegen plädiere ich für die Aneignung eines Paradigmas, in dem eine intersektional gedachte Diversität das Optimum darstellt und Opernwerke nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, sondern einer radikalen Öffnung in Form und Inhalt unterzogen werden können. Denn Oper hat durch ihre musikalische Ebene die Fähigkeit, Affekte und Emotionen am unmittelbarsten zu übermitteln und zugänglich zu machen, und das soll sie auch weiterhin können und dürfen.
Nada Zimmermann studiert Regie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 102, Mai 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.