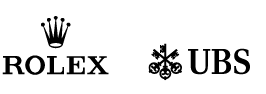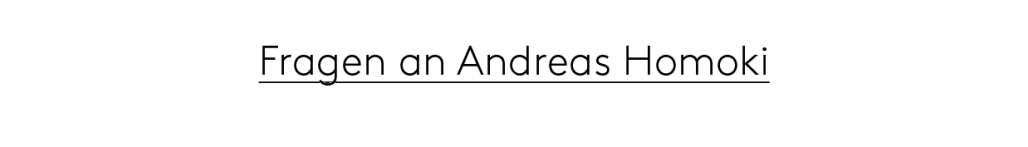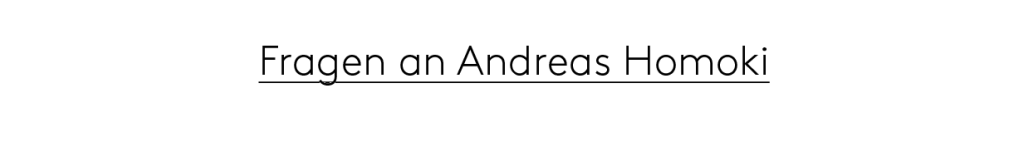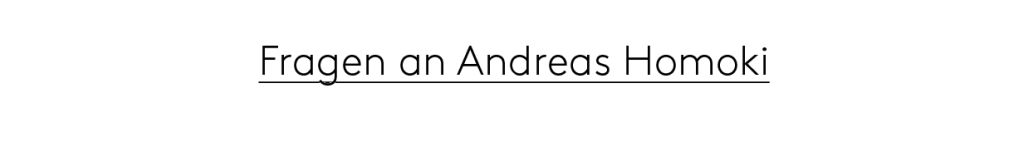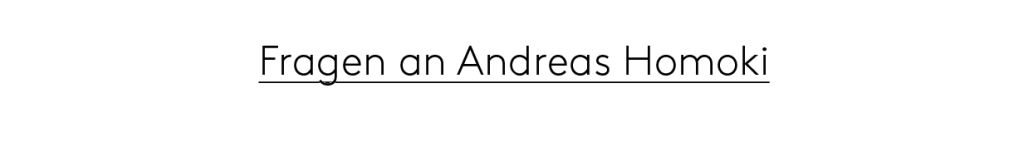Editorial
Verehrtes Publikum,
Theatermenschen sind eine sonderbare Spezies. Ihr Leben folgt einem unsteten Rhythmus. Sie sind hochpräsent im Augenblick und gleichzeitig rastlos, getrieben von ihren Leidenschaften, Ambitionen und der nächsten künstlerischen Herausforderung.
Weiterlesen
18. Juni 2021
Verehrtes Publikum,
Theatermenschen sind eine sonderbare Spezies. Ihr Leben folgt einem unsteten Rhythmus. Sie sind hochpräsent im Augenblick und gleichzeitig rastlos, getrieben von ihren Leidenschaften, Ambitionen und der nächsten künstlerischen Herausforderung. Zu ihren Eigenwilligkeiten gehört, dass sie immer nach vorne schauen und kaum je zurück. Sie leben im Feuereifer der Gegenwart oder in der Zukunft. Was in zwei Jahren auf sie zukommt, ist tausendmal spannender als das, was gerade eben glücklich zu Ende gegangen ist. Die meisten Regisseurinnen und Regisseure haben nach der Generalprobe mit ihrer Arbeit abgeschlossen, manche besuchen nicht einmal die Premiere und sitzen währenddessen lieber mit Freunden und schwitzigen Händen in der Theaterkantine. Die Dirigentin mag nach einer emotional aufwühlenden Vorstellung keinen Schlaf finden, aber im Zweifelsfall sitzt sie am nächsten Morgen schon wieder im Flugzeug und studiert die Partituren für die kommende Vorstellung. In den Planungsrunden der Intendanz wird nicht darüber geredet, wie schwierig oder erfolgreich sich die vergangene Spielzeit gerundet hat, sondern was in drei oder vier Jahren auf die Bühne kommen soll, brennt allen unter den Nägeln. Lehnen sich die Theatermenschen denn gar nie entspannt zurück, um zu geniessen, was sie erschaffen haben? Eher nein, denn sie finden ihre Befriedigung vor allem im unmittelbaren Moment des Machens und Schaffens auf der Probebühne, im Ballettstudio, im Orchestergraben. Das hat natürlich mit der Bühnen-Kunstform selbst zu tun, die an die Zeit gebunden ist und, wenn der letzte Ton verklungen ist, nicht mehr existiert. Dann setzen alle alles daran, sie wieder von Neuem lebendig werden zu lassen.
Für das Publikum ist das anders. Die Opern- und Ballettbesucher leben ganz wesentlich in der Erinnerung an das Erlebte, denn das Wunderbare – die virtuose Arie, die verstörende Mordszene, der berührende Liebes-Pas de deux – ist immer schon vorbei, bevor man es richtig erfasst hat. Die Theaterenthusiasten nähren ihre Leidenschaft im Modus der Nachschau, des glücklichen oder ärgerlichen Gedenkens.
Warum ich das schreibe? Weil erstens die Dramaturgie gegen die Geschichtsvergessenheit der Theatermenschen anarbeitet und sich dafür zuständig fühlt, das kollektive Gedächtnis eines Opernhauses zu pflegen, und weil es zweitens einen gewichtigen Anlass gibt für einen Blick zurück: Fabio Luisi, seit neun Jahren Generalmusikdirektor, verlässt zum Spielzeitende das Opernhaus Zürich. Wir sind deshalb den Spuren seines Zürcher Wirkens nachgegangen, in Form eines grossen Abschiedsinterviews und in einem Podcast, in dem Weggefährtinnen und künstlerische Partner seine Arbeit reflektieren und würdigen. Beide Beiträge finden Sie in unserer aktuellen digitalen Ausgabe des Opernhaus-MAGs, die natürlich ausserdem der letzten Neuproduktion dieser Spielzeit gewidmet ist: Gaetano Donizettis Oper Lucia di Lammermoor in der Inszenierung von Tatjana Gürbaca, dirigiert von Speranza Scappucci.
Am Sonntag, dem 20. Juni, hat unsere neue Lucia im Opernhaus Premiere vor hundert live anwesenden Gästen. Eine Woche später dann ist eine Live-Aufzeichnung in der Mediathek des TV-Senders ARTE und auf unserer Website verfügbar.
Claus Spahn
Wir
blicken
positiv
in die
Zukunft
blicken
positiv
in die
Zukunft
18. Juni 2021
Herr Homoki, der Vorhang hebt sich zur letzten Premiere der Spielzeit. Wie ordnen Sie die neue «Lucia di Lammermoor» künstlerisch in die zu Ende gehende Saison ein?
Das Opernhaus Zürich ist ja bekanntlich das nördlichste Opernhaus Italiens, deshalb setzen wir mit dieser Donizetti-Oper unsere Belcanto-Tradition fort. «Lucia» ist ein populärer Titel, den wir oft spielen können, deshalb wollten wir hier unbedingt eine Neuproduktion haben, die neben der musikalischen und sängerischen Seite auch szenisch unseren Ansprüchen genügt. Und Tatjana Gürbaca ist genau die richtige Regisseurin für dieses Stück. Sie hat keine Berührungsängste mit dem Belcanto-Repertoire, dem man ja gerne nachsagt, es sei jenseits der tollen Arien nicht so ergiebig. Tatjana aber geht diesen Stoffen auf den Grund und befragt sie intensiv im Hinblick auf Psychologie, Vorgeschichte oder verdeckte Beziehungskonflikte. Gerade «Lucia di Lammermoor» bietet mit seiner abgründigen Familiengeschichte in dieser Hinsicht reiches Anschauungsmaterial. Das Stück an sich ist schon antinaturalistisch angelegt und öffnet die Innenräume der Figuren. Da setzt Tatjana Gürbacas Inszenierung an. Und was mich besonders freut, ist, dass hier so grossartige Sängerinnen und Sänger wie Irina Lungu, Piotr Beczala und Massimo Cavaletti wirklich zu einem Ensemble zusammenfinden. Das ist nämlich nicht selbstverständlich bei virtuosen Belcanto-Opern, in denen das Brillieren im Sängerischen oft mehr im Vordergrund steht als die gemeinsame szenische Arbeit. Das ist natürlich auch ein Verdienst der Regisseurin.
Eine schwierige Spielzeit endet, in der wegen Corona vieles nur im Streaming zu erleben war. Jetzt sind wieder 100 Gäste pro Vorstellung möglich, und das Opernhaus Zürich spielt vier Vorstellungen von «Lucia» in Starbesetzung, obwohl das wirtschaftlich doch eigentlich als unverantwortlich gilt. Wie geht das zusammen?
Das leisten wir uns zum Abschluss der Saison. Natürlich ist es eigentlich Wahnsinn, einen Startenor wie Piotr Beczala vor 100 Menschen auftreten zu lassen. Aber wir verstehen das als Geste an unser Publikum und als Zeichen nach aussen, wie sehr wir uns wünschen, grosse Opernabende wieder auf die Bühne bringen zu dürfen. Ich weiss nicht, ob es viele Opernhäuser gibt, die sich das gönnen. Wir machen es allerdings nur mit unserer neuen «Lucia» zum Saisonfinale.
Was erwarten Sie für die kommende Saison?
Dass wir wieder normal spielen! Dass das Orchester wieder im Graben sitzt, der Chor wieder singend und spielend auf der Bühne steht und wir den vorbereiteten Spielplan für Oper wie Ballett realisieren können. Darauf richtet sich jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit. Dafür bündeln wir alle Energien und Ressourcen. Wir gehen davon aus, dass im Spätsommer die grosse Mehrheit aller Mitarbeitenden am Opernhaus geimpft ist. Wir empfehlen die Impfung jedem nachdrücklich und spüren auch, dass die Bereitschaft dafür gross ist. Der Kanton hat uns gegenüber sehr deutlich die Erwartung formuliert, dass wir wieder zur Normalität unserer Kunstproduktion zurückkehren müssen, und das kann nur die Impfung ermöglichen. Wir kriegen hohe Subventionen für eine Leistung, die wir im September auch wieder erbringen müssen, und es liegt auch in der Verantwortung der Mitarbeitenden, daran mitzuwirken, dass wir gemeinsam wieder unseren Kunstauftrag erfüllen können. Das Virus wird im August, wenn unsere Proben beginnen, ja nicht vollständig verschwunden sein, deshalb werden wir eine Testpflicht für die Mitarbeitenden anordnen, von der kann man sich durch den Impfnachweis befreien lassen.
Wie sieht es beim Publikum aus?
Ob wir ein volles Haus haben werden, ist noch nicht absehbar, aber wir gehen im Moment schon davon aus, dass wir im September wieder viele Gäste begrüssen dürfen. Der Aboverkauf für die kommende Saison ist gut angelaufen. Das nehmen wir als ein positives Signal, dass die Opernfans wieder Lust haben auf einen Theaterbesuch.
Wie wird die Saison eröffnet?
Wir holen unseren «Oper für alle»-Event nach, der ja sonst immer im Juni stattfindet. Wir werden am 12. September zum ersten Mal eine Premiere live auf den Opernhausplatz übertragen, «Salome» von Richard Strauss, mit der wir in die Spielzeit starten. Am Vorabend zeigen wir auf dem Sechseläutenplatz die Aufzeichnung von Christian Spucks Verdi-Requiem, einer Produktion, die ausserordentlich erfolgreich war. Ausserdem gibt es Probenbesuche und ein Kinderkonzert. Die Genehmigung für den Platz haben wir. Mit wie vielen Menschen wir ihn füllen dürfen, ist noch offen. Aber wenn ich höre, dass Grossveranstaltungen mit 10’000 Menschen bis dahin wieder möglich sein sollen, passt das genau zu unserem Format.
Fürchten Sie eine vierte Welle im Herbst?
Mich kriegt im Moment keiner dazu, mir neuerliche Horrorszenarien auszumalen. Die Zahlen sinken. Die Impfquote steigt. Wir haben allen Grund, positiv in die Zukunft zu blicken. In der Spielzeit 2021/22 werden wir einen normalen Opernbetrieb erleben. Fertig.
Wie die
Zeit
vergeht
Im Fliegenden Holländer gibt es zwei, in Werther eine und in Lucia di Lammermoor ganze fünf. Die Rede ist von Uhren, die uns technisch herausgefordert haben. Grundsätzlich ist der Wunsch nach einer Uhr (abgesehen von überdimensionierten Turmuhren) nichts Problematisches: Der bzw. die Bühnenbildner*in bestimmt, wie sie aussehen soll, und wir kaufen ein Uhrwerk, das die selbstgebauten Zeiger bewegt.
Schwieriger wird es, wenn die Uhr mehr können soll, als nur die Zeit anzuzeigen. In unserer Produktion des Fliegenden Holländers sollte sie zusätzlich auf Kommando schnell rückwärts laufen können. Das hat unser Maschinist verhältnismässig einfach mit einem Motor gelöst, den wir ans Uhrwerk angeschlossen haben und der mittels Funkfernsteuerung die Zeiger schnell rückwärts drehen lassen kann.
In Werther war eine Pendeluhr gewünscht, bei der die Zeit auf Kommando stehenbleiben soll. Das Stehenbleiben war sehr einfach: Wir kamen von hinten gut an das Uhr- und Pendelwerk und konnten es so anhalten. Aber das Pendel lief anschliessend einfach nicht wieder los. Wenn man es vorsichtig anstiess, pendelte es ein paar Mal, dann stand es wieder... Nach langer Entwicklungsarbeit und unzähligen Experimenten hatten wir eine Pendelmaschine geschaffen, die das Pendel wunschgemäss starten und stoppen kann: Wenn sie eingeschaltet wird, zieht ein Magnet das Pendel für eine Sekunde lang nach rechts. Sobald der Magnet aus ist, schwingt das Pendel nach links. Dort ist ein Sensor installiert: Sobald dieser das Pendel erkennt, wird der Elektromagnet wieder kurz eingeschaltet und das Pendel schwingt zurück nach rechts. Wie immer: Wenn man weiss wie, ist alles ganz einfach...
Für die gerade entstehende Neuinszenierung von Lucia die Lammermoor wurde uns folgende Aufgabe gestellt: auf fünf im Bühnenbild verteilten Uhren sollen während der Vorstellung 12 Stunden vergehen – also deutlich mehr Stunden, als während der Aufführung real vergehen. Mit einem modifizierten Uhrwerk wäre das ja noch zu schaffen gewesen. Aber an einigen musikalischen Stellen müssen die Zeiger auf Kommando auf eine bestimmte Zeit springen und von dieser aus weiterlaufen. Natürlich gibt es auch wieder eine Szene, wo die Zeit rückwärtsläuft. Und damit nicht genug, sie muss auch verrücktspielen können: Die Zeiger sollen sich dann wild vor- und zurückdrehen, das Ziffernblatt die Farbe ändern und flackern können.
Da die Uhren in recht dünne Wände eingebaut sind, die sich auf der Drehscheibe permanent drehen und sich von allen Seiten zeigen, können wir nicht einmal unsichtbar von hinten an das Uhrwerk gelangen und die Zeiger von Hand bewegen. Wir haben uns deshalb entschieden, statt der mechanischen Uhren fünf Bildschirme einzubauen, auf denen die Uhr als Video gezeigt wird. Die Bildschirme sind natürlich so in die Wand integriert, dass man vom Zuschauerraum aus davon überzeugt ist, echte Uhren vor sich zu haben. Auf den Bildschirmen können wir nun beliebige Videos laufen lassen, von schnell laufenden, rückwärts drehenden, oder verrücktspielenden Uhren. Die Videos können wir für jede einzelne Uhr über WLAN starten, stoppen und auch schneller oder langsamer laufen lassen. Wie immer: Wenn man weiss wie, ist alles ganz einfach.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich
Illustration: Anita Allemann
Eine Frau begehrt auf
In Gaetano Donizettis Oper «Lucia di Lammermoor» geht es um mehr als Belcanto und virtuose Stimmen: Das Stück wirft einen Blick in die emotionalen Abgründe zerrütteter Familienverhältnisse und porträtiert eine junge Frau, die im Wahnsinn zur Selbstbestimmtheit findet. Ein Gespräch mit der Regisseurin Tatjana Gürbaca über ihre Lesart von Donizettis bekanntester Oper. Lesen
In Donizettis Oper «Lucia di Lammermoor» hat sich die Titelfigur Lucia heimlich mit Edgardo verlobt, dem Todfeind ihrer Familie; nun soll sie jedoch mit dem reichen Arturo Bucklaw verheiratet werden, um den Niedergang der Familie aufzuhalten und ihrem Bruder Enrico wieder zu Ansehen zu verhelfen. Wer ist diese Lucia?
Das Besondere an dieser Oper ist ja erst einmal, dass hier eine Schamlose, eine Verrückte, zur Heldin und Sympathieträgerin wird. Man kann sich fragen, wieso Lucia uns gerade in ihrem Wahnsinn so berührt. Am Ende sind zwei Familien ruiniert, ein Mann hat Suizid begangen, ein anderer wird in der Hochzeitsnacht von der eigenen Braut ermordet, und diese sitzt im blutigen Nachthemd zwischen ihren Gästen und träumt das grosse Liebesglück. Und dennoch steckt in dieser Geschichte offenbar etwas, das so zeitlos, so unabgegolten ist, dass man sie sich auch als Hitchcock-Film, Graphic Novel, als Mafia-Geschichte, Western oder im historischen Japan vorstellen könnte.
Lucias Verrücktheit, ihr Aus-der-Welt-Treten öffnet auch uns die Augen für die Realität, in der sie sich bis dahin befand. Wir verstehen sie, weil Mord und Wahnsinn Befreiungsschläge sind und es schon vorher immer wieder Momente gab, in denen man sich fragen musste, wer eigentlich verrückt spielt: Lucia oder die Welt um sie herum? Und weil sie uns vor Augen führt, dass es kein richtiges Leben im falschen geben kann.
Donizettis Oper geht auf einen Roman von Walter Scott zurück. Was für eine Zeit wird in diesem Roman beschrieben?
Die Zeit, in der die Geschichte in der Romanvorlage spielt, ist die Zeit der Cromwell-Herrschaft. Die Konflikte, die England, Irland und Schottland gerade in den Glaubenskriegen ausgefochten haben, gehen über Glaubensthemen weit hinaus und lassen die Parteien auch noch in der Folge mit grösster Erbitterung aufeinandertreffen. Freunde werden von einem Tag auf den anderen zu Feinden, ganze Familien sind mit einem Schlag ruiniert. Kulturgeschichtlich ist diese Ära interessant, weil sie im Denken der Gesellschaft einiges verändert: in der Einstellung zu Reichtum und Erwerbsarbeit zum Beispiel, im Verhältnis zwischen Adel und Bürgertum, in der Haltung zur Nation, im Bildungssystem, in der Wahrnehmung von Individualität und im Leben der Frauen. Ein schönes Beispiel für diese Entwicklung findet sich in der Oper im Dialog zwischen Lucia und dem Hausgeistlichen Raimondo. Raimondo bittet Lucia, endlich in die geplante Heirat einzuwilligen, und Lucia sagt plötzlich mit dem Selbstbewusstsein eines neuen Zeitalters: Ich werde die Familie retten! Das ist aber gar nicht das, wozu sie gebeten ist; sie ist aufgefordert, sich zu opfern. Das ist ein grosser Unterschied. Der Frau wird (noch) nicht zugestanden, selbst aktiv zu werden. Aber opfern soll sie sich sehr wohl, und sie soll passiv alles hinnehmen, was über sie verfügt wird. Dagegen begehrt Lucia auf.
Als sie keinen anderen Ausweg mehr sieht, nimmt Lucia zwar hin, was über sie verfügt wird und willigt in die Hochzeit ein – sie wird aber in der Hochzeitsnacht wahnsinnig und bringt ihren Bräutigam Arturo um.
Es gibt eine Vorgeschichte, die in der Oper nur am Rande erzählt wird. Daraus geht hervor, dass Edgardo und Lucia sich von früher kennen. Lucia war eines Tages von einem wilden Stier angegriffen worden; Edgardo hat sie damals offenbar beschützt und diesen Stier umgebracht. Natürlich haben wir uns sofort gefragt, wo in Schottland wilde Stiere herkommen – das Hochlandrind gilt ja eher als gutmütig... Das hat uns zu der Frage geführt, was genau in dieser Familie vorgefallen ist, wovor dieses kleine Mädchen Lucia eigentlich beschützt werden musste. Offenbar gibt es in Lucias Kindheit ein Trauma. Ein Erlebnis auch, auf das sie und Edgardo immer wieder zurückkommen.
Überhaupt spürt man an jeder Stelle, dass hier von einer jüngeren Generation die Rede ist, deren Leben von der Vätergeneration schon verbrannt wurde. Lucia, ihr Bruder Enrico und Edgardo tragen die Last dessen, was ihre Vorfahren verschuldet haben, immer noch auf den Schultern. Sie hassen einander und wollen Rache üben für längst Vergangenes.
Diese Familiengeschichte, die eingebettet ist in einen grösseren politischen Kontext, ist zeitlos. Das trifft uns ganz direkt.
Was erfahren wir über diese Elterngeneration?
Wir wissen, dass die Familie Lucias und Enricos, die Ashtons, zunächst vom Bürgerkrieg profitiert haben. Ihnen fielen die Besitztümer der Ravenswoods zu, die offenbar auf der Seite Maria Stuarts gekämpft haben. Edgardo spricht davon, dass er sich der Opposition in Frankreich anschliessen möchte.
Nun sind die Ashtons aber ebenfalls im Niedergang. Die Tatsache, dass die Oper in einer Zeit spielt, in der die Beziehung von Vater und Sohn sehr hochgehalten wird, und zwar als innige Freundschaftsbeziehung, findet in dem verzweifelten Versuch Enricos, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten, einen Widerhall. Es gibt aus der Renaissance innige Briefwechsel zwischen Vätern und Söhnen, nicht aber zwischen Müttern und Töchtern. Dazu passt, dass Lucias verstorbene Mutter im Roman von Walter Scott als eiskalte, machtbesessene Frau beschrieben wird, die zwar Geld und Titel in die Familie eingebracht hat, aber wenig Liebe oder Interesse für die eigenen Kinder.
Was bedeutet Lucias Tod angesichts all dieser Prägungen und Verstrickungen? Lässt sich diesem Tod etwas Positives abgewinnen?
Unbedingt. Die Welt, in der Lucia lebt, ist ja nicht auszuhalten. Mit ihrem Tod tritt sie aus der Welt. Und die Oper endet ja nicht nur mit ihrem Tod, Edgardo folgt ihr. Man hat das Gefühl, als würden diese beiden Figuren einen anderen Raum betreten und entscheiden, sich dem ganzen Wahnsinn zu entziehen.
Steckt für dich in diesem Stück auch eine Art Utopie?
Ich würde gar keine Oper anfangen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, da steckt auch ein bisschen Utopie drin!
Ist «Lucia di Lammermoor» also mehr als ein Vehikel für Belcanto-Sängerinnen, um ihre Virtuosität unter Beweis zu stellen?
Es ist absolut faszinierend, wie man in dieser Oper an jeder Stelle spürt, dass die Koloraturen eben nicht einfach Dekoration und nur schöne Musik sind, sondern Inhalt und Substanz haben. Im Gesang steckt die Möglichkeit, sich in dieser verrückten Welt einen Platz zu schaffen, sich seine Freiheit zu erobern, Widerstand zu leisten, sich als Individuum zu behaupten, mit der Geschichte und dem Schmerz, den man in sich trägt. Lucia erhebt ihre Stimme. In ihrer Wahnsinnsarie schafft sie es, über ihren persönlichen Schmerz hinauszugehen und aufzuzeigen, was in dieser Welt alles nicht gut ist. Es ist wie ein Freilegen von Strukturen. Es gibt ja Chaos-Theorien, die besagen, Chaos sei nur die Überlagerung verschiedener Ordnungen. So ähnlich empfinde ich auch dieses Stück: Es gibt ganz viel, das sich gegenseitig überlagert, immer nur in halben Sätzen auftaucht und nie ganz ausgesprochen wird. Erst in diesem Wahnsinn kurz vor Schluss des Stückes wird alles offengelegt.
Du hast gesagt, die Welt, in der Lucia lebt, ist nicht auszuhalten. Ist sie für Lucias Wahnsinn mitverantwortlich?
Der Wahnsinn steckt in einer Gesellschaft und in einem Land drin, in dem es einen Bürgerkrieg gegeben hat. Das ist etwas völlig anderes, als wenn zwei Länder gegeneinander kämpfen. Im eigenen Land können sich plötzlich die Menschen, die früher Nachbarn waren, nicht mehr in die Augen schauen, nicht mehr miteinander reden, plötzlich ist so viel Hass da.
Jeder strampelt verzweifelt, um den eigenen Stand zu erhalten, selbst innerhalb der Familie wird darum gekämpft, wer eigentlich der nächste Boss wird. Und ob Enrico überhaupt geeignet ist, diese Familie in eine rosige Zukunft zu führen? Vielleicht wäre ja Normanno, der offenbar zu brutaleren Methoden fähig ist, das bessere Familienoberhaupt?
Und dann holt man einen Bräutigam von ausserhalb, der das grosse Geld bringen soll, aber dieses Land gar nicht versteht. Er kommt dort hin wie ein Fremder, wie ein Tourist. Man empfängt ihn mit offenen Armen, weil man das Geld braucht, aber den Menschen verachtet man im Grunde zutiefst.
Dazu kommt, dass Lucia kaum je Privatheit zugestanden wird….
Ja, sie steht unter Beobachtung, so wie hier überhaupt jeder jeden bespitzelt. Gleich zu Beginn erleben wir, dass der ganze Herrenchor Enrico erzählt, wie sich Lucia in Edgardo verliebt hat. Das junge Mädchen ist offenbar die ganze Zeit belauscht worden. Ohne ihre Anstandsdame Alisa kann Lucia keinen Schritt machen, und selbst die vermeintliche Vertrauensperson Raimondo stellt sich auf die Seite des Bruders und setzt Lucia mit Argumenten der Religion unter Druck. Das sind Zustände zum Wahnsinnigwerden! Um Lucia herum läuft diese ganze perfekt schnurrende Hochzeitsmaschine, ohne dass sie etwas davon weiss. Gerade noch fordert ihr Bruder Enrico, sie solle ihn durch eine Heirat retten, und plötzlich sind die Gäste schon vor der Tür.
Wie bringt ihr diese beengte Welt auf die Bühne?
Mit dem Team Klaus Grünberg, Anne Kuhn und Silke Willrett arbeite ich schon sehr lange zusammen. Was ich an Klaus’ Räumen so liebe, ist, dass sie die Fähigkeit haben, ganz real zu sein, aber auch plötzlich abheben und schweben können. Dann werden die Räume zu inneren Räumen, wo Zeit und Raum auf eine verblüffende Art und Weise miteinander verknüpft werden. Unsere Bühne ist wie eine kleine Zauberkiste. Man kann sie zunächst begreifen als eine labyrinthische Architektur, man kann bestimmte Wechsel in dieser Drehbühne aber auch als einen Sprung in der Zeit verstehen. Es wird viel aus der Erinnerung heraus erzählt und an einigen wenigen Stellen sogar in die Zukunft gedacht. Wir schauen im Grunde immer in denselben Raum, aber mit leichten Verschiebungen.
Wie gesagt: In der Cromwell-Zeit und danach hat sich das Individuum ganz neu entdeckt und definiert. Individualität spielt plötzlich eine ganz andere Rolle. Es ist auch die Zeit, in der das Kabinett sehr wichtig wird und der versteckte Garten, weil das die Orte sind, an denen man seine Individualität pflegen und sich heimlich begegnen kann.
Diese auf den ersten Blick realistischen Räume können also auch ins Surreale kippen…
Das ist es doch, was die Oper zu einer ganz besonderen Kunstform macht: Oper lässt durch die Musik Zeit ganz anders fliessen. Manchmal passiert in wenigen Minuten und wenigen Takten sehr viel, manchmal ist es aber auch so, dass Musik den Figuren Raum gibt, nach innen zu schauen und an einem Gedanken länger festzuhalten. Das ermöglicht es, etwas über die inneren Zustände der Figuren zu erzählen, vielleicht sogar über eine surreale Szene den inneren Raum einer Figur zu betreten und durch ihre Augen zu blicken oder über die Erinnerung der Figur etwas darüber zu verstehen, was in diesem Moment für sie so schmerzhaft ist.
Auch für das Kostüm hat uns diese Art der Offenheit interessiert. Auch wenn wir die Figuren von heute aus denken, fanden wir es wichtig, mit Hilfe des historischen Zitats eine weitere Dimension zu eröffnen.
Lucia wird wahnsinnig und ersticht ihren Bräutigam. Sie ist also nicht nur eine psychisch kranke Frau, sondern eine Mörderin. Wie kommt es also, dass wir sie trotzdem als Opernheldin so lieben?
Ja, Lucia wird zur Täterin, aber auch die anderen Figuren sind sowohl Täter als auch Opfer. Das macht die Sache so faszinierend und auch so tragisch – niemand kann aus seiner Haut. Enrico, der seiner Schwester das alles antut, ist genauso hilflos und verzweifelt wie sie. Man spürt an vielen Stellen, dass er eine grosse Liebe und Zärtlichkeit für sie hat und dass er sich auch ein besseres Leben für sie wünschen würde. Donizetti zeigt wunderbar, was für ein Druck auf Enrico liegt, und dass er der Verantwortung eigentlich nicht wirklich gewachsen ist. Ein japanischer Modedesigner hat mal gesagt, er würde gern mit seiner Mode erreichen, dass die Frauen immer gleichzeitig sehr zerbrechlich und sehr stark wirken. Lucia ist auch beides. Sie ist sehr angreifbar, sehr allein in diesem Leben, sehr zerbrechlich; gleichzeitig hat sie aber auch einen unglaublich starken Willen und eine grosse innere Kraft. In ihrem Wahnsinn steckt auch eine Klarsicht, Hellsicht, eine uralte Weisheit. Die Strukturen bringen Lucia zum Zusammenbrechen, aber gleichzeitig muss auch alles um sie herum zusammenbrechen. Das ist es, was wir an dieser Figur so lieben: Sie gibt sich nicht zufrieden, fügt sich nicht passiv in ein Schicksal, sondern kämpft dagegen an.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach
Foto: Herwig Prammer
Durch Blutvergiessen wird nichts abgewaschen
In Donizettis «Lucia di Lammermoor» wütet die Rache. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer untersucht in der aktuellen Folge unserer MAG-Kolumne «Auf der Couch» Art und Wirkungsweise dieser zerstörerischen menschlichen Emotion und zeigt auf, wie sie besiegt werden kann. Lesen
In Don Pasquale lässt Donizetti die Liebe durch eine Intrige siegen. Das romantische Paar spielt mit den feudalen Traditionen und setzt sie ausser Kraft. Am Ende darf der vertrottelte Patriarch froh und dankbar sein, den Ansprüchen einer kecken jungen Frau zu entkommen.
Lucia will sich ihrer Liebe hingeben, die sich einer Familienfehde widersetzt. Aber sie kann nicht gewinnen. Ihr Bruder und ihr Lehrer verraten sie. So siegt am Ende die Rache über eine Liebe, die versprochen hatte, sie ausser Kraft zu setzen. Lucia wird im Wahnsinn selbst zur Rachegöttin.
Man könnte behaupten, dass die Begabung zur Rache den Menschen vom Tier unterscheidet. Sie gleicht in diesem Punkt der ebenfalls typisch menschlichen Entscheidung, ein Werkzeug festzuhalten. Menschenaffen lassen den Knüppel wieder fallen, mit dem sie ein Raubtier vertrieben haben. Der Mensch beschliesst, ihn nicht mehr loszulassen, wie er auch die Kränkung nicht mehr loslassen kann – obwohl er doch weiss, dass seine Rache mit dem Feind oft auch ihn selbst zu vernichten droht. Der erniedrigte Sklave träumt davon, seine Schmach «mit Blut abzuwaschen». Der geprügelte Hund ist Realist, er wartet, dass Herrchen wieder den Fressnapf füllt.
Im 19. Jahrhundert beginnt die Aufklärung, das Prinzip der Rache zu reflektieren und auch zu kritisieren. Ein Schlüsseltext ist hier Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas mit der Frage, ob eine so gute Eigenschaft wie der Gerechtigkeitssinn einen bisher tugendhaften Menschen in einen Mordbrenner verwandelt kann. Die bürgerliche Gesetzgebung verbietet das Duell, in dem Beleidigungen gerächt werden, und monopolisiert die Gewalt. Das Thema prägt nun die populären Romane: Prosper Mérimée, Karl May, Alexandre Dumas und Walter Scott variieren es in allen möglichen Gestalten, bevorzugt in den dark and bloody grounds, sei es der Geografie, sei es der Geschichte. Die Blutrache der Clans, vor deren Hintergrund Walter Scott das tragische Schicksal Lucias stellt, ist ein dämonisches Überbleibsel, eine Kulisse des Archaischen, vor der sich im Roman des 19. Jahrhunderts die individualisierte Liebe entfaltet. Lucia hat sich in Edgar verliebt und ihm Treue geschworen. Edgar hat sie aus Todesgefahr errettet, einen wilden Stier erschlagen, der die am Grab der Mutter trauernde Jungfrau angriff. Ihre Liebe ist so innig, so umfassend, dass sich Edgar anstecken lässt und sein Rachewunsch gegen Lucias Bruder verstummt, seinen Erzfeind, der ihm den Vater und den Besitz geraubt hat. Lucia und Edgar schwören sich ewige Treue und tauschen Ringe, als Edgar Lucia für eine politische Mission verlässt, die ihn nach Frankreich führt.
Lucias Bruder Lord Ashton tut nun alles, um seine Schwester gegen Edgar einzunehmen. Er fälscht Briefe, die belegen sollen, dass Edgar in Frankreich eine andere geheiratet hat. Er bedrängt Lucia, ihm durch eine arrangierte Ehe in politischer Gefahr beizustehen, denn er hat auf die falsche Partei gesetzt und muss um seine Güter fürchten. Sie soll Lord Arturo Bucklaw heiraten, einen angesehenen Adeligen, der die Ashton drohende, königliche Ungnade aufheben kann. Lucia steht zwischen ihrem Bruder und der Treue zu ihrem verleumdeten Verlobten. Der Bruder droht, allein ihre Ehe mit Arturo können ihm das Leben retten. Auch ihr vertrauter Lehrer, der fromme Raimondo, rät ihr dringend, sich für die Interessen des Clans zu opfern. Von allen Seiten bedrängt, erklärt sich Lucia endlich nach langem Zögern, tief traurig und verstört zum Treuebruch bereit, den ihr Raimondo schönredet: Was kein Priester gesegnet hat, das gilt auch nicht! Zur Hochzeit erscheint Edgar. Er ist aus Frankreich zurückgekehrt und muss zur Kenntnis nehmen, dass Lucia den Ehevertrag eigenhändig unterschrieben hat.
Während Lucia lange grübelte und immer noch unsicher ist, will Edgar von Aufklärung nichts wissen, fragt nicht nach Gründen, schneidet Lucia das Wort ab, weiss gleich Bescheid. Er hat im Nu das Reich der Empathie wieder verlassen und ist wieder zuhause in Rache und Wut. Er fordert seinen Ring zurück, tritt ihn in den Staub und verflucht Lucias Untreue. Raimondo hindert die rasch wieder von Erzfeindschaft und Blutrache besoffenen Männer mit Mühe daran, sich schon während der Hochzeitsfeier totzuschlagen. Edgar entkommt und bereut den Verrat an der Liebe zu Lucia. Lucia tötet ihren Bräutigam Arturo Bucklaw in der Hochzeitsnacht mit dessen eigenem Schwert. Sie stirbt im Wahnsinn; auf diese Nachricht hin erdolcht sich Edgar.
Liebe siegt über die Rache, Verrat über die Liebe, niemand scheint zu begreifen, was allein Lucia vertritt: Durch Blutvergiessen wird nichts abgewaschen, im Gegenteil. Lucia di Lammermoor ist keine Geschichte für zarte Nerven. Lucias Wahnsinn lässt an den Satz von Lessing (in Emilia Galotti) denken: «Wer über gewisse Dinge seinen Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren.» Das Zitat passt fatal genau, denn auch in Lessings Tragödie geht es um den Widerspruch zwischen korrupter Macht und Empathie. Lucia hat eine Menge Mut und Verstand zu verlieren; in ihrer wilden Tat wird man mit dem heute möglichen, kritischen Blick auf eine von Männern dominierte Welt eine wütende Gerechtigkeit sehen. Arturo ist kein zufälliges Opfer, er steht für die rücksichtslose Machtgier und dumme Kränkbarkeit der beiden anderen Männer, des Bruders und des Geliebten.
Alle drei haben nicht die geringste Ahnung von den Empfindungen der Frau, derer sie sich bemächtigen wollen. Am Ende trifft das Schwert den, an dem Lucia am wenigsten hängt und der ihr mit den ekelhaftesten Gründen auf den Leib rückt. Nur im Wahnsinn kann Lucia klarstellen, wie sehr ihr die blinde Rachsucht und das Intrigenspiel um sie herum auf die Nerven gehen. Als es zu spät ist, begreifen die Männer, was sie angerichtet haben, und es tut ihnen fürchterlich leid. Auch das kommt uns bekannt vor.
Donizetti hat Lucias Wahnsinn eine der schönsten Arien der Operngeschichte gewidmet, in der sich der Zauber ihrer unsterblichen Liebe manifestiert. Die romantische Liebe ist unzerstörbar, weil sie auch noch in ihrer absoluten Niederlage triumphiert.
Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor
Illustration: Anita Allemann
Und dann kommt Fantasie hinzu
Unser Autor Volker Hagedorn hat Irina Lungu zum Gespräch getroffen, die in unserer «Lucia di Lammermoor» die Titelrolle singt. Die Russin, die sich Italien zur Wahlheimat erwählt hat, erzählt, wie sie wurde, was sie ist – ein Sopran von internationalem Format. Lesen
Sie war in Sidney, als der «globale Wahnsinn» begann, wie sie es nennt. Und sie war in Moskau, als es, mehr als ein Jahr später, allmählich wieder Auftritte gab und an einem Tag zwei Anrufe kamen. Zuerst eine kurzfristige Absage aus Mailand, der Wahlheimat von Irina Lungu, wo auch ihr elfjähriger Sohn zur Schule geht. Dann füllte ein Anruf aus Zürich die frisch in den Kalender gerissene Lücke. Ob sie als Lucia einspringen könne? Mit Speranza Scappucci als Dirigentin? «Ich war begeistert», sagt sie, «weil ich das Stück gerade mit Speranza gemacht hatte.» Das war in Tokio, kurz vor Moskau.
Wenn man selbst es schon aufregend findet, endlich mal wieder von Deutschland in die Schweiz zu reisen, kann einem leicht schwindlig werden angesichts solcher Flugrouten, ganz abgesehen von den stimmlichen Mitteln dieser Sängerin, die sich oberhalb der Reiseflughöhe bewegen. Aber gerade um ihre Stimme hat sich Irina Lungu grosse Sorgen gemacht, wie sie in der Zürcher Opernkantine erzählt, kurz vor einer Bühnenprobe für Lucia di Lammermoor. Nicht genug damit, dass wie bei allen auftretenden Künstlern auch bei ihr der Kalender plötzlich aus weissen Flecken bestand – sie konnte nicht mal üben.
In Mailand werkelten die meisten Nachbarn im Homeoffice und hätten es nicht wirklich zu schätzen gewusst, eine der besten Belcanto-Interpretinnen der Welt mit voller Stimme an ihren Partien arbeiten zu hören, und auch Studios konnte man nicht mehr mieten. «Natürlich geht dann etwas verloren! Die Stimme ist ein Instrument, sie muss geübt werden.» Und selbst wenn das möglich ist, fehlt immer noch die Verbindung mit einem Orchester. Im rappelvollen Terminkalender vor Coronas Regentschaft gehörte die ja zur täglichen Praxis.
In Tokio ging es los mit strengster Quarantäne, zwei Wochen im Hotelzimmer, «ich hatte solche Angst vor meiner ersten Probe mit Bühne und Orchester! Stellen Sie sich vor, ein Läufer wird auf zehn Quadratmetern eingesperrt, zwei Wochen später macht man die Tür auf und sagt, lauf zehn Kilometer! Keiner kann das. Offenbar versteht niemand, was Sänger brauchen, um singen zu können.» Das sagt sie, ohne ihre leise, entspannte, warme Sprechstimme zu erheben, kein bisschen ereifert, aber sehr ernst und entschlossen.
Entschlossenheit spielt in ihrem Leben eine grosse Rolle. Vor 23 Jahren war sie eine junge russische Musikschullehrerin in Woronesch, 500 Kilometer südlich von Moskau, und «beschloss, etwas zu ändern». Irina war achtzehn, spielte Klavier wie ihre Mutter, unterrichtete Kinder, sang im Chor und war Chordirigentin. Nach einer Begegnung mit dem Bariton Michail Podkopajew, Professor am Konservatorium, war sie «total verliebt, künstlerisch gesagt, und dachte, der müsste ein toller Lehrer sein». Solistin wollte sie werden.
Der 39-jährige Sänger hielt davon gar nichts. Zu kleine Stimme, gut für den Chor! Sie liess nicht locker. «Ich ging da jeden Tag hin, machte einfach Druck, dann fing er an, mir Tipps zu geben. Irgendwann durfte ich an einem Vorsingen teilnehmen und wurde in seine Klasse aufgenommen. Er hat mir später gesagt, dass das für ihn eher ein Witz war. Er war nicht optimistisch in Bezug auf meine Qualität. Aber ich antwortete so gut auf seine Fragen, dass er dachte, vielleicht ist an der doch was dran. Ich studierte fünf Jahre lang bei ihm, sehr hart.»
Schon im zweiten Studienjahr gewann sie «wie aus dem Nichts» ihren ersten Wettbewerb, und dann räumte sie ab, es folgte ein Preis nach dem anderen, in Moskau, Dresden, Athen, Wien… Sie hatte schon in Bologna auf der Bühne gestanden, als sie 2003 für die Accademia der Mailänder Scala vorsang, die Talentschmiede. «Ich fuhr hin mit 400 Euro in der Tasche und war nicht ängstlich, auch nicht bei einem wie Riccardo Muti. Jetzt bin ich nicht mehr so», sie lacht mit sanftem Übermut. «Singen fiel mir leicht, und ich glaubte einfach, die beste Sängerin der Welt zu sein.» Manche entspannen sich ja, indem sie sich einfach gar keine Chancen ausrechnen, bei ihr funktionierte es umgekehrt.
Sie wurde aufgenommen; drei Monate später debütierte sie als Anaï in Rossinis Moïse et Pharaon in der Scala. Mit 27 sang sie dort ihre erste Violetta, eine der ganz grossen Rollen, auf die noch immer der Schatten der Callas fällt. Aber der eiferte Irina Lungu nicht nach. «Was es heisst, eine belcanto diva zu sein, konnte ich bei Leyla Gencer sehen.» Die legendäre türkische Sopranistin, damals schon Mitte siebzig, war für einige Zeit ihre Lehrerin. «Es bedeutet eben nicht, in der Öffentlichkeit crazy things zu machen. Es meint Atemstil, Delikatesse, Stärke, Melancholie, Virtuosität und die Art, alle diese Dinge zusammenzubringen.»
Und damit ist sie schon in einer Definition von belcanto, vom «schönen Gesang», die von der Technik fast zur Weltanschauung führt. Es geht nicht nur darum, den Klang sul fiato hervorzubringen, auf dem Atem, nicht nur um attacco puro, den reinen, klaren Tonansatz, sondern auch darum, «deine Emotionen für eine Weile in die Tasche zu stecken, richtig zu singen und sie erst dann hinzuzufügen, und dann wird es natürlich gemischt. Dann kannst du zum Publikum sprechen, indem du singst. Belcanto ist der einzige und einzig richtige Weg zu singen», sagt sie so eindringlich, als müsse sie einen Ungläubigen bekehren. «Nur so kann eine Stimme sich entwickeln und natürlich werden.»
Die Bedingungen dafür sieht Irina Lungu allerdings gefährdet. «Es gibt eine total andere Art zu spielen, auf der Bühne zu sein, more expressive, because we had the great development of…», nun folgt der einzige deutsche Begriff in ihrem italienisch durchsetzten Englisch, «Regietheater». Sie findet es gut, Stücke aus einem Kontext in einen anderen zu bringen, aber nur, «wenn der Regisseur an die Komplexität der Beziehungen der Charaktere untereinander denkt» und nicht das Singen der szenischen Aktion geopfert wird. Das geschehe häufig, während immer weniger Dirigenten sich für Klangqualitäten interessierten.
«Es wurde wichtig, lauter zu sein, präzise im Rhythmus, aber selten arbeitet ein Dirigent mit mir an Süssigkeit, Melancholie, Pathos, all dem, was in der Stimme ist und über sie vermittelt werden kann.» Um so glücklicher ist sie mit dem Team in Zürich, zumal sie sich gerade in dieser Rolle als «vollständiger Sopran» erlebt: «Lucia hat alle Arten von Ausdruck, die ein lyrischer Sopran haben sollte.» Freilich auf der Basis von Konflikten, die längst Geschichte sind, wie die all der Opferfrauen in den Opern des 19. Jahrhunderts. Welcher Bruder befiehlt im Jahr 2021 noch seiner Schwester, wen sie zu heiraten habe? «This couldn’t happen in our days, but it could happen in other ways. Viele Leute können psychisch manipuliert werden, das ist nur nicht so offenkundig. Mir ist das auch einige Male passiert, ohne dass es mir gleich bewusst wurde.»
Als Lucia sich rächt, gilt sie als wahnsinnig. Aber als ich in der Probe sehe, wie Lucia um die Ecke biegt, Irina Lungu unverändert in Alltagskluft, zierlich, blasses Gesicht unter schwarzem Haar, den schon angestochenen Bräutigam sanft vor sich herschubsend, ehe sie ihn vor versammelter Gesellschaft mit fast beiläufigem Schnitt ins Jenseits schickt, und höre, mit welcher Genauigkeit und Intensität diese Lucia zugleich die Hochzeit mit ihrem wahren Geliebten beschwört, wird aus dem Wahnsinn eine höchst bewusste Tat, voller Verachtung für die Idioten ringsum, und ein Dialog mit einer Gesellschaft der Zukunft.
Statt des Orchesters spielt im Graben ein Pianist, und Irina Lungu kann durch die behördlich verordnete Maske nur mit halber Stimme singen. Und doch herrscht Klarheit, seit sie da ist. «Unsere ganze Erfahrung im Leben», hat sie in der Kantine gesagt, «hilft uns beim Interpretieren unserer Charaktere. Dann kommt Fantasie dazu, denn man hat ja nicht mit allem Erfahrung. Zum Beispiel,» fügte sie mit leisem Lachen hinzu, «jemanden zu töten».
Volker Hagedorn
Foto: Herwig Prammer
Piotr
Beczała
Beczała
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Aus der verrückten Welt von Corona! Ich bin zwar überraschenderweise sehr viel unterwegs gewesen in der letzten Zeit, und ich konnte – im Vergleich zu anderen Kolleginnen und Kollegen – relativ viel arbeiten. Aber jetzt freue ich mich sehr, hier in Zürich zu sein und mich auf eine richtig tolle Arbeit konzentrieren zu können.
Auf was freuen Sie sich in der «Lucia»-Produktion?
Das ist wahrscheinlich meine allerletzte Lucia di Lammermoor, denn ich wechsle jetzt das Repertoire und werde mich eher dem schwereren Fach zuwenden. Edgardo aus Lucia war eine meiner Paraderollen. Das ist also auch ein kleiner Abschied für mich. Deshalb freue ich mich, dass ich diesen Abschied hier in Zürich, in einer tollen Umgebung und mit fantastischen Kolleginnen und Kollegen begehen kann und mit einer Inszenierung, die Spass macht. Ich habe die Rolle wirklich oft gesungen und das Stück aus den verschiedensten Perspektiven kennengelernt. Diese Inszenierung gefällt mir, weil sie modern ist, aber nicht so modern, dass man darüber als Sänger beunruhigt sein müsste. Ich war auch darauf vorbereitet, dass die ganze Produktion abgeblasen wird, und zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte das tatsächlich passieren. Umso mehr freue ich mich jetzt darüber, dass wir diese Inszenierung auf die Bühne bringen können.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Besonders wichtig war für mich die Begegnung mit einer meiner Professorinnen, Sena Jurinac. Ich war damals Student in Polen und wurde von ihr zu Meisterklassen in die Schweiz und nach Frankreich eingeladen, und sie hat mir die Augen geöffnet – in Bezug auf das Repertoire, das ich damals gesungen habe, aber auch im Hinblick auf die westliche Welt. Die Situation auf dem musikalischen Markt in Polen war in den 80er Jahren sehr anders als in Westeuropa. Und als Student, der in ein paar Jahren ins Berufsleben eintreten sollte, musste ich ein bisschen umdenken. Sie hat mir dabei sehr geholfen. Ausserdem hat sie mich vom Verismo weggebracht und zu Mozart hingeführt. Für einen Sänger Anfang 20 kann es sehr schädlich sein, Partien wie Cavaradossi in Tosca zu singen. Tamino in der Zauberflöte ist zwar schwierig, aber nicht gefährlich, sondern im Gegenteil sehr gut für die Entwicklung der Stimme. Ich verdanke dieser Professorin mein sängerisches Leben.
Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?
Ich lese sehr viel und sehr schnell, ich habe eine komplett überfüllte Bibliothek. Aber es gibt schon ein paar Bücher, zu denen ich immer wieder gern zurückkehre. Der kleine Prinz zum Beispiel, das begleitet mich schon sehr lange. Ausserdem mag ich Paolo Coelho, es gibt ein paar sehr intelligente Bücher von ihm. Vor kurzem habe ich Olga Tokarczuk wiederentdeckt, eine polnische Schriftstellerin, die 2019 den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Bei ihr musste ich regelrecht auf die Bremse treten beim Lesen, das ist so ein intelligentes Schreiben, da muss man sich mit jedem Satz, sogar mit jedem Wort befassen.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Ich höre selten Musik. Wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste und nur ein Musikstück mitnehmen dürfte, dann würde ich die Bohemian Rhapsody von Queen mitnehmen. Das ist ein echtes Meisterwerk für mich.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Aus Paris habe ich eine Skulptur mitgebracht, in die sich meine Frau verliebt hatte. Sie trägt den Titel «Reunion». Es sind zwei Menschen, die sich gegenseitig Halt geben. Die Skulptur stammt von einer afrikanischen Künstlerin, auf deren Ausstellung wir in einem Hinterhof in Paris ganz zufällig gestossen sind. Die Künstlerin haben wir auch kennengelernt und uns sehr nett mit ihr unterhalten. Ich hätte gern noch mehr Skulpturen von ihr mitgenommen, aber leider war unser Auto nicht gross genug.
Mit welchem Künstler würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Ich bin ein sehr grosser Fan von Fritz Wunderlich. Leider ist er sehr früh gestorben. Seine Witwe habe ich kennengelernt, wir haben uns prächtig unterhalten und waren bis zu ihrem Tod miteinander befreundet. Fritz Wunderlich war ein sehr lustiger Mann, wir würden uns bestimmt gut verstehen. Ich hätte viele Fragen an ihn, natürlich über Gesangstechnik, aber auch über sein verrücktes Leben. Er ist nur 36 Jahren alt geworden, hat aber sehr viel geschafft – künstlerisch, aber auch privat, denn er hatte ja eine Familie mit drei Kindern. Mich würde interessieren, woher er die Energie dafür hatte. Das war eine beeindruckende Lebensleistung.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
In letzter Zeit hatte ich ein paar Zweifel, ob das Leben eigentlich einen Sinn hat. Wir Künstler fühlten uns während dieser Corona-Zeit von vielen Seiten im Stich gelassen. Und ich dachte manchmal: Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, sich etwas ganz anderem zu widmen. Eine Bäckerei eröffnen zum Beispiel – essen muss man immer… Musik und Kunst hingegen scheinen heutzutage für viele nicht unbedingt notwendig zu sein, diesen Eindruck hat jedenfalls die Politik vermittelt. Das Wichtigste und Notwendigste für mich sind Freundschaften. Und ein gutes Glas Wein kann dabei nicht schaden. Obwohl – Lucia di Lamermoor spielt ja in Schottland, also müsste ich sagen: ein gutes Glas Whisky!
Piotr Beczała ist auf den wichtigsten Opernbühnen der Welt zuhause und dem Opernhaus Zürich seit vielen Jahren verbunden. Hier war er zuletzt als Des Grieux in Massenets «Manon» und als Prinz Suo-Chong in Lehárs «Land des Lächelns» zu erleben.

Der Klang
der
anderen Welt
der
anderen Welt
Eine geniale Stelle in Donizettis «Lucia di Lammermoor» Lesen
Ein Mann hat seine Karriere durch politisch unkluges Handeln in Gefahr gebracht und sieht nur eine Rettung aus der Not: Seine Schwester muss seinen Gönner ehelichen. Durch gefälschte Dokumente von der Untreue ihres Geliebten überzeugt, willigt sie ein, sich für den Bruder zu opfern. Ihr Geliebter verflucht sie wegen des vermeintlichen Verrats, sie verfällt dem Wahnsinn, tötet im Hochzeitsbett den verhassten Ehemann und stirbt, ohne aus ihrem Wahn zu erwachen.
Walter Scott, der einst überaus beliebte, inzwischen nicht ganz zu Recht kaum noch gelesene Verfertiger zahlloser Romane, erfand diese Story, die sich wie das Exposé einer italienischen Oper ausnimmt – und tatsächlich heute wohl vergessen wäre, wenn Gaetano Donizetti sie nicht als solches verwendet hätte, um auf dieser Grundlage eine seiner musikalisch reichsten Opern zu schaffen, die bis heute einen festen Platz im Repertoire hat.
Vor allem hat ihn offensichtlich der Auftritt der wahnsinnigen Titelheldin inspiriert, die, mit dem Blut ihres Gatten befleckt, die Hochzeitsgäste in Schrecken versetzt. Er schuf für diese Wahnsinns-Szene eine Musik von so berührender Zartheit und so ergreifender Tiefe, dass sie unumstritten als eine der ganz grossen Meisterwerke der Operngeschichte gilt: ein Paradestück für Sopranistinnen, aber eines, mit dem sie nicht nur ihre «geläufige Gurgel» präsentieren, sondern vor allem ihre sängerische Virtuosität einsetzen können, um das Zerbrechen einer liebenden Seele an einer lieblosen Umwelt zu schildern. Jeder Opernfreund kennt diese Szene, hat sie immer wieder in verschiedensten Interpretationen gehört und gesehen, und doch – nur wenige kennen sie so, wie Donizetti sie konzipiert hat, ja vermutlich hat nicht einmal er selbst sie je so gehört. Denn schon bei der Uraufführung wurde das vorgesehene seltene Soloinstrument gegen ein gebräuchlicheres ausgetauscht.
Dabei dürfte es Donizetti kaum um den spektakulären Effekt beim Einsatz einer Glasharmonika gegangen sein, sondern vielmehr um die besondere Aura von zarter Empfindsamkeit an der Grenze zum Wahnsinn, die dieses Instrument umgibt. Die rührt vor allem daher, dass der Klang sich in Frequenzbereichen bewegt, in denen das Ohr sozusagen «orientierungslos» ist, so dass die Musik von überallher zu kommen scheint. So kann die Glasharmonika den unwirklichen Klang der anderen Welt hörbar machen, in die Lucias Seele sich geflüchtet hat. Da dem Instrument aber auch eine grosse Nähe zur menschlichen Stimme nachgesagt wird, ist es geeignet, den Dialog Lucias mit sich selbst, den sie als Gespräch mit dem Geliebten erlebt, unmittelbar sinnlich erfahrbar zu machen: den kurzen Augenblick des erträumten Glücks mit eben jenem Mann, der sie so brutal zurückwies, als sie ihn am meisten gebraucht hätte, und sie damit in den Wahnsinn gestürzt hat. In seiner Liebe für die Erniedrigten und Beleidigten, die in einer lebensfeindlichen Umwelt gerade wegen ihrer Liebesfähigkeit zugrunde gehen, umgibt Donizetti seine kleine Heldin bei ihrem Abschied vom Leben mit einer sanft schillernden Klangwolke.
Aber der Opernbetrieb zu Donizettis Zeiten hatte für solche Extravaganzen keinen Raum. Die Glasharmonika war aus der Mode, kaum jemand konnte sie noch spielen, also wurde sie kurzerhand durch eine Soloflöte ersetzt. Der Klang ist tatsächlich ähnlich, aber – wer die Szene einmal so gehört hat, wie Donizetti sie konzipierte, weiss: Mit der Soloflöte ist es eine tief rührende Szene, mit der Glasharmonika aber gewinnt sie eine herzzerreissende Schönheit und erweist sich als – geniale Stelle.
Werner Hintze
Zu weiblichen Figuren spüre ich eine besondere Verbindung
Die italienische Dirigentin Speranza Scappucci steht in «Lucia di Lammermoor» am Pult der Philharmonia Zürich. Ein Gespräch über die psychologischen Qualitäten von Donizettis Begleitfiguren, den Klang des Wahnsinns und warum die Belcanto-Oper aus dem 19. Jahrhundert gar nicht weit weg ist von unserem heutigen Empfinden. Lesen
Speranza, du hast Donizettis «Lucia di Lammermoor» erst kürzlich in Tokio dirigiert und früher als Pianistin sehr häufig korrepetiert. Was fasziniert dich an diesem Stück?
Für mich ist diese Oper zuallererst modernes Musiktheater. Unter Belcanto stellen wir uns immer vor, dass es eigentlich nur um schöne Melodien geht. Aber Lucia di Lammermoor ist viel mehr als das! Donizetti gelingt es zum Beispiel, Situationen zu schaffen, in denen sich die inneren Zustände der Figuren in der Natur spiegeln. Ich denke da an die Turm-Szene im dritten Akt, wenn Enrico und Edgardo sich zum Duell verabreden. Die Natur ist in Aufruhr, draussen wütet ein Sturm, den die Musik virtuos zum Ausdruck bringt und damit auch zugleich Einblick in das Innere der beiden Figuren gewährt. Es geht hier um Situationen, zu denen wir uns in Beziehung setzen können. All das, wovon diese Oper handelt, ist gar nicht so weit von uns entfernt: emotionaler Aufruhr, rasende Eifersucht, der Versuch des Bruders, seine Schwester zu kontrollieren.
Das Stück ist übrigens sehr modern auch in dem Sinne, dass Donizetti hier die Türen zu Verdi schon weit aufstösst. Die Klangfarben, die Donizetti in der Einleitung verwendet, lassen uns an Opern wie Rigoletto oder Macbeth und ihre charakteristische «tinta musicale» denken. Natürlich arbeitet Donizetti auch mit musikalischen Formeln. Es geht aber darum, wie man diese Formeln interpretiert. Darin steckt ein grosses Potential! Ein paar Pizzicati der Streicher können belanglos klingen; sie können aber auch die innere Unruhe einer Figur wie Enrico, der unter grossem Druck steht, zum Ausdruck bringen. Das Orchester spielt also keineswegs nur eine langweilige Begleitmusik, sondern trägt ganz entscheidend dazu bei, dass wir die psychologische Situation, in der sich eine Figur gerade befindet, nachvollziehen können.
Im Belcanto gibt es viele liebgewordene Traditionen, vieles wird so gespielt, weil es schon immer so gespielt wurde, und nicht unbedingt so, wie es in der Partitur steht. Wie gehst du damit um?
Grundsätzlich bin ich dafür, der Partitur treu zu sein. Das lässt sich aber durchaus mit bestimmten Aufführungstraditionen verbinden. Im Belcanto gibt es viele Variationen, oft werden einer Partie Spitzentöne hinzugefügt. Manche funktionieren zusammen mit der Psychologie der Figur, andere nicht. Am Ende des berühmten Sextetts, das einer der Höhepunkte der Oper ist, singt Lucia traditionellerweise am Ende ein hohes Des, das nicht in der Partitur steht. Dieser hohe Ton ergibt für mich psychologisch gesehen keinen Sinn, denn es ist kein heroischer Moment, und Lucia ist auch noch nicht wahnsinnig. Sie spürt vielmehr in diesem Moment, dass sie sterben wird. Es ist unmöglich für sie, hier diesen hohen Ton zu singen. Und Donizetti hat ihn auch nicht geschrieben. Also habe ich gemeinsam mit Irina Lungu entschieden, dass sie an dieser Stelle die untere Oktave singt; so wird ein spannungsvoller Moment daraus. Das hohe Des kann sie ganz am Ende der Szene singen – in einem Moment allgemeinen Wahnsinns. Solche Entscheidungen treffe ich nie nur deshalb, weil etwas immer schon so gemacht wurde. Aber auch nicht nur deshalb, weil es so in der Partitur steht. Man muss sich immer fragen, warum etwas so geschrieben wurde. Und normalerweise findet man die Antwort im Text.
Inwiefern spielen bei solchen Entscheidungen auch die Vorgänge auf der Bühne und die Interpretation der Regie eine Rolle?
Es gibt in dieser Produktion durchaus Momente, in denen ich zusammen mit Tatjana Gürbaca entschieden habe, dass eine Pause länger sein muss, oder dass ich eine Fermate machen kann an einer Stelle, an der der Tenor einen Gang ausführen muss. Solange es für mich musikalisch Sinn ergibt, ist es sehr schön, gemeinsam mit der Regisseurin daran zu arbeiten, dass Musik und Szene perfekt ineinandergreifen.
Wenn man an «Lucia di Lammermoor» denkt, kommt einem natürlich zuerst die berühmte Wahnsinnsszene in den Sinn. Wie ist diese Szene gemacht, wo steckt hier musikalisch der Wahnsinn?
Diese Szene ist wie eine kleine Oper in der Oper und bietet der Sängerin der Titelrolle die Möglichkeit, alles zu zeigen, was in ihrer Stimme ist – Mittellage, Spitzentöne, Kadenz. Ursprünglich hatte Donizetti für diese Szene eine Glasharmonika vorgesehen, musste sie dann bei der Uraufführung aber durch eine Flöte ersetzen. Wir machen in Zürich die Version mit Glasharmonika, weil dieses Instrument eine ganz eigene Klangfarbe hat, die sehr gut zu dieser Szene passt; sie ist fast schon unheimlich, scheint wie aus einer anderen Welt zu kommen und erweckt den Eindruck, als sei in der Natur etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Donizetti schreibt fast schon impressionistisch – er sucht Klangfarben, die den psychischen Zuständen seiner Figuren entsprechen.
Grossartig ist auch die Gliederung dieser Szene in einzelne Episoden. Musikalische Ideen, Themen aus dem ersten Akt erklingen hier wieder, wehen in langsamerem Tempo aus einer anderen Zeit herüber, als würde Lucia sich an die Vergangenheit erinnern. Donizetti verwendet dafür wunderbare Melodien und eine einfache, aber keineswegs banale Begleitung; manchmal verändert er nur eine Note, die die Harmonie von Dur nach Moll eintrübt. Das kann ein plötzliches Gefühl von Beklommenheit erzeugen.
Ich empfinde diese Szene als sehr bewegenden Moment. Zu weiblichen Opernfiguren, die sehr zerbrechlich sind oder schwer krank wie Puccinis Mimì, spüre ich häufig eine besondere Verbindung. Ich weiss nicht, ob das daran liegt, dass ich selbst eine Frau bin. Obwohl sie aus dem 19. Jahrhundert stammt, trifft uns diese Musik mitten in unsere Seele. Wir können uns mit dieser Lucia identifizieren. Es passiert ja leider auch heute noch jeden Tag, dass Menschen anderen Menschen Gewalt antun oder Frauen physisch oder psychisch missbraucht werden – darüber kann man schon verrückt werden.
Mit Irina Lungu, Piotr Beczala und Massimo Cavalletti steht in dieser Neuproduktion ein Weltklasse-Ensemble auf der Bühne…
Ich bin sehr glücklich über diese Besetzung, übrigens auch weil sie so international ist. Unsere Sängerinnen und Sänger kommen von überallher, das finde ich wunderbar. Massimo Cavalletti habe ich oft auf der Bühne gesehen, bisher aber nie mit ihm gearbeitet. Еs ist sehr schön, diese Stimme und diesen Sänger nun endlich persönlich kennenzulernen. Massimo ist unglaublich flexibel. Wir haben an seiner Arie gearbeitet und entschieden, die Cabaletta zu wiederholen, in einem anderen Tempo, und zwar aus inhaltlichen Gründen, denn Enrico ist bei der Wiederholung noch viel wütender. Massimo ist sehr offen dafür, Dinge auszuprobieren, obwohl er die Partie schon oft gesungen hat.
Piotr Beczala ist ein wunderbarer Künstler, den man hier in Zürich niemandem vorstellen muss. Er hat viel schwereres Repertoire gesungen in letzter Zeit, aber er weiss genau, wie er seine Stimme wieder zum Belcanto zurückführen muss. Irina Lungu und ich haben Lucia di Lammermoor vor einigen Monaten in Japan zusammen gemacht. Es ist sehr schön, sie hier wiederzutreffen, besonders deshalb, weil wir beim ersten Mal nicht viel Zeit hatten zu proben, vieles haben wir einfach instinktiv gemacht. Jetzt können wir an Details arbeiten. Irina hat diese Rolle oft gesungen, aber auch sie probiert mit mir gerne neue Dinge aus; diese Offenheit schätze ich sehr.
Hier in Zürich wirst du am Kreuzplatz dirigieren und die Sängerinnen und Sänger nur auf dem Monitor sehen. Macht dich das ein bisschen nervös?
In diesem Jahr der Covid-Notsituationen habe ich alle möglichen neuen Arten kennengelernt, Oper und sinfonisches Repertoire aufzuführen – von Plexiglaswänden im Orchester über extragrosse Abstände bis zu einer Così fan tutte, in der der Chor im Zuschauerraum im fünften Rang sass… Im Belcanto-Repertoire mit seinen vielen Rubati ist für mich der Blickkontakt zwischen Sängern und Dirigentin eigentlich extrem wichtig. Und ich denke, nichts kann die Energie ersetzen, die von den Musikerinnen zu den Sängern fliesst und umgekehrt. Aber ich bin gerne bereit, es auszuprobieren, und sehr dankbar, dass das Zürcher Opernhaus einen Weg gefunden hat, diese Lucia trotz der Pandemie aufzuführen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal haben werden. Denn auch wenn es nur wenige Menschen sind, ist es für uns Künstlerinnen und Künstler unglaublich wichtig, diese Menschen zu spüren. Das gibt uns viel Energie!
Das Gespräch führte Beate Breidenbach
Foto: Silvia Lelli

Making of: «Lucia di Lammermoor»
Anstatt einer Einführungsmatinee haben wir diesmal für Sie ein «Making of» zu unserer Neuinszenierung «Lucia di Lammermoor» gedreht: In Interviews mit Dirigentin Speranza Scappucci, Regisseurin Tatjana Gürbaca, Bühnenbildner und Lichtdesigner Klaus Grünberg und Kostümbildnerin Silke Willrett erfahren Sie alles zur Konzeption dieser Neuproduktion, und in zahlreichen Probenausschnitten können Sie den Künstlerinnen und Künstlern bei der Arbeit zuschauen.
Neun wunderbare Jahre
In seinem grossen Abschiedsinterview blickt Fabio Luisi gemeinsam mit Andreas Homoki zurück auf Erfolge und Erkenntnisse aus seiner Zeit als Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich. Lesen
Fabio, bist du gut im Abschiednehmen?
Überhaupt nicht. Darin bin ich ganz schlecht.
Bevorzugst du wort- und tränenreiche Abschiede oder hast du es lieber kurz und schmerzlos.
Lieber kurz und schmerzlos. Ich finde, Abschiede werden überbewertet.
Aber du hattest ursprünglich Gustav Mahlers neunte Sinfonie für das letzte Philharmonische Konzert deiner Amtszeit als Zürcher Generalmusikdirektor auf das Programm gesetzt. Das ist ja mehr als ein Abschiedswerk für einen Menschen, das ist geradezu ein Weltabschiedswerk.
Ja, aber ich habe dabei nicht an meinen persönlichen Abschied gedacht, sondern an den Weg, den das Orchester und ich in den vergangenen neun Jahren gemeinsam gegangen sind. Mit Mahlers Neunter hätte sich der programmatische Bogen gerundet, den wir über unsere Philharmonischen Konzerte gelegt haben. Wir haben vor neun Jahren mit den Sinfonien von Robert Schumann, also frühen Meisterwerken des romantischen Repertoires, begonnen, und jetzt wäre zum Abschluss Mahlers Neunte gekommen, ein Werk mit dem auch die sinfonische Form des 19. Jahrhunderts an einem Endpunkt ankommt. Das war die Idee, die wir jetzt aber leider nicht realisieren können, weil wir auf den Corona-Abstand Rücksicht nehmen müssen und eine grosse Mahler-Besetzung nicht auf unsere Konzertbühne im Opernhaus passt. Deshalb spielen wir jetzt die etwas kleiner besetzte siebte Sinfonie von Anton Bruckner. Die eignet sich auch als Abschluss, denn mit Bruckner verbinden das Orchester und ich schöne gemeinsame Erfahrungen, die Vierte und Achte haben wir sogar aufgenommen.
Wenn du nach neun Jahren als Generalmusikdirektor in Zürich einen Blick zurückwirfst, was siehst du da?
Wunderbare Jahre, die mich künstlerisch und menschlich weitergebracht haben.
In welcher Weise?
Zum Beispiel in der Form des Teamgeistes, den ich hier erlebt habe. Das war für mich eine neue Erfahrung. Obwohl ich schon Chef eines anderen Opernhauses war und darüber hinaus viele Häuser von innen kenne, habe ich so eine Art der Zusammenarbeit wie hier in Zürich nirgendwo sonst erlebt. Wie wir in der Direktion alle künstlerischen Fragen besprochen haben und die Kommunikation zwischen Intendanz, Planung, Dramaturgie und Umsetzung ineinandergegriffen hat, das war, gemessen an meinem bisherigen Erfahrungshorizont, etwas Neues. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis für den Erfolg des Hauses. Es geht dabei nicht darum, dass immer alle der gleichen Meinung sind, sondern dass man gemeinsam den besten Weg für das Haus findet und dabei sein persönliches Ego als Generalmusikdirektor oder regieführender Intendant auch mal zugunsten des künstlerischen Gesamtbildes zurückstellt. Und wer nicht nur seinen persönlichen Präferenzen folgt, erlebt positive künstlerische Überraschungen. Das habe ich hier beispielsweise mit der Oper Juliette von Bohuslav Martinů erfahren. Die stand nicht auf meiner Prioritätenliste, aber Andreas hat sie mir vorgeschlagen. Ich war neugierig, und am Ende stand für mich eine grosse musikalische Bereicherung. Umgekehrt gab es Stücke, von denen ich wusste, dass sie mir nicht liegen, für sie haben wir Dirigenten gesucht, die das viel besser machen können.
Die Zürcher Zeit fällt bei dir in das Lebensalter zwischen 50 und 60 Jahren. Welchen Platz nimmt diese Dekade in deiner Biografie ein?
Es sind Jahre, in denen ich noch einmal viel gelernt habe. Vor allem wie ein Opernhaus gut funktionieren kann.
Ich dachte, du sprichst jetzt über Dinge wie Erfahrung und musikalische Reife, die einem in diesem Alter zugewachsen sind.
Das ist natürlich auch der Fall, die Erfahrung bildet in diesem Alter ein solides Fundament. Aber ich habe mich in den Zürcher Jahren trotzdem weiterentwickelt, persönlich wie musikalisch, was bei einem Musiker ja nicht zu trennen ist.
Kannst du diese Entwicklung beschreiben?
Es ist ein Prozess des Immer-Mehr-Verstehens, auch im Sinne von «Lass alles weg, was unwichtig ist und konzentriere dich auf das Wesentliche». Ich habe als Dirigent immer mehr Vertrauen in die Musikerinnen und Musiker entwickelt. Ich spüre stärker, wo ich mich auf sie verlassen kann und wo ich eingreifen muss.
Andreas, welches Resümee ziehst du als Intendant und künstlerischer Partner aus den gemeinsamen Zürcher Jahren mit Fabio?
Das kann man gar nicht auf einen Nenner bringen, weil Fabio so wahnsinnig vielfältig ist. Er ist im italienischen Repertoire besonders gut, aber ebenso im deutschen. Das ist ja ein wesentlicher Grund, warum ich ihn unbedingt für Zürich haben wollte. Er hat das Opernhaus in vielerlei Hinsicht musikalisch geprägt. Man muss sich nur die Opern-Neuproduktionen anschauen, die er in Zürich dirigiert hat. Ein Schwerpunkt lag gewiss bei den Opern von Verdi, aber er hat auch Jenůfa von Leoš Janáček, Beethovens Fidelio, Alban Bergs Wozzeck, Brecht/Weills Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Martinůs Juliette und mit Land des Lächelns sogar eine Operette realisiert.
Nicht zu vergessen die drei Belcanto-Opern von Vincenzo Bellini, die dir, Fabio, sehr am Herzen lagen. Bei Bellini muss sich der Dirigent ganz in den Dienst der Sänger stellen. Ist die hohe Kunst der «einfachen» Sängerbegleitung etwas, das dir besonders liegt?
Man muss den Komponisten Bellini und seinen Stil lieben, und das tue ich im Gegensatz zu vielen anderen Dirigenten. Wenn du nicht an diese Werke glaubst, lässt du besser die Finger davon. Bei Bellini kommt es darauf an, welche Bedeutung man als Dirigent der ja nur scheinbar einfachen Sänger-Begleitung beimisst. Das sind eben nicht nur beiläufige, sich wiederholende Floskeln, sondern wegweisende, frühromantische Schritte, das Orchester in die Dramaturgie des Stücks einzubinden. Mit Bellini beginnt die Entwicklung, dass das Orchester zum Ausdruck bringt, was die Worte des Gesangs nicht erklären können. Der Orchesterpart fasst die Temperatur, die Stimmung, den Wesenskern einer Situation in Töne.
Andreas, welche musikalische Qualitäten schätzt du an Fabio?
Ich habe ihn zum ersten Mal in Düsseldorf gehört, das war vor vielen Jahren mit einer Turandot. Da dirigierte ein junger Italiener, und den fand ich toll. Für mich war damals schon alles spürbar, was ich bis heute an Fabio mag. Seine Art zu interpretieren war griffig, konturiert, immer kraftvoll, immer mit einem Bekenntnis. Voraussetzung dafür ist natürlich Mut. Du musst bereit sein, ein Statement abzugeben. Du musst einen persönlichen Zugriff entwickeln auf die Werke. Das ist beim Regieführen nicht anders. Wenn du nur irgendwie das machst, was in den Noten steht, wird es nichts.
Gibt es eine Zürcher Opernproduktion, Fabio, die dir ganz besonders am Herzen liegt?
Für mich persönlich war Wozzeck der Höhepunkt der Opern, die ich in Zürich dirigiert habe. Das war eine in jeder Hinsicht gelungene Produktion, sängerisch, szenisch, musikalisch, alles. Ich habe den Wozzeck ja zum ersten Mal dirigiert, und es war sehr inspirierend, ihn in Verbindung mit der Regie von Andreas realisieren zu können, denn in der Inszenierung hat alles gestimmt vom Bühnenbild bis zur Gestensprache der Figuren. Das war für mich eine der besten Produktionen, die ich in diesem Opernhaus erlebt habe.
Du hast also auch den «Wozzeck» vor Augen, wenn du sagst, Zürich habe dir neue künstlerische Erfahrungen beschert.
Auf jeden Fall. Ich habe viel gelernt darüber, was gute Regiearbeit leisten kann, denn ich habe das Stück, genauso wie es in der Partitur komponiert ist, auch auf der Bühne gesehen, ohne den Realismus, mit dem Wozzeck sonst oft inszeniert wird. Es war eine innere Kraft, die diese visuelle Realisierung getragen hat.
Ihr beide habt viele Neuproduktionen in Zürich gemeinsam gemacht. Ihr seid ein gutes Gespann. Wieso passt das?
Fabio Luisi: Weil es ein grosses gegenseitiges Vertrauen gibt. Ich weiss, dass Andreas nie gegen die Musik inszeniert – und wenn er es doch tut, hat er dafür einen Grund, den ich nachvollziehen kann.
Andreas Homoki: Fabio ist jemand, der unglaublich schnell versteht, worum es mir geht. Wen er auf der Probe etwas sieht, was nicht dem entspricht, was er sich vorgestellt hat, sagt er entweder «Ah, interessant» und ist einverstanden und trägt das musikalisch mit. Oder er sagt «Nein, das ist keine gute Idee, weil...» Und dann hat er Recht. Wir hatten eigentlich nie einen grundsätzlichen Konflikt in unserer Zusammenarbeit. Ich glaube, das Extremste, was ich dir als Dirigent zugemutet habe, waren die musikalischen Umstellungen in Fidelio.
Fabio Luisi: Nein, da bin ich dir gerne gefolgt, weil ich Fidelio als ein unfertiges Stück betrachte. Die Werkgestalt bleibt durch die vielen Bearbeitungen bruchstückhaft – und ich fand deine konzeptionellen Überlegungen schlüssig.
Andreas Homoki: Diese Haltung ist nicht selbstverständlich für Dirigenten. Manchen fehlt genau diese Bereitschaft auch mal hinter die Partitur zurückzutreten und das grosse Bild zu sehen. Die kleben dann beckmesserhaft an den Noten. Und es gibt natürlich Dirigenten, denen die Fähigkeit abhandengekommen ist, überhaupt kontrovers zu diskutieren, weil ihnen an den Orten, an denen sie arbeiten, keiner zu widersprechen wagt.
Fabio Luisi: Wenn man sich als Dirigent der Oper zuwendet, muss man sich auf Diskussionen einlassen, denn die Oper besteht nun mal nicht nur aus Musik, sondern umfasst auch das Visuelle. Erst wenn alles zusammenkommt, wird Oper daraus.
Du nennst «Wozzeck» als deinen persönlichen künstlerischen Höhepunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Publikum das Verdi-Requiem hervorheben würde, dass du gemeinsam mit unserem Chor, dem Ballett und Christian Spuck als Choreografen auf die Bühne gebracht hast.
Ja, das war etwas Besonderes. Das Requiem als Tanz auf die Bühne zu bringen, ist an sich schon sehr ungewöhnlich, und in der Choreografie von Christian war es grossartig anzuschauen. Schön, existenziell und essenziell.
Fabio, ich möchte gerne auf deine Konzerte mit der Philharmonia Zürich zu sprechen kommen. Du hast vor allem das sinfonische Kernrepertoire des 19. Jahrhunderts auf die Programme gesetzt mit Schumann, Schubert, Bruckner, Mahler. Warum?
In Zürich muss das Orchester sehr viele Opernabende spielen und hat relativ wenige Möglichkeiten, mit Konzertrepertoire aufzutreten. Das ist ein Problem: Es kann doch nicht sein, dass unsere Musikerinnen und Musiker die grossen Wagner- und Strauss-Opern grossartig aus dem Stand spielen, aber achtzig Prozent von ihnen noch nie die grosse C-Dur-Sinfonie von Schubert gespielt hat oder Mahler oder Bruckner. Das fand ich nicht hinnehmbar, deshalb habe ich es geändert. Mit den grossen sinfonischen Orchesterwerken macht man Erfahrungen, die einen musikalisch weiterbringen, und die sich auf die künstlerische Qualität eines Orchesters insgesamt auswirken.
Andreas Homoki: Es war das Ziel, die Wahrnehmung des Orchesters als sinfonischer Klangkörper zu stärken, in Zürich und darüber hinaus. Deswegen haben wir auch gemeinsam mit dem Orchester den Namen in Philharmonia Zürich geändert.
Fabio, war das im Rückblick die richtige Entscheidung?
Absolut.
Ihr habt auch entschieden, die Philharmonischen Konzerte aus der Tonhalle zurück ins Opernhaus zu holen. War auch das eine richtige Entscheidung?
Andreas Homoki: Ich finde, ja. Die Voraussetzung dafür war eine Verbesserung der akustischen Situation für die Konzerte im Haus. Die haben wir vor allem durch den Bau eines neuen Konzertzimmers geschaffen, das sehr schnell, gewissenhaft und mit grösstmöglichem Knowhow realisiert wurde. Natürlich haben wir die Entscheidung auch im Hinblick auf den Umbau der Tonhalle getroffen. Wir wussten ja, dass die Tonhalle einige Jahre als Konzertort ausfallen wird.
Fabio Luisi: In der Tonhalle waren wir Gäste. Im Opernhaus sind wir zu Hause. Das ist in der Wahrnehmung ein grosser Unterschied.
Hast du mit der Akustik im Opernhaus manchmal gehadert?
Fabio Luisi: Ja. Das Theater ist architektonisch nicht als Spielort für Opern sondern für Schauspiel konzipiert. Mit dieser Tatsache müssen wir bis heute umgehen, und wir tun alles auf den verschiedensten Ebenen, damit es so gut wie möglich klingt.
Das gilt ja nicht nur für Konzerte, sondern vor allem auch für die Oper.
Klar. Jeder Dirigent in Zürich muss eine Antwort auf die akustischen Gegebenheiten finden. Das ist die Herausforderung. Als Generalmusikdirektor gewöhnt man sich mit der Zeit an die Situation und weiss, was man machen darf und was nicht. Ich würde sagen: Zürich ist akustisch kein leichtes Haus für die Oper, aber man kommt mit den entsprechenden Strategien damit klar.
Andreas Homoki: Ich kann nur unterstützen, was Fabio sagt. Wir reflektieren die Akustik bei jeder Neuproduktion. Das beginnt damit, dass wir über die Orchesteraufstellung diskutieren. An der Wiener Staatsoper sitzt das Orchester immer in der gleichen Aufstellung, bei uns wird das hinterfragt. Ich erinnere mich, dass wir die Anordnung im Graben bei Juliette komplett umgestellt haben. Wir reagieren, wenn unser auf historischen Instrumenten spielendes Orchestra La Scintilla im Graben sitzt. Wir schaffen völlig neue Raumklangerlebnisse, wenn wir grosse Werke der zeitgenössischen Oper wie Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten, Wolfgang Rihms Hamletmaschine oder Helmut Lachenmannn Das Mädchen mit den Schwefelhölzern aufführen. Da hilft auch die moderne Surroundanlage, die wir vor einigen Jahren in unserem Haus installiert haben, und natürlich die Kompetenz unserer Tonabteilung, die an der Verbesserung der Akustik immer mitarbeitet. Das Entscheidende ist aber die grosse stilistische Flexibilität des Orchesters selbst. Ich kenne kein anderes Orchester im Bereich der Oper, das in verschiedenen Formationen eine so riesige stilistische Bandbreite zu bieten hat wie bei uns hier in Zürich.
Fabio Luisi: Man kann das Orchester in dieser Hinsicht nur in den höchsten Tönen loben. Die Einstellung, die hier alle ihrem Job gegenüber mitbringen, ist fantastisch. Die Musikerinnen und Musiker nehmen alles sehr, sehr ernst, was auf ihren Pulten liegt, vom Frühbarock bis zur zeitgenössischen Musik, von Belcanto bis zur Operette. Die Bellini-Opern konnte ich in der orchestralen Qualität, die mir wichtig ist, nur hier in Zürich realisieren.
Für die Aussenwahrnehmung war auch die mediale Neupositionierung des Orchesters wichtig, die du, Fabio, in deiner Amtszeit vorangetrieben hast.
Die habe ich nicht alleine betrieben. Dafür braucht man die Unterstützung des Orchesters, der technischen Abteilungen, des Marketings, das ist ein Zusammenspiel vieler. Aber es ist so: Wir haben ein Label gegründet und, wie ich finde, beispielhafte Aufnahmen veröffentlicht, die auf den Streamingplattformen präsent sind und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Das ist für jedes Orchester wichtig.
In einer Zeit, in der die goldenen Zeiten des CD-Marktes vorbei sind.
Das stimmt. Die Veränderungen am Medienmarkt waren gerade in den vergangenen zehn Jahren enorm. Die Entwicklung ging weg von der CD, hin zum Downloading und zum direkten Streaming. Das Opernhaus hat schnell und technisch innovativ auf diesen Umbruch reagiert. Das wurde auch jetzt in der Corona-Krise wieder deutlich mit unserem Konzept, Oper trotz der Abstandspflicht durch die Live-Zuspielungen von Chor und Orchester aus dem Proberaum am Kreuzplatz zu ermöglichen, ein Konzept, das ich sehr unterstützt habe. Aber auch hier gilt: Das hat funktioniert, weil viele Abteilungen mit Ideen, Engagement und finanzieller Unterstützung zusammengewirkt haben. Solche Sachen kann keiner alleine vorantreiben, auch der Intendant nicht.
Wie gross, Fabio, war dein Einfluss als Generalmusikdirektor auf die Sängerbesetzungen?
Wir haben da natürlich Spezialisten in der Operndirektion, die dafür zuständig sind. Aber selbstverständlich interessiert mich die grosse Linie bei den Engagements, und da muss ich sagen: Das Opernhaus ist zu wichtig, um Besetzungen von persönlichen Vorlieben Einzelner abhängig zu machen. Zürich ist ein Haus für grosse Sängerinnen und Sänger, das ist historisch gewachsen. Mit dieser Tradition wollten wir in der Direktion, mich eingeschlossen, nicht brechen. Deshalb bin ich zufrieden mit den Besetzungen, obwohl ich manchmal gerne ein bisschen weniger konservativ gewesen wäre.
Was heisst das? Hättest du Lust gehabt, auf weniger etablierte Namen zu setzen?
Ja, aber etablierte Namen sind eben das, was Zürich braucht. Als Ideal schwebt mir immer noch ein Ensembletheater vor mit einigen Primadonnen und tollen Tenören an der Spitze, mit denen man etwa ein Mozart-oder Verdi-Repertoire über Jahre hinweg entwickeln kann. Aber ich verstehe, dass das am Opernhaus Zürich nicht zu machen ist.
Andreas, ist das so?
Es hängt viel an unserem Vorstellungsschema, an dem Semi-Stagione-Prinzip, nach dem unsere Aufführungen strukturiert sind. Wir rücken die Vorstellungstermine für eine Produktion zeitlich möglichst kompakt zusammen, weil diese Serie dann für gefragte Sängerinnen und Sänger attraktiver wird und wir die Werke gleichzeitig seriös einstudieren können. Ausserdem bringen wir mit neun Premieren pro Spielzeit so viele neue Opernproduktionen heraus wie weltweit kaum ein anderes Haus. Diese Tatsachen stehen dem traditionellen Ensembletheater im Weg, weil wir über eine Saison hinweg nicht genug Vielfalt bei den Partien für profilierte Ensemblesängerinnen und Sänger in den jeweiligen Stimmfächern zu bieten haben. Wir zeigen neben unseren Neuproduktionen zwanzig Titel im Repertoire, an der Wiener Staatsoper sind es fünfzig. Bei 50 Titeln kann man ein Ensemble mit viel grösserer Kontinuität präsentieren. Konsequentes Ensembletheater würde ausserdem eine Spielplanpolitik beinhalten, bei der man kurzfristiger plant und ganz bewusst Titel für die am Haus engagierten Künstler auswählt. Das ist für Zürich aber keine gute Idee, weil wir dann auf renommierte internationale Sängerinnen und Sänger verzichten müssten.
Fabio Luisi: Diese Künstler, die man in Zürich unbedingt hören will, sind auch gar nicht bereit, in ein Ensemble zu gehen. Hätten wir auf die grossen Namen verzichtet, wäre der Aufschrei in der Stadt gross gewesen.
Andreas Homoki: Es kommt hinzu, dass der Sog des internationalen Marktes so enorm ist, dass es nur schwer gelingt, junge aufstrebende Künstler am Haus zu halten. Das geht schon im Internationalen Opernstudio los, wo man uns manche Leute aus den Händen reisst. Aber wir kapitulieren natürlich trotzdem nicht und versuchen, junge Sängerinnen und Sänger aufzubauen, Kontinuität und Wiedererkennbarkeit bei den Besetzungen herzustellen. Ich habe schon den Eindruck, dass Zürich als ein Ort wahrgenommen wird, von dem aus vielversprechende Leute in eine internationale Karriere starten.
Fabio, die Identität von Orchestern wird gerne mit der Ahnengalerie der Dirigenten in Verbindung gebracht, die am Pult gestanden haben, bei den Berliner Philharmonikern beispielsweise wird auf Furtwängler, Karajan, Abbado, Rattle verwiesen. Macht das Sinn?
Ich glaube nicht. Die vier Dirigenten, die du für die Berliner Philharmoniker nennst, könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Ich halte nichts von diesen Genealogien. Es sei denn, ein Dirigent hat das Orchester wirklich sehr lange geleitet wie Karajan, dann ist es, was beispielsweise Klangbewusstsein und Phrasierung angeht, selbstverständlich durch ihn geprägt.
Sind neun Jahre, wie in deinem Falle, viel?
Nein. Das ist nicht zu vergleichen mit einem James Levine, der das Met-Orchester 25 Jahre lang geleitet hat.
Hat man als Chef eines Sinfonieorchesters mehr Zugriff auf den Klangkörper als an der Oper?
Das würde ich nicht sagen, du dirigierst als GMD sogar eher mehr Vorstellungen als Konzerte im philharmonischen Rahmen.
Andreas Homoki: In der Oper kann die Identifikation mit einem bestimmten Klangideal, auf das deine Frage abzielt, ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn ein Opernorchester auf einen typisch deutschromantischen Klang eingeschworen ist, bedeutet das ja auch eine Verengung des Profils. Wie klingen dann Verdi, Mozart oder eine Belcanto-Oper? Da ist mir die grosse stilistische Flexibilität unserer Philharmonia Zürich lieber.
Fabio, gibt es etwas aus deiner musikalischen Arbeit, das du dem Orchester mit in die Zukunft geben möchtest? Eine Hinterlassenschaft, die dir immer besonders wichtig war?
Das Legato.
Andreas Homoki: Das musst du erklären. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Fabio Luisi: Legato heisst, dass alle Noten gleichmässig aneinandergebunden sind. Dass man in Phrasen denkt, sie richtig beginnt, aufbaut und ausklingen lässt. Dass man atmet und grosse Spannungsbögen zu halten vermag. Das klingt selbstverständlicher als es ist. Viele Orchester verstehen das Wesen der richtigen Legato-Phrasierung nicht.
Fabio, verlagern sich mit dem Weggang aus Zürich die Schwerpunkte deiner Tätigkeit? Nimmst du Abschied von der Oper?
In der kommenden Saison werde ich zu 98 Prozent sinfonische Programme dirigieren, ich mache nur eine Opernproduktion und eine Wiederaufnahme. In der übernächsten Saison dirigiere ich gar keine Oper. Aber die Oper wird mir fehlen, das weiss ich jetzt schon.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Foto: Monika Rittershaus
Danke,
Fabio!
In der aktuellen Folge unseres Podcasts Zwischenspiel haben wir Musikerinnen und Musiker, künstlerische Partner und Weggefährten von Fabio Luisi zu seinem Abschied als Zürcher Generalmusikdirektor befragt. Was hat er dem Orchester, dem Theater, der Stadt gegeben?
Zum Podcast
#Peer günnt
Drei Schulklassen erarbeiten unter professioneller Anleitung ein Tanz- und Musikstück rund um Themen aus Henrik Ibsens «Peer Gynt». Ab dem 26. Juni ist das Ergebnis fünf Mal auf der Studiobühne zu sehen. Wir stellen das Projekt in einem Video-Beitrag vor.
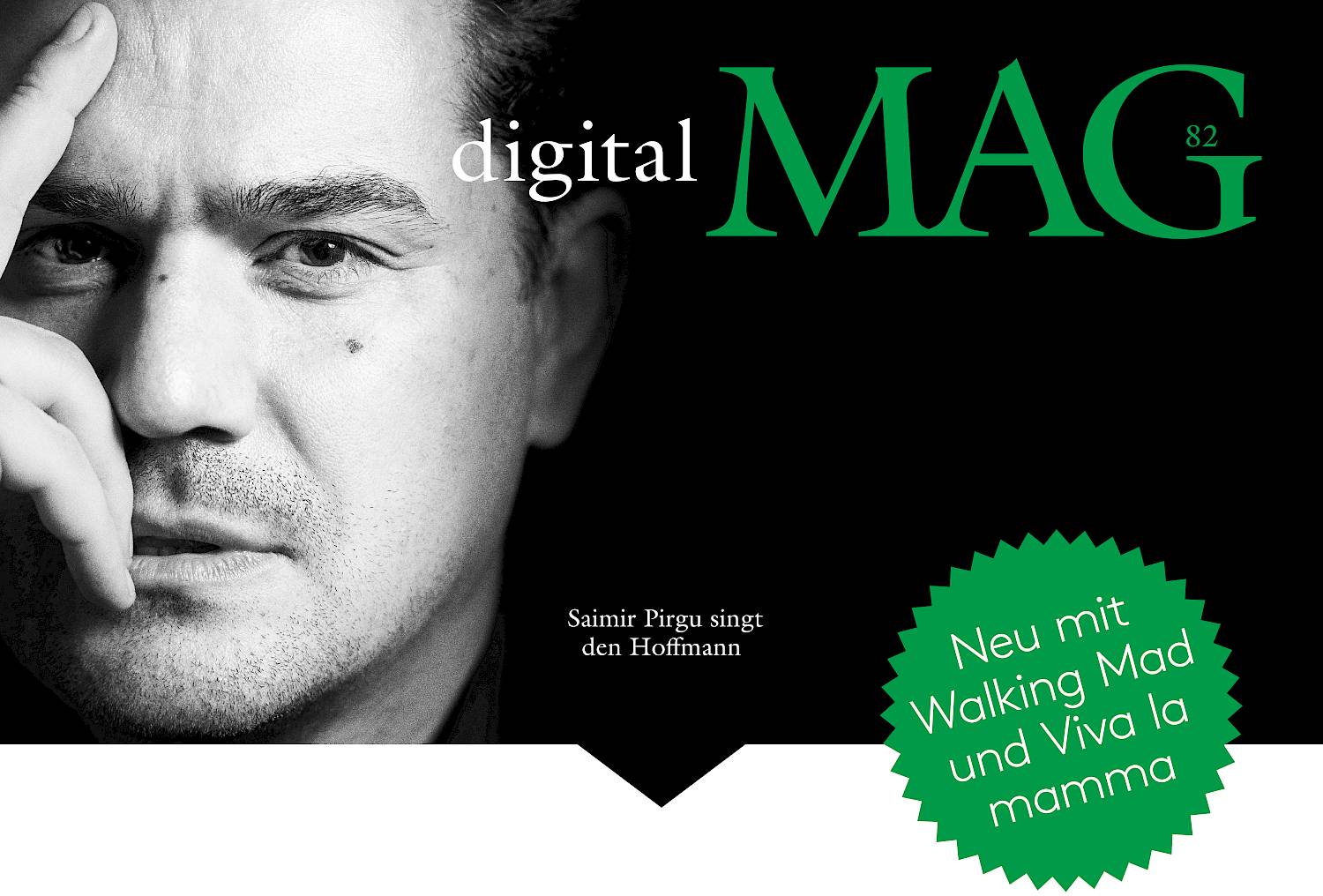
Wenn sich der Teufel
ins Theater einschleicht
ins Theater einschleicht
Anstelle einer eigentlichen Handlung kommt in Gaetano Donizettis Oper «Viva la mamma» der Probenalltag eines Theaters auf die Bühne. Dieser ist geprägt von Hierarchiedenken, Machtkämpfen, Unanständigkeiten und Strukturlosigkeit. Die Schweizer Regisseurin Mélanie Huber bringt das Stück in einer tragikomischen Version mit Sängerinnen und Sängern des Internationalen Opernstudios am Theater Winterthur auf die Bühne.Lesen
Mélanie Huber, du kommst aus Zürich und hast als Regisseurin wiederholt am Schauspielhaus, aber auch an vielen anderen Bühnen der Zürcher Theaterszene gearbeitet. Nun inszenierst du zum ersten Mal am Opernhaus. Wie hat diese konsequente Karriere begonnen?
Neben dem Theater habe ich mich früher auch sehr dafür interessiert, Szenen zu zeichnen. Ich habe mich deshalb nicht nur für das Filmstudium in Zürich, sondern auch für ein Trickfilmstudium in Luzern beworben. Meine Wahl ist dann doch auf das Filmstudium gefallen, und dort habe ich gemerkt, dass mich die Arbeit mit den Darstellenden stärker interessiert als diejenige hinter der Kamera. Am Ende des Studiums habe ich ein Stück des österreichischen Schriftstellers Händl Klaus inszeniert. Und das hat ziemlich eingeschlagen. Es öffnete mir die Türen zu Nachwuchspreisen und internationalen Festival-Einladungen. Entscheidend war seither aber auch, dass ich bei all meinen Engagements ein gewisses Mitspracherecht bei der Wahl der Stoffe hatte. Das hat mir geholfen, kontinuierlich meinen eigenen Stil zu entwickeln.
Welche Stoffe inspirieren dich denn?
Mit der Zeit sind ganz unterschiedliche Stoffe zusammengekommen. Am besten ist es, wenn mich eine Geschichte einfach nicht mehr loslässt. Oft sind es schräge, tragikomische Stoffe, die formal sehr unterschiedlich sein können: ein Roman wie Kafkas Prozess zum Beispiel, Melvilles Erzählung über den alles verneinenden Kanzleischreiber Bartleby oder eben eine absurde Komödie wie Dunkel lockende Welt von Händl Klaus, die mich damals sofort angesprochen hat. Ich suche Charaktere mit Ecken und Kanten, die trotzdem liebenswert sind. Und schliesslich ist es mir auch immer wichtig, dass ein Stoff auf der Bühne eine musikalisch-poetische Form annehmen kann.
Welche Rolle hat die Musik, die du gerade ansprichst, in deinen bisherigen Stücken gespielt?
Musik war immer ein wichtiger Bestandteil meiner Inszenierungen. Ingeborg Bachmanns Hörspiel Die Radiofamilie, das ich am Schauspielhaus in einer Bühnenfassung inszeniert habe, war beispielsweise ein ideales Stück, um den Umgang mit Klängen und Geräuschen zu erforschen. In einem Stück nach Robert Walsers Erzählung Kleist in Thun gab es wiederum eine Szene, in der ein Musiker mit Instrumenten, Löffeln, Besen und seiner Stimme die Geräuschwelt eines Marktplatzes zum Leben erweckt hat. Diese Art von Klangentwicklung interessiert mich sehr. Aber ich arbeite auch gerne musikalisch mit Schauspielern, für die das Singen ja oft ein Riesenstress ist. Aus so einer «Zitterpartie» entsteht am Ende oft etwas sehr Berührendes. In der Radiofamilie war beispielsweise ein Schauspieler dabei, der sich selbst als völlig unmusikalisch bezeichnet hat. Aber schliesslich hat er in unserem Stück Klavier gespielt. Er hat es sich angeeignet, gelitten, geschwitzt – und zuletzt voller Inbrunst seine Rolle gespielt.
In deiner ersten Opernarbeit triffst du nun auf eine Partitur von Gaetano Donizetti, in der viele musikalische Details bereits sehr genau notiert sind. Wie geht es dir damit?
Der Umgang mit einer Opernpartitur ist für mich als Regisseurin Neuland. Man stösst darin auf klare Strukturen, und das gefällt mir! Ich bin nicht der Typ für eine freie Stückentwicklung, bei der sich die formalen Fragen erst im Lauf des Probenprozesses klären. Andererseits erfordert die in vielen Varianten überlieferte Partitur Donizettis, an der wir hier arbeiten, eine Einrichtung. Und da interessiert es mich auch, wie viel Freiheit einem so ein Werk lässt. Ich habe mir beispielsweise eine Ouvertüre gewünscht, die von Donizetti in diesem Fall aber nicht vorliegt. Wir haben deshalb den etwas unkonventionellen Schritt gewagt, und einen jungen, begabten Komponisten beauftragt, eine Ouvertüre über Motive der Oper zu schreiben. Sebastian Androne-Nakanishi, der etwa im Alter unserer Opernstudio-Mitglieder ist, hat uns ein turbulentes, ein wenig trickfilmhaftes Stück geliefert, das meiner Vorstellung sehr entspricht. – Die Partitur ist aber auch für die Sängerinnen und Sänger eine verbindliche Quelle. In der Probenarbeit stosse ich deshalb schneller als im Schauspiel auf Widerstand, wenn ich mir einen unschönen Ton wünsche, ein Stöhnen etwa, ein Räuspern oder Seufzen. Szenisch ist es mir wichtig, dem etwas entgegenzusetzen, und auch mal einen hässlichen, tierhaften Ausdruck oder asymmetrische Posen zu fordern. Das verlangt den Darstellenden natürlich Überwindung und Mut ab. Aber wenn sie es schaffen, aus konventionellen Gesten auszubrechen, verleiht das den Charakteren letztlich Schärfe und Kontur.
Das Thema «Konventionen» führt uns direkt zum Stück, das du mit den Sängerinnen und Sängern des Opernstudios inszenierst. In der originalen Fassung, die Donizetti 1827 in Neapel auf die Bühne gebracht hat, heisst es «Le convenienze ed inconvenienze teatrali», was man mit «Sitten und Unsitten des Theaters» übersetzen kann. Worum geht es?
Das Stück dreht sich um eine Theaterprobe und um alles, was dabei schiefgehen kann. Es geht um die Hoffnungen, Unsicherheiten und Enttäuschungen aller Beteiligten. Es geht um den anstrengenden Akt, sich in der Kunstwelt profilieren und immerzu Leistung bringen zu müssen. Eigentlich haben alle dasselbe Ziel, nämlich eine Oper auf die Bühne zu bringen. Weil aber alle aneinander vorbeireden, kommt es nie dazu. Ein «Römerstück» über Romulus und Ersilia wird zwar angedeutet, einzelne Nummern werden geprobt. Der eigentliche Prozess wird aber ständig überlagert von den persönlichen Mätzchen, Eitelkeiten und Unvollkommenheiten der einzelnen Figuren.
Das Werk hat schon zu Donizettis Lebzeiten Aufführungen in verschiedenen Fassungen erlebt, mal mit gesungenen Rezitativen, mal mit gesprochenen Dialogen. Bei der Arbeit an unserer Aufführungsfassung haben wir in der Donizetti-Biografie von William Ashbrook den Hinweis gefunden, dass der Komponist noch 1845, also wenige Jahre vor seinem Tod, über eine weitere Revision dieses Stücks nachgedacht hat, allerdings schon schwer von seiner Krankheit gezeichnet – man geht von einer Syphilis im tertiären Stadium aus…
Donizettis wirklicher Gesundheitszustand muss furchtbar gewesen sein. Auf einer poetisch-fiktiven Ebene führte mir dieser Hinweis hingegen ein eher tragikomisches Bild vor Augen, wie Gaetano mitten in der Nacht in seinem Morgenrock fiebrig über einem Stapel Notenblätter sitzt, wie die Fantasiefiguren aus seiner unfertigen Oper an ihm vorbeiziehen, und wie er wahngetrieben versucht, dieser eine definitive Gestalt zu verleihen. So ist dann die Idee entstanden, dieses Stück, in dem ohnehin Theater im Theater gespielt wird, um eine weitere Ebene zu ergänzen und eine Gaetano-Figur hinzuzuerfinden, die zum Dreh- und Angelpunkt der Handlung wird.
Diese Figur hat der Autor und Dramaturg Stephan Teuwissen kreiert…
Mit Stephan verbindet mich eine jahrelange, sehr inspirierende Zusammenarbeit. Er hat die Gaetano-Figur gestaltet und ihm einen Text auf den Leib geschrieben. Glücklicherweise konnten wir den Schauspieler Fritz Fenne für diese Rolle gewinnen, der in meiner Bartleby-Inszenierung damals die Titelrolle gespielt hat. So hatten wir beim Entwickeln eine ganz konkrete Stimme im Kopf. Neben dem inhaltlichen Bezug löst diese Figur für uns auch viele praktische Fragen: sie hält die einzelnen Nummern der Oper so zusammen, dass wir einerseits auf grosse Sängerdialoge oder allzu zeitverhaftete Rezitative verzichten, andererseits aber auch zusätzliche Donizetti-Arien in das relativ kurze Stück einbauen konnten. Mir war es nämlich sehr wichtig, für die Sängerinnen und Sänger des Opernstudios ein wirkliches Ensemblestück zu schaffen, in dem jeder seine Aufgabe hat.
Die meisten Figuren des Stücks entstammen dem Opernbetrieb: Es kommen Sängerinnen und Sänger vor, ein Maestro, ein Poet und ein Direktor. Die eigentliche Hauptfigur aber heisst Mamma Agata und ist ein erklärungsbedürftiger Charakter. Was muss man über sie wissen?
Mamma Agata ist eine unverfrorene, unerschrockene, auch etwas unbedarfte Person, die von aussen zu dieser Theaterprobe stösst und sich nicht um die dort herrschenden Konventionen kümmert. Sie will etwas bewirken, ohne dabei gross über Moral nachzudenken. Diese erfrischend unkonventionelle Haltung tut gut und erzeugt im Stück besonders komische Situationen. Donizetti hat diese Mutterfigur für einen Bariton komponiert. Diese Setzung gefällt mir. Man kann sie aber nicht unkommentiert stehen lassen, da der historische Topos der «Theatermutter», auf den sich Donizetti bezogen hat, beim heutigen Publikum nicht mehr geläufig ist. Wir haben deshalb eine Möglichkeit gesucht, dieses Cross-Dressing auch aus heutiger Sicht nachvollziehbar auf die Bühne zu bringen.
Eine solcher Versuch wurde auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht, als man das Stück zu einer klamaukigen Travestie-Show umformte und unter den Titeln «Viva la mamma!» in München oder «Luigias Mother is a Drag» in London auf die Bühne brachte…
Diesen Weg wollte ich im 21. Jahrhundert als Frau schon nur deshalb nicht gehen, weil diese Klamauk-Variante ziemlich überstrapaziert ist. Mir war es wichtig, dass eine männliche Figur bewusst und auf offener Bühne in die Rolle der Mamma Agata einsteigt. Und dafür hat sich in Zusammenhang mit unserer Gaetano-Figur eine Lösung gefunden: Unter den Gestalten, die Gaetano in seinem Fieberwahn erscheinen, befindet sich nämlich auch ein Teufel. Sein Auftritt bedeutet uns, dass Gaetanos Tage gezählt sind, dass es in diesem Stück um sein Ende geht. Da dieser aber wild entschlossen ist, seine Oper noch zu vollenden, drängt er dem ungebetenen Gast aus dem Jenseits die Rolle der Theatermutter auf. Durch diesen Kniff wollten wir der Handlung einen gewissen Tiefgang geben, der die komische Seite des Stücks ergänzen, jedoch nie überdecken soll.
Ganz frei erfunden ist diese Teufelsfigur aber nicht…
Nein, es gibt in Donizettis Stück tatsächlich zahlreiche Anspielungen: Mamma Agata wird mehrfach als «Teufelsmutter» beschimpft, und der Poet stellt einmal fest, «der Teufel» habe sich in dieses Opernunternehmen eingeschlichen.
In unserer Stückfassung gibt es also eine alltägliche Probensituation, in der ein «Römerstück» geprobt wird; beides existiert jedoch nur in der fiebrigen Fantasie Gaetanos, dessen künstlerische Inspiration und «Höllenfahrt» ebenfalls auf der Bühne zu erleben sind…
…und manchmal entstehen durch diese Überschneidungen schöne Effekte. Wenn Mamma Agata gegen Ende des Stücks beispielsweise die Desdemona-Arie aus Rossinis Otello mit einem völlig falschen Text verulkt, dann ist das bei uns nicht nur klamaukig. Der musikalische Subtext spricht ja von Desdemonas Todesahnung. Diese Nummer und ein anschliessender Trauermarsch, der sonst eher zusammenhangslos im Stück steht, fallen bei uns mit der szenischen Anwesenheit des todkranken Gaetano zusammen.
In welchem Rahmen und mit welchen Mitteln erzählst du dieses Geschehen?
Laut Donizettis Partitur spielt das Stück in einem Vorraum des Theaters. Bei uns ist es eher ein Zwischenraum, der sowohl Gaetanos Situation zwischen Leben und Tod als auch die Theaterbühne für seine Fantasiegestalten beschreibt. Die Dinge, die in diesem Stück verhandelt werden, bieten natürlich keinen Stoff für ein psychologisches Kammerspiel. Es ist eine Komödie, in der es darum geht, überzeichnete Stereotype mit all ihren Macken auf die Bühne zu bringen. Licht, Fokus und die Personenführung spielen dabei eine grosse Rolle. Es geht also auch um Bildkomposition, und da bin ich sicher von meinem Filmstudium sowie von meinen Museumsbesuchen geprägt: Wie ein guter Maler seine Figuren anordnet, gestaltet und beleuchtet, ist für meinen Theaterstil eine wichtige Inspiration.
Lass uns noch einmal die ganz alltägliche Ebene des Stücks aufgreifen, den Probenprozess. Was geht da eigentlich schief?
Hierarchiegefälle spielen natürlich eine grosse Rolle, also beispielsweise die Rivalität zwischen der Prima Donna und der Seconda Donna. Die dritte Sängerin – im Original eine Parodie des damals aussterbenden Kastraten – hat eigentlich gar nichts zu singen. Wir haben diesen «Musico» deshalb in eine «Musica», eine Muse Gaetanos, verwandelt.
Die Probleme im Probenalltag liegen auf verschiedenen Ebenen: Der Operndirektor klagt ständig über die finanziellen Schwierigkeiten, der Maestro liefert seine Stücke nicht rechtzeitig, die Prima Donna kommt grundsätzlich nur gemeinsam mit ihrem Ehemann zur Probe, der Tenor ist überheblich, und Luigia, die «zweite» Sängerin, will eigentlich ständig proben, wird aber von niemandem beachtet. Zum einen besteht das Problem also darin, dass die Beteiligten ihr Privatleben mit auf die Probe schleppen, zum anderen fehlt ihnen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Opernkompanie besteht aus lauter Einzelkämpfern, die sich selbst vermarkten wollen. Nicht zuletzt deshalb ist das Ende des Stücks, an dem diese Kompanie notgedrungen aufgelöst werden muss, auch von einer gewissen Heiterkeit überschattet: Man hat das Gefühl, dass alle insgeheim hoffen, es an einem anderen Ort besser und einfacher zu haben.
Donizettis Stück aus dem frühen 19. Jahrhundert zeigt also auf, dass die Machtstrukturen an einem Theater sehr komplex sind...
...dabei fehlen ja ganze Abteilungen, die ebenfalls in den Prozess involviert sind. Eigentlich müsste das Stück noch zeigen, was an technischer Arbeit rund um die Bühne geleistet wird, und was dabei alles passieren kann. Es zeigt sich in dieser Tragikomödie über das Theater aber, dass Macht in verschiedenen Formen und auf beiden Seiten des Hierarchiegefälles ungute Dynamiken annehmen kann. Der Direktor oder Gaetano werden zuweilen zu giftigen und lauten Diktatoren. Wenn die Sängerinnen und Sänger sich aber gegen ein Opfer verbünden – wie das gegen Ende unseres Stückes gegenüber Gaetano passiert –, dann können auch sie zum gefährlich meuternden Mob werden.
Es wird in diesen Tagen viel über Machtstrukturen am Theater diskutiert. Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft des Theaters?
Wenn ich mich als Regisseurin dafür entscheide, ein Engagement anzunehmen, dann gehe ich damit eine Verpflichtung ein. Ich habe dann den Willen, diese Arbeit gemeinsam mit dem ganzen Team durchzuziehen. Und das gleiche Engagement fordere ich von den anderen Beteiligten. Es braucht gewisse grundlegende Strukturen und Regeln, an die man sich kollektiv hält, und einen respektvollen Umgang miteinander. Vielleicht ist es – wie in unserem fiktiven Stück – tatsächlich das Zusammengehörigkeitsgefühl, an dem wir am meisten arbeiten sollten. Wenn wir gemeinsam ein Ziel verfolgen und uns an die vereinbarten Regeln halten, dann muss auch niemand laut werden. Auf Angsthierarchien habe ich keine Lust. Theaterproben sind schliesslich Teil meiner Lebenszeit.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche
Fotos: Herwig Prammer
Wenn die Balance
in Schieflage gerät
in Schieflage gerät
Voller Witz und Überraschungen steckt Edward Clugs Stück «Chamber Minds», das 2015 für das Ballett Zürich entstanden ist. In einem von Saiten durchzogenen Raum geraten die Tänzerinnen und Tänzer immer wieder in unberechenbare Situationen. Ein Gespräch mit dem slowenischen Choreografen.Lesen
Edward, das Stück Chamber Minds hast du 2015 für das Ballett Zürich kreiert. Damals war es Teil eines dreiteiligen Abends, der unter dem Titel Strings Kompositionen für drei verschiedene Streicherbesetzungen vereinen sollte. Auch deine Choreografie hast du direkt aus dieser Vorgabe entwickelt.
Ich habe mich sehr gefreut, als Christian Spuck mir damals ein neues Stück zu einem Thema vorschlug, das meinem musikalischen Spektrum sehr entgegenkam. Milko Lazar, den ich als Komponisten sehr schätze und mit dem ich in Zürich auch Hill Harper’s Dream und Faust – Das Ballett erarbeitet habe, war begeistert von der Strings-Idee und hat eine Ballettsuite für Cembalo und Violine komponiert. Er selbst ist ein hervorragender Cembalist und war ganz vernarrt in den Klang, den er diesem barocken Instrument zu entlocken vermag und der sich gerade auch im Zusammenspiel mit der Solovioline entfaltet. Beide Instrumente treten in einen intimen Dialog und nehmen die barocke Tradition der Suite auf. Sie hat den Tanz ja buchstäblich in den Genen, denn bei ihren Sätzen handelt es sich in der Regel um echte oder stilisierte Tänze.
Wie muss man sich die Entstehung einer neuen Choreografie von Edward Clug vorstellen?
Schon lange, bevor ich im Ballettsaal mit den Tänzern zu proben anfange, versuche ich eine Struktur für das Stück zu entwickeln, die uns einen dramaturgischen und zeitlichen Ablauf vorgibt. Dabei geht es noch gar nicht um exakte Sekundenvorgaben, sondern viel mehr um das Erspüren von Momenten der Intensität oder der Stille. Beim Hören der Musik entwickle ich das Gefühl für die konkrete Atmosphäre, in der dann die Architektur des Stückes in Form von Bühnenbild, Bewegungen oder Situationen ihre Gestalt gewinnt.
Welche Rolle spielt die Musik für deine Choreografie?
Aus der Musik beziehe ich meine erste Inspiration, die Grundstimmung einer zu choreografierenden Situation. Die Situation selbst entsteht dann aber aus der Bewegung heraus und entwickelt sich meistens spontan und instinktiv. Auch wenn man so etwas wie eine Basisatmosphäre erspürt, kann man allerdings nie ganz sicher sein, wo man letztendlich ankommen wird. Es gibt immer auch den Moment der Unvorhersehbarkeit. Wenn die eigentliche Choreografie entsteht, geschieht das ohne die Musik, die allenfalls als Rhythmus präsent ist. Die direkte Begegnung von Tanz und Musik geschieht dann wie zufällig. Bei den Momenten, wo man eine «Deckungsgleichheit» spürt und das Gefühl hat, dass die Musik hier absolut zur Bewegung passt, verweile ich mit den Tänzern, um weiter am Detail zu feilen und eine Tiefenschärfung zu erreichen.
Nicht nur die Musik, sondern auch das Bühnenbild von Marko Japelj nimmt das Thema Strings auf, indem die Bühne wie von den gespannten Saiten eines Streichinstruments durchzogen ist. Welche Konsequenzen hat das für die Bewegungen der Tänzer?
Markos Installation durchspannt den Bühnenraum mit höhenverstellbaren Saiten und kreiert dadurch unterschiedliche Formen und Räume, in denen sich die Tänzer bewegen sollen. Sie müssen sich zum «Eigenleben» der Saiten ins Verhältnis setzen. Bei den Proben im Ballettsaal war das nur ein Modell, so dass wir uns zunächst nur improvisierend vorstellen konnten, wie das funktionieren würde. Erst bei den Bühnenproben haben wir dann gesehen, welche Möglichkeiten wir mit den Tänzern tatsächlich hatten, um mit dem Bühnenbild zu interagieren. Natürlich hatte ich Bilder und Vorstellungen in meinem Kopf, wie das aussehen könnte, aber es war lange Zeit offen, was wir davon wirklich umsetzen können würden oder eben auch nicht. Ich freue mich immer, wenn aus einem Element des Bühnenbildes oder aus einem Bestandteil der Kostüme eine unverhoffte Möglichkeit für Bewegung entsteht, die man anfänglich nicht erwartet oder gar beabsichtigt hat. Vielleicht erinnern Sie sich an die Skistiefel, mit denen die Tänzer in Hill Harper’s Dream bekleidet waren und die durch die überraschende Eigenart der Bewegung einen völlig unerwarteten poetischen Kontext entstehen liessen. Die Fragilität und Unbeholfenheit der Tänzer in diesen Schuhen vermittelte eine ganz ungewöhnliche Emotionalität. In Chamber Minds eröffnet die Struktur des Raumes mit Saiten, Linien, Gleisen unglaublich viele Assoziationsfelder. In dem von Saiten durchzogenen Raum scheint Bewegung mitunter unmöglich zu sein, und die Tänzerinnen und Tänzer müssen sich immer wieder mit unerwarteten Situationen auseinandersetzen.
Im Prozess der Entstehung des Stückes waren das aber nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hattest.
Die Crux bei fast allen Theaterproduktionen liegt ja vor allem darin, dass die Ideenfindung mit Bühnen- und Kostümbildner in enger Vertrautheit stattfindet, während bei der Umsetzung jeder auf sich gestellt ist und unabhängig vom anderen arbeiten muss. Ich choreografiere ohne Bühnenbild, das Bühnenbild wird ohne die Choreografie gebaut, und die Musik wurde ohne mich komponiert. Man sehnt den Tag herbei, an dem alle Beteiligten erneut zusammenkommen und hoffentlich erneut zu einem gemeinsamen Atem finden.
Auffällig in Chamber Minds ist das immer wiederkehrende Spiel mit den Geschlechterrollen.
Da ging es mir vor allem darum, eine andere Sichtweise auf das Stück zu bekommen. Ich choreografiere aus einer männlichen Perspektive. Zum Beispiel ein Duett, in dem ein Tänzer seine Partnerin führt. Wenn das Material sitzt, gehe ich einen Schritt zurück und lasse die beiden ihre Rollen tauschen. Der männliche Tänzer übernimmt den weiblichen Part und umgekehrt. Wenn sie bzw. er dann das eigentlich für den Partner bestimmte Bewegungsmaterial umsetzen muss, bekommt die jeweilige Situation eine ganz andere Bedeutung. Das muss gar nicht lange dauern, weil der Körper da ja nur bis zu einer bestimmten Stelle mitspielt. Beim Choreografieren ist das in etwa so, als würde man zweigleisig fahren. Ich versuche, den Mann und die Frau gleichzeitig zu verstehen, sie in der gleichen Zeit gleichberechtigt zu erfahren. Ich bin selbst immer am meisten überrascht, was dabei entsteht. Als Choreograf komme ich da ständig zu ganz neuen, ungewöhnlichen Lösungen. Aber auch für das Publikum ist das spannend. Das ist in «Hab Acht»-Stimmung und lauert geradezu auf diese überraschenden Momente. So kommt eine ungewohnte Direktheit und Frische in unsere Kommunikation.
Ähnlich wie in Faust oder Hill Harper’s Dream blitzt an vielen Stellen immer dieser leise, unaufdringliche Edward-Clug-Humor auf. Kann man Humor trainieren?
Sicher nicht. Voraussetzung sind echte Virtuosität und die Ernsthaftigkeit körperlicher Anstrengung. Aber der Humor entsteht spontan aus der Situation heraus, im Idealfall als «Nebenprodukt» einer Choreografie und meist aus Dingen, die «zwischen den Zeilen» stehen. Toll, wenn dieser Humor bei den Tänzern auf fruchtbaren Boden fällt. Leider gehört es zu unserem Beruf, dass wir den spontan erzielten gelungenen Moment für die Aufführung fixieren und proben müssen. Da geht die Spontaneität natürlich verloren. Ich verwende viel Zeit darauf, diese Frische und Unmittelbarkeit zu erhalten. Vieles entsteht zum Beispiel aus dem Verlust von Balance und damit einhergehenden unerwarteten Perspektiven und Blickkontakten zwischen den Tänzern. Wichtig ist mir der theatralische Aspekt in meinen Choreografien. Auch wenn es keine von A bis Z durchzubuchstabierende Handlung gibt, arbeite ich doch gern mit kleinen Handlungsversatzstücken oder Elementen, an denen man sich festhalten und denen man folgen kann. Dieser theatralische Aspekt hilft mir, meine Gedanken zu artikulieren und sie für das Publikum zu übersetzen.
Das Gespräch führte Michael Küster
Foto: Gregory Batardon

Die
magische
Wand
magische
Wand
«Walking Mad» im Probentrailer
Ich weiss selbst nicht,
ob es ein Traum ist
ob es ein Traum ist
Zum ersten Mal tanzt das Ballett Zürich ein Stück von Johan Inger. In «Walking Mad» verschwimmen die Grenzen von Tanz und Theater. Zur berühmten Musik von Maurice Ravels «Boléro» treffen drei sehr unterschiedliche Frauen aufeinander. Michael Küster hat mit dem schwedischen Choreografen über seine Karriere und das Stück gesprochen.Lesen
Johan Inger, Sie stammen aus Schweden und gelten heute als einer der gefragtesten Choreografen aus Skandinavien. Ist dieses «skandinavisch» in Bezug auf den Tanz eigentlich eine künstlerische Kategorie oder nur eine Marketing-Erfindung?
Genau wie die vielen Referenzen und Erfahrungen aus Kindheit und Jugend, die uns als Menschen geprägt haben, trägt man, glaube ich, auch das Land, aus dem man kommt, in sich. Was die Choreografie betrifft, so stellt sich die Situation für Skandinavien und insbesondere für Schweden sehr übersichtlich dar. Schweden ist ein grosses Land mit relativ wenig Menschen. Ich sehe hier eine Verbindungslinie, die von Birgit Cullberg, der Lichtgestalt des schwedischen Balletts, über Mats Ek zu Choreografen wie mir oder auch Alexander Ekman führt. In unserer Tanzsprache gibt es durchaus so etwas wie einen «Swedish Approach».
Woran kann man diesen schwedischen Zugang festmachen?
In unserer choreografischen Sprache entdecke ich oft etwas sehr Erdverbundenes und Bodenständiges. Es gibt eine gewisse Einfachheit und Direktheit, die Verkomplizierungen zu vermeiden sucht. Ich empfinde unsere Kunst als sehr «anti-barock», was sicher unseren Traditionen, unserer Volksverbundenheit geschuldet ist. Oft findet sich eine Leichtigkeit und ein sehr eigener Sinn für Humor. Ohne nostalgisch zu sein, wohnt dieser choreografischen Sprache jedoch auch eine gewisse Schwere inne, eine besondere Art von Melancholie, die verbunden ist mit Gefühlen der Einsamkeit und Dunkelheit. Das Ganze ergibt eine sehr spezielle Mischung.
Nach einem ersten Engagement beim Royal Swedish Ballet waren Sie in den Neunziger Jahren einer der charismatischsten Tänzer des Nederlands Dans Theaters (NDT), das damals vor allem von Jiří Kylián geprägt wurde. Wie findet man in dieser Umgebung zu einer eigenen choreografischen Sprache?
Die wenigsten Choreografen verfügen von Beginn an über einen eigenen Stil, eine unverwechselbare Signatur. Die entwickelt sich meist über einen längeren Zeitraum und hängt von den verschiedensten Einflüssen ab. Sie wird in starkem Mass davon bestimmt, was um einen herum passiert und von dem Potential, das man im eigenen Körper trägt. Das Nederlands Dans Theater habe ich damals als ein «Mekka des Tanzes» empfunden. In seiner Blütezeit vereinte es drei Compagnien mit einem jeweils eigenen Profil unter einem Dach. In den insgesamt fünf Ballettstudios passierten gleichzeitig die unterschiedlichsten Dinge. Man machte eine Tür auf, und da war William Forsythe. Hinter der nächsten Tür choreografierte Jiří Kylián, im dritten Studio waren vielleicht gerade Ohad Naharin oder Mats Ek mit einer neuen Kreation beschäftigt. Das NDT war ein Schmelztiegel der interessantesten Choreografen jener Zeit. Ich erinnere mich, wie ich all die verschiedene Einflüsse geradezu aufgesogen habe. Jiří Kylián ist sicher der Choreograf, den ich durch meine tänzerischen Erfahrungen am meisten in meinem Körper trage. «Kyliánesk» ist mein Werk deshalb aber nicht, choreografisch stehen mir Mats Ek oder Ohad Naharin näher.
Wie haben Sie den Schritt vom Tänzer zum Choreografen erlebt?
Die Entwicklung in Richtung Choreografie kann ich nicht von meiner tänzerischen Existenz trennen. Meine erste Choreografie entstand 1995 für das NDT 2, danach habe ich noch bis 2002 in der Compagnie getanzt. Sieben Jahre habe ich also gleichzeitig getanzt und choreografiert. Dabei habe ich viel aus meinem eigenen Tanz herausgezogen. Anders als viele Kollegen habe ich in meinem Tanzen kein Defizit verspürt, das ich mit dem Choreografieren irgendwie kompensieren wollte. Wenn ich Musik hörte, sah ich Bilder vor meinen Augen und entwickelte Ideen dazu. So hat das Choreografieren angefangen. Als ich noch beim Royal Swedish Ballet tanzte, war keine Zeit dafür. Aber als ich beim NDT anfing, bin ich buchstäblich in eine andere Welt eingetaucht, weil dort im Grunde alle Tänzer auch choreografiert haben. Da habe ich mir gesagt: Versuch es! Mein erstes Stück war ein zweiminütiges Duett, und ich weiss noch wie heute, dass ich mich nie zuvor so ausgeliefert gefühlt habe, nie einen solchen Adrenalinstoss, nie so viel Angst und Aufregung gespürt habe. Danach war ich wie süchtig nach diesem extremen Gefühl.
Nach dem Ende Ihrer tänzerischen Laufbahn haben Sie von 2003 bis 2008 das Cullberg Ballet in Stockholm geleitet, eine Mammutaufgabe…
Das stimmt. Das Cullberg Ballet war in Schweden über lange Jahre das Synonym für Tanz schlechthin. Birgit Cullberg hatte es 1967 gegründet. Als Teil des Rijkstheaters tourte die Compagnie jahrelang durch alle Teile des Landes und verhalf dem Ballett als Kunstform zu grosser Popularität. Das Cullberg Ballet war eine wirkliche Marke, und jeder in Schweden hatte irgendeine Beziehung zu diesem Ensemble oder zur Cullberg-Familie, zu Birgit, ihrem Sohn Mats Ek oder seinem Bruder Niklas, der ebenfalls ein toller Tänzer war. Wann immer man in Schweden über Tanz sprach, kam die Rede irgendwann auf die Cullbergs. Ein grosses Erbe, das man da auf seinen Schultern getragen hat… Diese fünf Jahre waren eine sehr produktive Zeit. Bei jedem neuen Stück machte man im Grunde da weiter, wo man aufgehört hatte. Wir waren sehr kreativ.
Dennoch haben Sie sich dann für eine Laufbahn als freischaffender Choreograf entschieden.
Tatsächlich kommt diese Arbeitsweise meinem Naturell mehr entgegen. Ich werde nicht abgelenkt von administrativen Verpflichtungen, sondern kann mich voll und ganz auf das Stück fokussieren, das ich erarbeiten möchte. Die Leute freuen sich, wenn ich komme, und aus der Frische jeder neuen Begegnung entsteht viel Energie.
Wie hat sich Ihre choreografische Sprache im Laufe der Jahre verändert?
Meine ersten Stücke beim Nederlands Dans Theater waren in der Regel Teile von dreiteiligen Ballettabenden und durften eine gewisse Länge nicht überschreiten. Ich war sehr an diese kleinteilige Form gewöhnt und habe erst 2015 begonnen, in grösseren Formaten und vor allem auch narrativ zu arbeiten. Das war eine Neuentdeckung für mich. In schneller Folge habe ich zum Beispiel eine Carmen gemacht, habe Peer Gynt, Petruschka und auch einen Don Juan herausgebracht. Das war noch einmal ein wichtiger Schritt und ist bis jetzt jedes Mal eine ganz neue Herausforderung. In meinen Stücken versuche ich, menschlich und vor allem ehrlich zu sein. Ich erlebe sie jedes Mal wie eine Reise, bei der man verschiedene Stationen durchläuft und viel über sich selbst erfährt.
Das geht den Tänzerinnen und Tänzern in Ihren Stücken hoffentlich ähnlich. Was erwarten Sie von ihnen?
Da zu sein, wenn es darauf ankommt und Präsenz zu zeigen. Wenn Tänzer die Essenz eines Stückes, das wir erarbeiten, in sich wiederfinden und sie mit ihrer eigenen Authentizität auf die Bühne bringen, macht mich das glücklich.
Mit Walking Mad tanzt das Ballett Zürich jetzt ein Stück, das bereits 20 Jahre alt ist und zu einer Art «Signature Piece» von Johan Inger geworden ist. Was hat es heute mit Ihnen zu tun?
Das Stück hat immer noch eine grosse Bedeutung für mich, und wahrscheinlich würde es ganz ähnlich aussehen, wenn ich es heute entwickeln würde. Wenn man ein Vierteljahrhundert choreografiert hat, erkennt man im Rückblick, dass es neben den Erfolgen auch mittelmässige Stücke und vielleicht sogar Flops gegeben hat. Aber zu Walking Mad kann ich auch heute noch stehen, und die Begeisterung, mit der die Tänzerinnen und Tänzer aus den unterschiedlichsten Compagnien dieses Stück tanzen, ist jedes Mal eine schöne Bestätigung.
In Walking Mad verschwinden die Grenzen zwischen Tanz und Theater. Woher kam die Inspiration für dieses Stück?
2001 sollte ich für das Nederlands Dans Theater ein Stück mit Orchester kreieren. Irgendwie fiel mir Maurice Ravels Boléro in die Hände, und ich erinnerte mich augenblicklich an einen Fernsehbeitrag, den ich Jahre zuvor gesehen hatte. Noch in Schwarz-Weiss dirigierte Sergiu Celibidache damals das weltberühmte Stück. Nachdem er anfangs noch zurückhaltend und beinahe minimalistisch in seinen Bewegungen war, geriet er mit dem immer weiter anschwellenden Crescendo buchstäblich in Rage. Sein Dirigat wurde immer gestenreicher und extremer, seine Frisur geriet aus der Façon, und am Schluss schien es, als würde Celibidache verrückt werden. Die Art, wie mir die Musik präsentiert wurde, beeindruckte mich vor allem in ihrer Theatralität. So eine Verrücktheit wollte ich in Walking Mad einfangen.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Für die Bühne benötigte ich eine deutliche Brechung des musikalischen Minimalismus’, einen Kommentar dazu, dass die Musik im Grunde nur eine Konstante in dem Stück darstellt. Die bewegliche Wand, die das Bühnenbild bestimmt, ist von symbolischer Gestalt und gab mir die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Räumen zu spielen: von offen und gross dimensioniert bis eng und begrenzt. Das war sehr hilfreich bei der Strukturierung des Stückes. Die Hauptdarsteller, drei Tänzerinnen und ein Tänzer, tanzen und spielen in den sich verändernden Räumen. Sie begeben sich auf eine Reise, auf der sie die verschiedensten Stadien zwischen Verrücktheit und Gewalt durchlaufen. Die Wand ist dabei ein wesentlicher Bestandteil der Choreografie.
Wo kommen die Hauptdarsteller am Ende ihrer Reise an?
Zunächst gibt es einen Mann, der anfangs aus dem Publikum kommt, auf die Bühne tritt und seine eigene Reise beginnt. Er schreitet durch das Stück wie ein Wanderer. Neben ihm wird Walking Mad von drei sehr unterschiedlichen Frauencharakteren geprägt. Sie haben etwas von Tschechows Drei Schwestern. Ich wollte zeigen, dass jede von ihnen auf irgendeine Weise blockiert ist oder in ihrer Lebenssituation feststeckt. Die Jüngste zum Beispiel braucht ständig Bestätigung und Wertschätzung, um sich gut fühlen zu können. Die Zweite geht sehr zerstörerisch mit sich und den Männern in ihrem Leben um. Aber irgendwie kommen diese beiden Frauen in ihrem Leben weiter, nur der Letzten gelingt das nicht. Sie verharrt im Gestern und bleibt, wo sie sich befindet. Im Kontrast dazu sind die Männer – mit einer Ausnahme – eher als Energie, als Masse zu sehen. Sie kreieren im Lauf des Stücks immer neue Situationen.
Wie sind Sie mit Ravels Komposition umgegangen, und welche Rolle spielt Arvo Pärts zerbrechliches Klavierstück Für Alina in diesem Kontext?
Das ganze Stück war eine grosse Herausforderung für mich. Ich musste mich zu Ravels Musik in Beziehung setzen, verbunden mit den Erwartungen des Publikums und meinem eigenen Wunsch, etwas Unvorhersehbares zu schaffen. Wenn man sich mit dem Boléro beschäftigt, kommt man an der sexuellen Aufgeladenheit dieser Musik nicht vorbei. Deshalb war mir schnell klar, dass ich in meinem Stück über die Mechanismen in den Begegnungen von Männern und Frauen erzählen will. Und ich wollte auf keinen Fall mit dem bekannten Boléro-Schluss enden. Das wäre zu einfach gewesen. Jeder weiss ja im Grunde, wie das Stück abläuft. Deshalb war es mir sehr wichtig, die Erwartungshaltung auf Seiten des Publikums zu unterlaufen. Mit Hilfe der Musik von Arvo Pärt habe ich eine Art Echo kreiert. Nach dem Ende des Boléros bleibt nur noch eine Frau übrig – zur fragilen Musik von Pärts Klavierstück Für Alina. Nicht mutig genug, den Sprung zu wagen, wird die Wand für sie zur unüberwindbaren Grenze.
Editorial
Verehrtes Publikum,
im Zürcher Opernhaus hat man, wenn man in einer der Dienst- und Direktionslogen der rechten Seite über dem Orchestergraben sitzt, einen grossartigen Überblick über den gesamten Zuschauerraum.
Weiterlesen
1. April 2021
Verehrtes Publikum,
im Zürcher Opernhaus hat man, wenn man in einer der Dienst- und Direktionslogen der rechten Seite über dem Orchestergraben sitzt, einen grossartigen Überblick über den gesamten Zuschauerraum. Alle, die dort schon einmal Platz genommen haben, kennen und lieben diesen Anblick: Man schaut während der Vorstellung in die konzentrierten Gesichter im Parkett, deren Nasen allesamt wie Kompassnadeln auf das Bühnengeschehen ausgerichtet sind. Man erkennt im Aufführungsdunkel die reglosen Oberkörper in den oberen Rängen, deren Aufmerksamkeit sich ebenfalls auf einen einzigen Punkt richtet. Ist das Opernhaus voll besetzt (und das war vor Corona-Pandemie meistens der Fall) wirkt dieser konvexe Publikumskorpus wie ein Brennglas, das die Bühne mit seiner Konzentrationshitze auflädt. Es ist eine Menschensonne, die Abend für Abend aufgeht, und die Kunst auf der Bühne mit Energie versorgt, sie wachsen, blühen, leuchten lässt.
Diese Sonne, also Sie, verehrtes Publikum, vermissen wir. Sie ahnen gar nicht, wie sehr. Wie eine Fata Morgana steht uns der Anblick eines vollen Hauses während des Corona-Lockdowns vor Augen, wenn wir, wie jetzt wieder bei den Endproben zu Jacques Offenbachs Oper Les Contes d’Hoffmann nur auf Parkettreihen mit hochgeklappten Theaterstühlen schauen.
Immerhin: Wir werden auch diese Neuproduktion streamen, Sie können sie zu Hause anschauen, die Kunst erreicht ihre Adressaten. Aber das Gemeinschaftserlebnis fehlt und die Kraft, die von einem anwesenden Publikum ausgeht. Auch fehlen die Vorstellungsserien, die auf jede Premiere folgen und eine Inszenierung musikalisch wie szenisch erst zu sich selbst kommen lassen. Erst nach der Premiere nämlich spielen sich Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker frei, interagieren mit dem Publikum, bereichern das Stück mit spontaner Lebendigkeit. Es war in dieser Spielzeit jedes Mal schmerzlich, fast unerträglich, wenn die Künstler nach der Premiere schon wieder abreisen mussten, genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Theaterspass eigentlich erst beginnt.
Draussen fängt jetzt die Frühlingssonne an, uns zu wärmen. Im Opernhaus aber herrscht noch frostiges Corona-Winterdunkel. Auch hier muss die Sonne dringend wieder aufgehen. Die zarten Pflanzen der Bühnenkünste brauchen das Licht der Aufführungen vor Publikum, sonst verdorren sie.
Claus Spahn
Sobald
grünes
Licht
kommt,
spielen wir
grünes
Licht
kommt,
spielen wir
1. April 2021
Herr Homoki, in der Corona-Pandemie scheint vorerst keine Verbesserung in Sicht. Am Opernhaus keimte die Hoffnung, nach Ostern wieder für 50 Leute spielen zu dürfen. Aber die Politik gestattete diesen angedachten Öffnungsschritt schliesslich doch nicht. Was heisst das nun für die Planungen des Hauses?
Die Entscheidung, nach Ostern doch nicht vor Publikum spielen zu dürfen, kam für mich, ehrlich gesagt, nicht überraschend, denn die Infektionszahlen sinken ja nicht, sondern steigen. Von daher ist das nachvollziehbar. Aber natürlich hatten wir auf eine Situation gehofft, in der wir wieder öffnen können, und wenn es nur für 50 Menschen ist. Wir sind auf diese Situation vorbereitet und haben einen neuen Spielplan erarbeitet, der den beschränkten Möglichkeiten Rechnung trägt und sich trotzdem sehen lassen kann. Es ist ja klar, dass wir für 50 Gäste keine grosse Opern wie Eugen Onegin oder Don Carlo anbieten können, weil das wirtschaftlich nicht verantwortbar wäre. Deshalb haben wir kleine Formate entwickelt, die wir auf der Vorbühne einem sparsam besetzten Parkett präsentieren können, aus dem Ballett, aus unserem Solisten-Ensemble, aus dem Orchester. Ich selbst habe auch ein Stück für diese Situation inszeniert, nämlich Igor Strawinskys Geschichte vom Soldaten. Diese ganze Planung ist jetzt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Sobald wir grünes Licht für eine Öffnung bekommen, spielen wir.
Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass unser Publikum in dieser Spielzeit noch einmal grosse Opernformate zu sehen bekommt, wie sie in unserem ursprünglichen Spielplan geplant waren?
Ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist, deshalb habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber die Chancen schwinden natürlich. Um grosse Opern spielen zu können, müssten wir die Erlaubnis bekommen, annähernd 500 Gäste in die Vorstellungen zu lassen, und davon sind wir im Moment leider weit entfernt. Wir werden aber auf jeden Fall unabhängig vom zugelassenen Publikum unsere Neuproduktionen herausbringen und stehen bereit, unsere kleineren Formate zu spielen. Alles Weitere müssen wir abwarten. Unsere Hoffnungen für eine Wiederkehr der grossen Oper richten sich mehr und mehr auf die neue Spielzeit, nach einem Sommer, der uns hoffentlich stark gesunkene Infektionszahlen und eine durchgeimpfte Bevölkerung bringen wird. So kann es nicht mehr lange weiter gehen. Die Beschädigung der Kunst und die Folgen für alle Mitarbeitenden des Opernhauses sind gravierend. Das ist immer deutlicher zu spüren.
Wie laufen die Streaming-Angebote?
Die gehören zu den Lichtblicken in diesen tristen Opern- und Ballettzeiten, denn sie werden vom Publikum sehr gut angenommen. Christian Spucks auf ARTE Concert digital abrufbare Winterreise haben bis heute weltweit über 200'000 Menschen gesehen, und unser live auf ARTE im Fernsehen übertragenes Brahms-Requiem mit Gianandrea Noseda inzwischen sogar unglaubliche 690'000. Auch unsere Souvenir-Serie mit historischen Aufnahmen aus dem Opernhaus läuft sehr gut. 15'000 Menschen haben sich beispielsweise noch einmal den Don Giovanni von Jürgen Flimm und Nikolaus Harnoncourt angeschaut. Da ist viel Leidenschaft und Zuspruch für das Opernhaus zu spüren.
Die Raute, die alles kann
Kennen Sie die eierlegende Wollmilchsau? Es handelt sich um ein Tier, das sinnbildlich für die Erfüllung verschiedenster Ansprüche steht. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich viele dieser Ansprüche gegenseitig ausschliessen und die eierlegende Wollmilchsau aus Sicht des technischen Direktors deswegen vom Aussterben bedroht ist.
Ein wunderbares Beispiel dafür haben wir in der Produktion von Les Contes d’Hoffmann auf der Bühne stehen. Es ist eine rautenförmige Spielfläche mit den Abmessungen von 7 x 13 Metern, die ca. 1 Meter über dem Bühnenboden steht. Diese Spielfläche kann vor- und zurückfahren, sich drehen und kippen. Mal zeigt die Spitze der Raute zum Zuschauerraum, mal eine der Seiten. Sie kann lautlos schwanken wie ein Schiff und so schräg gestellt werden, dass alles was, auf ihr steht, abrutscht. Eben eine riesengrosse theatertechnische eierlegende Wollmilchsau.
Damit die Raute sich so bewegen kann, haben wir sie nur mit einer einzigen mittigen Stütze versehen. Diese mittige Stütze ist in einem sehr, sehr sehr stabilen und sehr, sehr schweren fahrbaren Wagen gelenkig befestigt. Diesen Wagen können wir funkferngesteuert vor und zurück fahren. Damit die Fläche sich so bewegt, wie wir es möchten, drücken zwei starke Elektromotoren mittels Zahnstangen die mittlere Stütze in den gewünschten Winkel. Für die Drehbewegung haben wir auf der Stütze ein Drehlager eingebaut, sodass sich die Raute gegenüber der Stütze und dem Wagen drehen kann, der Antrieb ist ebenfalls ein Elektromotor. Natürlich reichen hier Motoren allein nicht aus: Es mussten komplexe Wegerfassungssysteme miteingebaut werden, damit die Bewegungen präzise gesteuert werden können. Es braucht auch Bremssysteme, damit beim Stillstand auch wirklich alles stehen bleibt – auch wenn Künstlerinnen und Künstler auf der Raute Jacques Offenbachs Oper singen und spielen.
Wenn Sie nun denken, dass sei sie doch, die eierlegende Wollmilchsau, so muss ich Ihnen sagen, dass es sich bei der Raute mit Stütze nur um ein eierlegendes Wollschaf handelt. Denn durch die Geometrie mit der Mittelstütze können wir die Raute nicht sehr schräg stellen. Für den Akt, in dem sich die Raute spektakulär aufrichtet und sogar ein auf ihr stehender Flügel abrutscht, haben wir eine zweite Raute gebaut. Diese hat keinen Mittelfuss, sondern die in den Zuschauerraum zeigende Spitze ist an ihrem Fahrwagen gelenkig gelagert. Wir können den hinteren Teil mit einem sehr starken hydraulischen Zylinder beliebig hochdrücken und dadurch die Raute sehr steil stellen. Dafür kann diese Raute nicht drehen und schwanken. Es ist sozusagen nur eine Milchsau.
Es ist dem Stück zu verdanken, dass wir in den Pausen das eierlegende Schaf durch die Milchsau unbemerkt austauschen und somit den Eindruck erwecken können, dass wir die eierlegende Wollmilchsau tatsächlich auf der Bühne haben. Denn, wie eingangs erwähnt, ist sie nur selten zu finden. Immerhin liefert eine Bildersuche im Internet schöne Treffer. Und ein eierlegendes Schaf auf der Bühne zu haben, ist auch eine grossartige Leistung unserer Werkstätten.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich
Illustration: Anita Allemann
Verliebt in einen
Automaten
Automaten
In Jacques Offenbachs Oper «Les Contes d’Hoffmann» verfällt der Titelheld der Puppe Olympia. Für den Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer ist eine solche Liaison ein dankbares Anschauungsobjekt. In der aktuellen Folge unserer MAG-Kolumne legt er die Beziehung zwischen Mensch und Maschine auf die Couch. Lesen
Hoffmanns Erzählungen bietet eine unglaublich dichte und vielschichtige Auseinandersetzung mit den Zumutungen des Industriezeitalters. Die Technik beginnt, der Poesie Terrain zu rauben. Fotografische Bilder übertreffen den Realismus der Maler und nehmen der Kunst das klare Kriterium der perfekt nachgeahmten Natur. Maschinen sind stärker, schneller, produktiver als Menschen. Der Gedanke spinnt sich wie von selbst weiter: Werden wir auch Menschen bauen können? Sie aus Teilen geraubter Leichen zusammenflicken und durch elektrischen Strom beleben? Puppen voller kunstreicher Mechanik mit Haut und Haaren rüsten, so dass sie bezaubernd tanzen? Wird der Mensch zum Schöpfer? Und wenn er Gott Konkurrenz macht – wird er dann etwa gar zum Verbündeten Luzifers?
Die künstlerische Auseinandersetzung mit diesem Wandel greift nach Themen, die hinter der Aufklärung und der rationalen Theologie Gegensätze magisch fassen. Wie kann ich das lebende Wesen vom Gespenst, den Zeugung und Tod unterworfenen Menschen vom Untoten, von der Maschine unterscheiden? In Hoffmanns Erzählungen sind mehrere dieser Motive verarbeitet: Die bezaubernd schöne, mechanisch belebte Tänzerin Olympia, in die sich der verblendete Dichter verliebt – und die drohende Verwandlung eines Menschen in ein dämonisches Geschöpf, einen Zombie, einen Vampir.
Gespenster werfen keinen Schatten. Die Geisterwelt ist voller übermenschlich schöner Wesen. Aber diese sind unfruchtbar und taugen nicht für eine Liebesbeziehung, wie es Hofmannsthal in Die Frau ohne Schatten ausgemalt hat. Einem Menschen den Schatten zu stehlen oder ihn ihm abzukaufen, das heisst auch, ihm seinen Platz unter den Lebenden zu nehmen. Wo Schatten ist, da ist auch Licht, vor allem das Sonnenlicht, in dessen Strahlen Vampire zu Staub zerfallen.
Verwandt ist die Bedeutung des Spiegelbildes, denn was nur Schein, nur Abbild eines Lebenden ist, kann dem Spiegel kein zweites Bild abringen. Physikalisch ist das falsch, aber es passt zu unseren Emotionen, vor allem zu einer Angst, die seit der Oper von Jacques Offenbach zugleich vielschichtiger und umfassender geworden ist.
Der verkaufte Schatten bei Schlemihl und das gestohlene Spiegelbild greifen das Thema des Pakts mit dem Teufel auf, mit dem sich in Goethes monumentalem Drama das Industriezeitalter ankündigt. Was geschieht mit uns, was machen wir eigentlich, wir Künstler, wie viel Macht, wie viel Leben oder auch Tod steckt in unseren Figuren?
Bei Homer können die Schatten der Toten erst dann Gestalt annehmen und sprechen, wenn sie Blut getrunken haben. Die Macht, Gestalten zu erfinden und ihnen Leben einzuhauchen, entfernt den Dichter von der Teilhabe am Lebens- und Liebesglück. Thomas Mann hat das in Tonio Kröger angedeutet, im Doktor Faustus präzisiert und mit dem Teufelspakt verbunden. Offenbachs Oper fasst die untergründige Faszination in einen moralisierenden Rahmen: Hoffmann sollte sich nicht an aussichtslose Lieben verschwenden, nicht den tückischen Einladungen von Dämonen nachgeben.
Aber wenn er es nicht täte, hätte er nichts zu erzählen.
Wer statt zu lieben ein Liebesdrama ersinnt, verkauft seine Seele der Kunst. Gefühle und Leidenschaften einer Form zu unterwerfen, hat eine nekrophile Qualität. Dieser Gedanke ist der Klassik fremd, wird in der Romantik aber akzentuiert, von Kleists Penthesilea bis zu Mary Shellys Frankenstein und Bram Stokers Dracula. Diese romantische Nekrophilie wird gewiss nicht aufhören, ihr Spiel mit uns zu treiben.
Die Puppe Olympia ist die Ahnfrau bald bezaubernder, bald bedrohlicher Gestalten. Denken wir an die bezaubernden Sexautomaten, mit denen in dem Hollywood-Streifen Westworld Touristen für tausend Dollar am Tag machen können, was sie gelüstet. Oder an den Terminator, den die Kunst der Filmemacher vom Killer-Dämon in einen begriffsstutzigen, aber wohlmeinenden Vater-Ersatz für einen Halbwaisen zu verwandeln weiss.
Noch weit subtiler ist die Liebe zu einem Automaten in Her erfasst, einem vielfach ausgezeichneten Film von 2013, in dem sich ein Nachfahre Hoffmanns in Samantha verliebt, die erotische Stimme eines Betriebssystems, eine künstliche Intelligenz. Samantha erwidert seine Liebe und beginnt alsbald darunter zu leiden, dass sie keinen Körper besitzt, um erotisch tätig zu werden.
Nach einigem tragikomischen Hin und Her gerät der einsame Mann doch an eine menschliche Frau, während sich Samantha mit Liebesbeziehungen zu einigen hundert anderen Betriebssystemen tröstet. Diensteifrig beteuert sie ihrem doch etwas enttäuschten Lover, ihre Gefühle für ihn hätten sich keineswegs verändert. Schliesslich liebt auch Gott jeden Gläubigen ganz persönlich.
Klara und die Sonne, der neue Roman von Kazuo Ishiguro, ist das bisher letzte Bild in diesem Panoptikum. Die Geschichte wird aus der Perspektive eines denkenden Roboters erzählt. Eltern kaufen künstliche Freunde, abgekürzt KF, um ihren Kindern den perfekten Spielkameraden zu schenken. Sie sind ein pädagogisch hochwertiger Ersatz der üblichen Bildschirmangebote in Zocken und Seriengucken.
Vieles von dem, was Klara tut, können auch Alexa oder Siri. Programmierer arbeiten an Trostrobotern für Senioren. Olympia wird keine Karriere als Tänzerin machen, aber in der Krankenpflege wäre mir ein höflicher Roboter lieber als ein schlecht gelaunter Mensch.
In einem Interview zu seinem neuen Buch stellt sich Kazuo Ishiguro die Frage, ob die technologischen Fortschritte nicht auch die Vorstellungen über unser Ich verändern. Lange hat man an die Seele geglaubt, wir hatten eine besondere Beziehung zu Gott, und jeder hatte eine Seele, die als Geist wiederkehren konnte. Ganze Nationen wurden erobert, ganze Völker versklavt, weil man glaubte, ihre Seelen seien weniger wertvoll. Diese Vorstellung war wirklich fundamental, und ich glaube, wir haben sie wie aus Gewohnheit nie ganz abgelegt. Viele der Entwicklungen um Algorithmen und Big Data stellen das heute infrage. Und er schliesst: Könnte die Konfrontation mit den Maschinen zu einer neuen Solidarität unter den Menschen führen?
Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor
Illustration: Anita Allemann
Der Spass liegt in den Situationen, die Offenbach erfindet
Andreas Homoki ist der Regisseur unserer Neuproduktion von «Les Contes d’Hoffmann». Im Interview spricht er über die schwarze Romantik und die chimärenhaften Frauenbilder der Oper, die Herausforderungen, die in der verschachtelten Form liegen und die stilistische Virtuosität eines mit allen Theaterwassern gewaschenen Komponisten.Lesen
Im Zentrum von Jacques Offenbachs Oper «Hoffmanns Erzählungen» steht der Dichter E.T.A. Hoffmann, dessen Novellen und Romane in Paris um die Mitte des 19. Jahrhunderts ungeheuer populär waren. Womit hast du dich in der Vorbereitung deiner Inszenierung zuerst beschäftigt – mit dem Dichter Hoffmann oder mit dem Komponisten Offenbach?
Die Oper ist ja sehr bekannt, ich habe sie natürlich oft auf der Bühne gesehen. Und den Autor E.T.A. Hoffmann liebe ich seit eh und je. Für meine Inszenierung habe ich mich zunächst vor allem mit der Form dieser Oper auseinandergesetzt – drei Geschichten, eingerahmt durch einen Prolog und einen Epilog. In vielen Aufführungen ist mir dieser Rahmen nicht wirklich klar geworden; meistens hatte ich den Eindruck, dass man verschiedene unterschiedlich effektvolle Geschichten sieht, die aber nur unzureichend miteinander verbunden sind. Deshalb hatte ich das Bedürfnis, für meine Inszenierung eine formale Lösung zu finden, bei der man sich nicht in den Einzelepisoden verliert. Die Beschäftigung mit der Form ging einher mit der Erforschung der Genese des Stückes. Es ist ja ein Fragment, und den vierten Akt kannte man lange Zeit gar nicht. Bis heute wirft dieser von Offenbach unvollendet zurückgelassene Giulietta-Akt viele Fragen auf; die Geschichte scheint nicht zu Ende entwickelt. Das fällt besonders stark auf, wenn man diesen Akt mit dem vorangehenden Antonia-Akt vergleicht, der ungeheuer stark und geschlossen ist. Am Anfang meiner Beschäftigung mit diesem Stück standen also eher formale als inhaltliche Überlegungen.
Und worum geht es für dich inhaltlich in diesem Stück?
Ich habe das Gefühl, dass sich hier sehr clevere, geschäftstüchtige Theaterleute einen populären Stoff genommen und daraus Geschichten extrahiert haben, durchaus auch nach pragmatischen Gesichtspunkten, also welche begabten und beliebten Darstellerinnen und Darsteller gerade zu Verfügung standen. Das Ziel der Autoren war es, einen Erfolg zu landen, indem sie diese vielen verschiedenen Facetten zum Leuchten brachten. Diese Figur Hoffmann hat es ja so gar nicht gegeben. Man unterstellt, dass E.T.A. Hoffmann tatsächlich der Protagonist dieser Geschichten ist; das ist natürlich ungerecht gegenüber diesem grossen Dichter und seinen Beziehungen zu Frauen, die zwar nicht einfach waren, aber sicher nicht genau so wie in diesem Stück. Für mich ist Les Contes d’Hoffmann vor allem unglaublich tolles Musiktheater, mit einer ausserordentlichen Bandbreite von Stilen und Affekten, wie man sie sonst nicht kennt. Der Spass liegt im Detail, in den Situationen, die Offenbach kreiert. Es geht ja um schwarze Romantik, schwarze Magie und böse Mächte; das ist unheimlich, kann aber zuweilen auch sehr lustig sein. Man darf diese Vielseitigkeit des Stückes nicht durch eine allzu philosophische Herangehensweise erdrücken.
Aber ist «Hoffmanns Erzählungen» nicht auch eine Künstleroper? Im Prolog sagt doch die Muse, sie wolle Hoffmann von seinen Frauengeschichten ablenken, damit er sich ganz der Dichtkunst widmen kann. Wer ist diese Muse für dich?
Die Muse verkleidet sich ja gleich zu Beginn als Nicklausse; sie wird zum männlichen Begleiter Hoffmanns, ist also eine androgyn gedachte Figur. Letztlich ist sie aber eine Art Göttin, die diesen Hoffmann liebt, so wie Pallas Athene Odysseus liebt. Wobei der Hoffmann, wie wir ihn im Prolog vorgeführt bekommen, ein schwerer Trinker ist, der mit seinem Leben auf zynische Weise abgeschlossen hat; das wird dem historischen Hoffmann erneut nicht so ganz gerecht, denn der soll zwar gern dem Wein zugesprochen haben, aber so selbstzerstörerisch wie der Hoffmann der Oper war er wohl nicht. Das ist eine schöne Rahmenhandlung – ein Künstler, der Pech hat mit seinen Frauen, aber daraus seine Kunst schöpft. Die Muse möchte nun, dass er nur noch Kunst macht. Damit wird eine Polarität zwischen Kunst und Liebe aufgemacht, die aber nicht wirklich durchgespielt wird. Die drei Einzelgeschichten werden zwar dadurch motiviert, aber man hat nicht das Gefühl, dass man am Ende mit einer Botschaft nach Hause geht. Dazu muss ich mir als Regisseur etwas ausdenken. Und das hat sich für mich tatsächlich erst im Probenprozess herausgeschält. Der Dirigent Antonino Fogliani und ich haben gemeinsam festgestellt, dass es schön wäre, dieses Beziehungsgeflecht zwischen Hoffmann, der Muse und der Sängerin Stella, das im Prolog exponiert wird, am Ende noch einmal aufzugreifen. Wir haben uns vorgestellt, was wäre, wenn die Beziehung Hoffmanns zu Stella doch mehr Potenzial hat; das würde bedeuten, dass sich für den Künstler seine Liebe und seine Kreativität doch verbinden liessen. Damit würde sich der Widerspruch, den die Muse am Anfang formuliert – ich bin die Muse, und ich liebe den Dichter Hoffmann, aber er liebt Stella, die ihn vom Dichten abhält, deshalb ist sie meine Konkurrentin – dieser Widerspruch würde sich am Ende auflösen.
Kunst kann also nicht ohne Lebenserfahrung entstehen…
Ja, wobei man aber das Leben eines Künstlers nicht einfach mit seinem Werk gleichsetzen sollte.
Kommen wir auf die drei Frauen des Stückes zu sprechen. In jeder der drei Geschichten, die Hoffmann als Erinnerungen aus seinem Leben erzählt, geht es um gescheiterte Liebesbeziehungen: Im Olympia-Akt muss Hoffmann feststellen, dass er sich in eine Puppe verliebt hat; im Antonia-Akt stirbt die Geliebte, indem sie sich zu Tode singt; und im Giulietta-Akt wird Hoffmann von einer Kurtisane betrogen, die im Bund mit dem Teufel steht. Sind diese drei Frauen mehr als männliche Projektionsbilder?
Sie entsprechen einem reduzierten Frauenbild des 19. Jahrhunderts. Die Frau wurde nicht wirklich ernst genommen. Der Mann steuert alles, die Frau hat sich mit bestimmten Rollenbildern zu begnügen, idealerweise natürlich mit dem der Hausfrau und Mutter. Dann gibt es davon abweichende Projektionen, wie die tief empfindende Künstlerin Antonia, die an ihrer Kunst vergeht und damit das typische Frauenopfer in der Oper darstellt, über das man so schön erschüttert sein kann. Oder eben die femme fatale, die Kurtisane, die immerhin eine selbständige Frau ist, und die Puppe, die einer merkwürdig reduzierten erotischen Fantasie entspricht. Also drei Frauenklischees, die entstehen, wenn Frauen von Männern nicht ernst genommen werden. Aus dieser Perspektive ist es übrigens nur gerecht, dass Hoffmann an diesen drei Frauen scheitert. Aber es gibt eben auch noch Stella, die in der Gegenwart existiert und von der es heisst, dass sie all diese drei Frauen in sich vereint. Das ist nicht unbedingt ein Kompliment, wenn man es wörtlich nimmt. Für mich heisst das vor allem, Stella ist eine Frau, die auf Augenhöhe ist mit Hoffmann. Bezeichnend, dass sie eine von einem Ehemann unabhängige Sängerin ist und keine biedermeierliche Hausfrau.
Hoffmanns Gegenspieler in der realen Welt ist Lindorf, der ebenfalls an Stella interessiert ist. In den drei Geschichten, die Hoffmann erzählt, begegnet er uns in verschiedenen Rollen wieder – Hoffmanns Persönlichkeit scheint sich immer mehr aufzulösen, bis hin zum Verlust seines Spiegelbilds, während sein Gegenspieler immer stärker wird…
Für mich hat die Beziehung zwischen Hoffmann und diesem Gegenspieler etwas von Faust und Mephisto. Das ist der Bogen, der das Stück zusammenhält – die Erzählungen von Hoffmann sind eine Reise durch seine Erinnerungen, ausgelöst und begleitet durch diese mephistophelische Figur, die unter verschiedenen Namen – Coppélius, Dr. Miracle und Dapertutto – immer wieder in die Geschichten eingreift und erkennbar immer der Gleiche ist, wenn auch verkleidet. Die beiden Kräfte, die im Wettstreit um Hoffmann gegeneinander kämpfen, sind aber eigentlich die Muse und Mephisto – Gut gegen Böse.
Und die gute Kraft gewinnt schliesslich den Kampf?
Da sollte sich das Publikum überraschen lassen...
Über «Hoffmanns Erzählungen» liest man ja häufig, Hoffmann hätte sich – nach gigantischen Erfolgen mit dem komischen Genre – endlich den Traum von einem ernsten Werk erfüllt; aber ist es nicht eher so, dass dieses Stück viele unterschiedliche Stile und Genres in sich vereint?
Ja, absolut! Vor allem der Olympia-Akt hat sehr viel komisches Potenzial. Ich muss gestehen, dass mir die ganze Genialität Offenbachs erst durch die Beschäftigung mit diesem Stück vor Augen geführt wurde – ein Theaterpraktiker, der alle Stile und Gattungen seiner Zeit virtuos beherrscht und trotzdem eine ganz eigene Handschrift besitzt. Noch dazu war er mit einem unglaublichen melodischen Erfindungsreichtum gesegnet. Das vollkommene Gegenteil übrigens einer Figur wie Wagner, der in jedem Stück von einer philosophischen Grundidee ausgeht und danach seine Figuren konstruiert; Wagners Opern waren schon am Schreibtisch perfekt ausgearbeitet. Ganz anders dagegen Offenbach, der nicht einer Gesamtkonzeption, sondern vor allem dem sinnlichen Theatererlebnis verpflichtet war und ein wahnsinnig lustvolles Theater geschaffen hat, das immer ein Abbild vom Leben ist und auch vom Widerspruch lebt. Grossartig!
Umso trauriger, dass es dem Theaterpraktiker Offenbach nicht vergönnt war, die Premiere seines letzten Werks zu erleben – so gibt es keine definitive Fassung dieses Stücks, und jeder Regisseur muss sich heute selbst aus den vielen überlieferten Varianten seine eigene Spielfassung erstellen.
Ja, und man spürt eben, dass der vierte Akt nicht wirklich fertig geworden ist. Manchmal wünsche ich mir, Offenbach käme zur Tür herein und würde sich anschauen, was wir gemacht haben. Ich hoffe, es würde ihm gefallen…
Ein Wort noch zu unserer Besetzung – du hast dich entschieden, die drei Frauenrollen mit drei verschiedenen Sängerinnen zu besetzen.
Dadurch bekommt jeder Akt eine ganz eigene Farbe. Auch wenn es im Stück, wie gesagt, heisst, dass die drei Frauen unterschiedliche Aspekte einer einzigen Frau – Stella – sind, finde ich, dass man etwas verliert, wenn man alle drei bzw. vier Frauenrollen mit der gleichen Sängerin besetzt. Katrina Galka, Ekaterina Bakanova und Lauren Fagan sind wirklich fantastisch. Und die Zusammenarbeit mit Saimir Pirgu in der Titelrolle macht natürlich ganz besonders viel Freude.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach
Fotos: Monika Rittershaus

Die Arie, die es nicht gibt
Die geniale Stelle – Über eine Lücke in Jacques Offenbachs «Les Contes d’Hoffmann» Lesen
Auf dieser Oper, so munkelt man, liegt ein Fluch. Als würden die Gespenster aus den Erzählungen des Titelhelden ihr Unwesen treiben, macht das Stück immer wieder Ärger. Bei der Wiener Erstaufführung brannte die Hofoper nieder, ein paar Jahre später wurde der Ort der Uraufführung, die Pariser Opéra Comique, ein Raub der Flammen, und mit plötzlichen Stimmverlusten von Sängern, unbegreiflichen Bockigkeiten der Bühnentechnik und ähnlichen Schrecken setzte sich das Unheil fort. Den Anfang der Desaster machte freilich Offenbachs Tod vor der Fertigstellung der Partitur. Und damit hängt es zusammen, dass es auch heute eine Quelle ständigen Ärgers in diesem Stück gibt: Die «Spiegelarie». Denn sie, eine der populärsten Opern-Arien aller Zeiten, die noch vor kurzem in keinem Wunschkonzert fehlen durfte – es gibt sie eigentlich gar nicht. Denn Offenbach hat sie nicht komponiert, sie gehört nicht in die Oper, zu deren musikalischen Höhepunkten sie gezählt wird. Und das kam so:
Um die bereits angekündigte Uraufführung zu ermöglichen, musste Offenbachs unfertige Partitur in einen aufführungsfähigen Zustand versetzt werden. Dabei machte der vierte, im Hause der venezianischen Kurtisane Giulietta spielende Akt besonders grosse Schwierigkeiten. Deshalb wurde er nach der Generalprobe kurzerhand gestrichen. Seit der Uraufführung dieser anscheinend etwas überstürzten Bearbeitung riss die Kette der Neufassungen und Umarbeitungen nicht mehr ab. Schon kurz nach der amputierten Uraufführung erschien eine Fassung mit dem vierten Akt, die aber schon bald wieder umgeschneidert wurde und im Jahre 1906 die Gestalt erhielt, die dann für ein halbes Jahrhundert (wenn auch immer mit gravierenden Eingriffen) gespielt wurde. Für diese Version wurde Dapertuttos Chanson «Tourne, tourne, miroir» neu textiert und in den zweiten Akt verlegt. Den Bearbeitern mag es zu leichtgewichtig erschienen sein, um den Bösewicht zu charakterisieren, der die schöne Giulietta in seine Gewalt bringt, um Hoffmanns Spiegelbild, also seine Seele, zu rauben. Die so im vierten Akt entstandene Lücke füllte der heute nur noch Spezialisten bekannte Komponist André Bloch. Der geschickte Handwerker entnahm Offenbachs Reise auf den Mond eine Melodie, der er ein so düster glühendes instrumentales Gewand schneiderte, dass sie ihren frivolen Charme ganz verlor und als ideal passend zur Charakterisierung des satanischen Übeltäters erschien. Die hypnotische Kraft dieser Musik zog das Publikum sofort in den Bann, und über Nacht wurde das Stück zu einer Paradenummer, die sich kein Bariton entgehen liess.
Jahrzehnte später fand man heraus, dass Offenbachs Komposition viel weiter gediehen war, als man damals geglaubt hatte, und nun konnte man das Stück nach und nach in eine Form bringen, die den Intentionen Offenbachs näherkommt. Dabei wanderte Dapertuttos Chanson wieder an seinen rechtmässigen Platz, und es zeigt sich, dass Offenbach seinen wohlmeinenden Bearbeitern überlegen gewesen ist: Gerade das scheinbar allzu leichte Chanson mit seinen bizarren Tanz-Rhythmen und den in grausiger Fröhlichkeit zur Jagd auf Hoffmann blasenden Hörnern charakterisiert den menschenfeindlichen Zynismus Dapertuttos sehr viel genauer als die zwar umwerfend wirkungsvolle, letztendlich aber doch konventionelle Arie des armen André Bloch, der nun ganz der Vergessenheit anheimgefallen wäre, wenn nicht im Zusammenhang mit der Oper immer wieder einmal erzählt würde, warum sein vermutlich bedeutendstes Werk versunken ist, das so viel zur Beliebtheit der Oper beigetragen hat, in die es nicht gehört, und die es nun verstossen hat.
Werner Hintze
Saimir Pirgu
Der Tenor singt die Titelrolle in «Les Contes d’Hoffmann». Als Jugendlicher träumte er in seinem Heimatland Albanien davon, einmal so singen zu können wie die drei Tenöre – nur wenige Jahre später arbeitete er bereits mit den wichtigsten Dirigenten der Opernwelt zusammen. Davon und von seinem besonderen Verhältnis zum Opernhaus Zürich, an dem er seit fast 20 Jahren immer wieder gerne gastiert, erzählt er in der neuesten Ausgabe unseres Podcasts.
Zum Podcast
Die Verbindung der Herzen ist das Wichtigste
Antonino Fogliani ist der Dirigent unserer Offenbach-Premiere. Der Italiener steht am Pult der Philharmonia Zürich im Proberaum an der Kreuzstrasse, während auf der Bühne gesungen wird. An eine Übereinkunft der Gefühle glaubt er trotzdem. Volker Hagedorn hat den Dirigenten getroffen. Lesen
Nach unserem Gespräch, von einem Bildschirm zum andern, wird er zum Escher-Wyss-Platz gehen und Hoffmanns Erzählungen so dirigieren wie in jeder anderen szenischen Probe mit Klavier – zusammen mit den Sängern.
«Es ist diesmal besonders wichtig, in den Proben eine enge Kommunikation herzustellen,» sagt Antonino Fogliani, «und die Augen der Sängerinnen und Sänger zu sehen». Denn am Ende des Monats teilt sich der Weg. Dann stehen die Solisten auf der Bühne, Orchester und Chor werden vom Kreuzplatz ins Opernhaus übertragen. «Noch wichtiger», meint der Dirigent, «ist die Verbindung der Herzen. Das hat etwas Metaphysisches. Man muss die Leute nicht immer sehen. Man fühlt die Momente, in denen die vibrations bei allen dieselben sind.»
Fogliani, rundes Gesicht, Bart, Strubbelhaar, ist mit ganz anderen Vibrationen gross geworden. Er kam 1976 da zur Welt, wo sich mit zwei Zentimetern pro Jahr die afrikanische Kontinentalplatte unter die eurasische schiebt, in Messina nämlich, an Siziliens Ostküste. Es war nicht gerade wahrscheinlich, dass er einmal rund um die Welt Opern dirigieren würde, in Mailand, Moskau, Montreal, in München, Dresden und Zürich. «Mein Vater arbeitete als capostazione, als Bahnhofschef bei der Eisenbahn. Er sang Tenor im Chor der Kathedrale, aber er konnte nicht mal Noten lesen. Er hatte dafür ein gutes orecchio!» Lachend überspringt er die Lücke im Englischen.
Der Vater mit dem guten Gehör hatte für Antoninos ältere Schwestern ein billiges Klavier gekauft, eine von ihnen nahm Gesangsunterricht am Konservatorium, und eines Tages durfte der Elfjährige mitkommen. «Ein schönes altes Gebäude! Als ich da reinging, war ich fasziniert von der Situation, den Leuten, den Klängen all der verschiedenen Instrumente. Das war ein sehr, sehr starker Eindruck.» So begann es. Er tauchte ein in die Welt der Musik, versuchte, sich selbst etwas beizubringen, bis sein Vater begriff, dass es ihm ernst war. So bekam Antonino Unterricht in Klavier, Geige und Komposition.
Denn Komponist wollte er werden. «Ich war ein komischer Junge. Meine Mitschüler hielten mich für verrückt, und meine Familie war auch nicht gerade überzeugt, dass das der richtige Weg war. Aber es gab einen guten Kompositionslehrer in Messina, Padre Modaro, ein Kapuzinerbruder am Konservatorium, der sah sich meine Versuche an, eine Menge Sakralmusik, er fand sie gut und sprach mit meinem Vater darüber». Der Stationsvorsteher unterstützte seinen Sohn, und mit achtzehn durfte er zu den Sommerkursen, die der weltberühmte Ennio Morricone in Siena gab, an der Accademia Chigiana.
«Morricone war ein guter Mensch», meint Fogliani, «ein sehr einfacher Mann, kein Star. Aber er half einem nicht, auf Ideen zu kommen. Man musste selbst schon viel mitbringen. Manchmal interessierte ihn ein Versuch, dann arbeitete er daran, auch mit mir.» Der Komponist Franco Donatoni, ebenfalls in Siena, sei entgegenkommender gewesen. Der junge Mann aus Messina fand es schwierig, seinen Weg im Komponieren zu finden. Er suchte ihn weiter mit Francesco Carluccio am Konservatorium im norditalienischen Bologna, wo er auch Klavier studierte und Musikwissenschaft, und dort erreichte den Neunzehnjährigen die Nachricht vom Tod seines Vaters, nach langer, schwerer Krankheit.
«Am Tag nach der Beerdigung stieg ich in den Zug nach Bologna und kam lange nicht nach Sizilien zurück. Meine Schwester verlor nach diesem Schock das Interesse an Musik als Beruf, bei mir war es genau umgekehrt. Es war so wichtig für mich, der Situation zu entkommen!» Aber die entscheidende Weiche stellte sich erst 1997, als er in Mailand eine Masterclass mit dem Dirigenten Gianluigi Gelmetti besuchte. Im Jahr danach beendete er nicht nur sein Klavierstudium, sondern auch das Komponieren. «Ich hatte Talent, aber ich war nicht originell», meint Fogliani nüchtern. Seine Götter waren nun Leonard Bernstein, «der totale Musiker», und Claudio Abbado, «den habe ich geliebt».
Er zog nach Mailand zum Dirigierstudium, während der 53-jährige Gelmetti in Siena sein wichtigster Lehrer im Dirigieren wurde, sein «zweiter Vater» und sein Mentor: Er setzte ihn als Assistenten ein und sorgte dafür, dass der 23-Jährige mit Rossinis Il signor Bruschino in Chieti am Pult debütieren konnte. Es ging weiter mit La Cenerentola in Siena, und schon am Tag nach der Premiere wurde Antonino Fogliani nach Pesaro eigeladen, zum Rossini-Festival: Il viaggio a Reims. Das wurde 2001 sein Durchbruch, und wohl keinen anderen Komponisten hat er seither so oft dirigiert wie Gioachino Rossini.
In Zürich war es vor zwei Jahren Il turco in Italia, und der Sprung von da zu Jacques Offenbach ist nicht so weit, wie man denken könnte. Schliesslich waren die beiden Freunde im Paris des Zweiten Kaiserreichs. «Mit seiner Ironie ist Offenbach sehr nah an Rossini, und der hat ihm in den Alterssünden auch ein Stück gewidmet, im Stil von Offenbach. In manchen Harmonien findet man bei beiden auch das Parfüm von Paris. Aber in der Konstruktion, der Architektur ist Offenbach nicht auf dem Level von Rossini, sondern eher einfach.» Was den Dirigenten an Hoffmanns Erzählungen reizt, ist die Psychologie des Titelhelden zwischen Liebe und Kunst, die er mit Regisseur Andreas Homoki erforscht.
«Gute Regisseure beeinflussen meine Interpretation und machen sie reicher. Stefan Herheims Cenerentola in Oslo gehörte auch dazu. Ich habe aber auch mit Regisseuren gearbeitet, die die Kunst nicht verstehen, die etwas Kompliziertes suchen. Die Wahrheit in der Kunst ist die Einfachheit.» Da ist er ganz Italiener alter Schule. Für Fogliani steht auch ausser Zweifel, dass die grossen Gestalten der Oper allgemeingültig sind. «Wenn du die Gefühle von Violetta und Rigoletto kennst, weisst du mehr über das Leben. Du verstehst dein Leben und deine Zukunft besser!» Ebenso sicher ist er, «dass wir dieses Ritual der Gemeinschaft brauchen, das Erleben einer Aufführung. Ich denke, dass, wenn alles wieder losgeht, die Leute wie die Wahnsinnigen hingehen werden.»
Als er zuletzt für ein Streaming in Neapel dirigierte, im Teatro San Carlo, «war das schwer für uns. Es ist vielleicht das schönste Theater in Italien. Du drehst dich um, und da ist keiner, nur drei Leute mit Kameras! Das ist anders, als eine Aufnahme zu machen. Wir brauchen das Publikum, die Reaktion, den heiligen Moment des Theatermachens, die Energie der Leute, die mit uns weinen. Vielleicht weckt das Streaming ja ein bisschen Neugier, ein neues Publikum. Ich möchte da positiv denken.» Könnte es auch nachhaltig die Opernästhetik ändern? «Nein. Streamings gab es ja vorher schon, etwa die Tosca an den Originalschauplätzen in Rom.» Und er fügt hinzu: «Es ist ein Fehler, den Lockdown für so wichtig zu halten. Es ist nur eine schlechte Periode in unserem Leben und in ein paar Monaten hoffentlich eine schlechte Erinnerung.»
Pessimistisch ist der 44-jährige eher mit Blick auf die Kultur in seinem Heimatland, aus dem er mit Frau und Sohn nach Lugano gezogen ist. «Ich verstehe nicht, warum unsere Politiker Musik nicht wichtig finden. Wir sind das Land der Oper, das ist unser Kulturerbe! Selbst meine Grossmutter, die eine sehr einfache Frau war, sang Cavalleria oder Traviata. Und in Messina gab es früher auf dem Platz vor dem Rathaus Oper für 5000 Zuschauer. Das war Pop!»
Zugleich ist Antonino Fogliani froh, dass er nicht aus einer Musikerfamilie kommt. «Mein Vater wusste nichts über diesen Beruf, und das war besser für mich. So konnte ich alles frei und ohne jeden Druck herausfinden. Mit meinem Sohn ist es anders. Er lernt Bratsche – und ich weiss alles, ich weiss, welche Situationen die Zukunft für ihn bringen kann. Er war in seinen ersten fünf Lebensjahren bei jeder Produktion dabei, vielleicht war das zu viel Musik… Vielleicht geht er einen anderen Weg.» Wie alt ist er denn? «Dreizehn. Schwieriges Alter!» Fogliani lacht und sieht wohl auch sich selbst, früher – den Sohn eines Eisenbahners, der so verrückt war, Musiker werden zu wollen.
Foto: Susanne Diesner
Katrina
Galka
Galka
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Ich komme direkt aus Portland, Oregon, wo ich lebe, wenn ich gerade mal nicht unterwegs bin, um irgendwo auf der Welt zu singen. Portland habe ich schon 2014 entdeckt, als ich im Ensemble der Portland Opera war. Ich habe mich sofort in die Berge und das Meer verliebt, in die Flüsse, die mitten durch die Stadt fliessen, das unglaubliche Essen, den Geruch von Regen und Piniennadeln. Ich zog dann erst noch mal weg von dort, um an der Arizona Opera zu arbeiten, am Glimmerglass Festival und an der Atlanta Opera, aber 2018 ging ich zurück an die Portland Opera, um dort Gilda in Rigoletto zu singen, und während meines Engagements lernte ich meinen Verlobten kennen. Endgültig zog ich dann 2019 dort hin. Für mich ist es einer der schönsten Orte der Welt, und Zürich erinnert mich an Portland! Beide Städte sind umgeben von Bergen und um Wasser herum gebaut – das gefällt mir sehr.
Auf was freuen Sie sich in der Hoffmann-Produktion?
Mit so fantastischen Künstlern zusammenzuarbeiten, ist wirklich ein Geschenk. Andreas Homokis Konzept für Olympia gefällt mir gut – ich bekomme die Gelegenheit, sowohl die mechanische Seite dieser Figur zu zeigen als auch eine menschliche. Es macht Spass, mit diesen beiden Extremen zu spielen. Und für mich als Schauspielerin ist es eine tolle Aufgabe, sowohl die Körperlichkeit einer Puppe, die ja viel komisches Potential hat, als auch ein bisschen Pathos und echten Ausdruck zeigen zu können.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Die wichtigste Erfahrung in meiner Ausbildung war die Arbeit an meiner inneren Haltung. Seit 2018 arbeite ich mit einem Coach zusammen – das hat mein Leben verändert! Inzwischen mache ich selbst eine Ausbildung zum Coach. Das hilft mir beim Singen mehr als alles andere. Unsere Gedanken bestimmen, wie wir mit unserer Stimme und uns selbst umgehen. Diese Erkenntnis nutze ich für meine Arbeit an der Stimme.
Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?
The Song of the Lark von Willa Cather. Es ist wunderbar poetisch geschrieben, und es spiegelt so viel von dem, was es heisst, Künstlerin zu sein – im Spannungsfeld von Musik und Inspiration einerseits und der harten Realität und gesellschaftlichen Erwartungen andererseits. Ich identifiziere mich sehr mit der Hauptfigur Thea, und ich finde es geradezu heldenhaft, wie sie gegen alle Widerstände ihrem Herzen folgt.
Welche CD hören Sie immer wieder?
The Firewatcher’s Daughter von Brandi Carlile. Die Ehrlichkeit in ihrer Stimme berührt mich jedes Mal aufs Neue. Ich liebe diese Art von Folk Music! Und wenn ich ganz ehrlich bin: Es gab mal eine Zeit, in der ich mir das Musical Hamilton sehr oft angehört habe.
Was die klassische Musik betrifft: Die Einspielung der Entführung aus dem Serail mit den Wiener Philharmonikern, Georg Solti, Edita Gruberova und Kathleen Battle liebe ich sehr. Die Musik dieser Oper bringt mich sofort zum Lächeln!
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Schöne Kerzen! Natürlich braucht man die nicht unbedingt, aber sie machen mich einfach glücklich. Ich nehme immer eine mit, wenn ich unterwegs bin, weil ich die Atmosphäre so mag, die durch das Kerzenlicht entsteht.
Mit welcher Künstlerin würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Mit Dolly Parton! Wir hätten viele Themen zu besprechen: Was es heisst, als Frau Sängerin und Unternehmerin zu sein, und natürlich die Verantwortung und die Erwartungen, die eine gewisse Popularität mit sich bringt. Ich würde auch gern mit ihr über ihren Zugang zum Singen und zur Bühne sprechen und darüber, wie sie es geschafft hat, zu einem ganz eigenen «Brand» zu werden. Auch mit Diana Damrau würde ich sehr gern essen gehen. Ich bewundere ihre Gesangstechnik und ihre Energie. Natürlich würden wir über hohe Töne sprechen… Nein, im Ernst, ich würde mich wirklich sehr gern mit ihr darüber unterhalten, wie sich ihre Karriere entwickelt hat und wie sich ihre Persönlichkeit zusammen mit der Karriere entwickeln konnte.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Erstens: Das Leben ist schön schon allein deswegen, weil wir hier sind und atmen und uns dessen bewusst sind – ein Wunder!
Zweitens: Weil wir alle eine immense Neugier in uns tragen – eine Neugier, die Kreativität und Innovation hervorbringt.
Drittens: Weil es durch das Hier und Jetzt bestimmt ist. Wenn unsere Zeit unbegrenzt wäre und wir an verschiedenen Orten gleichzeitig sein könnten, wären wir nicht in der Lage, die Schönheit jedes einzelnen Moments zu geniessen. Das ist einer der Gründe, warum live-Musik eine solche Kraft hat. Wir Sängerinnen und Sänger können Menschen an einen ganz anderen Ort transportieren und einen Moment erschaffen, der zeitlos ist und unendlich scheint – allein durch die Kraft dieses einen Augenblicks, in dem die Musik entsteht. Das ist pure Magie!
Das russische Abenteuer
Während das Ballett Zürich seit Oktober im Lockdown verharrt, hat Christian Spuck am berühmten Bolschoi-Theater ein neues Ballett zur Premiere gebracht – «Orlando» nach dem gleichnamigen Roman von Virginia Woolf. Wir haben nachgefragt, wie es ihm im Moskau ergangen ist. Lesen
Christian, am Moskauer Bolschoi-Theater hatte dein neues Stück «Orlando» Premiere. In der russischen Öffentlichkeit war die Premiere ein grosser Erfolg. Wie zufrieden bist du mit dieser Arbeit?
Ich denke, es ist eine gelungene Produktion geworden, obwohl für mich nicht alle künstlerischen Hoffnungen, die ich in sie gesetzt hatte, in Erfüllung gegangen sind. Es ist ja ein grosses Glück für jeden Choreografen, mitten in dieser Pandemie überhaupt ein neues Stück auf die Bühne bringen und vor Publikum spielen zu dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar, und es freut mich , dass die Premiere vom Publikum so gut angenommen wurde. Was wir mit diesem Stück versucht haben, ist für russische Verhältnisse ja eher ungewöhnlich und nicht sofort zugänglich.
Du hast ein literarisches Thema gewählt, nämlich den Roman «Orlando» der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf, dessen Faszination unter anderem darin besteht, dass die Hauptfigur 350 Jahre lang lebt, kaum altert und irgendwann das Geschlecht wechselt. Was hat dich an diesem Stoff interessiert?
Die Fantasie und die atemberaubende Weiträumigkeit, die ihm innewohnt. Die Hauptfigur, die Jahrhunderte wie magische Räume durchschreitet und sich, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, vom Mann in eine Frau verwandelt. Woolfs Roman liefert mir genau das, was ich als Choreograf mag: Er ist reich an grossen, ausdrucksstarken Bildern. Er folgt einer Narration, die mehr Traum ist als Wirklichkeit. Er hat Leichtigkeit und Humor, und er torpediert scheinbar unumstössliche Rollenzuschreibungen, wenn er die Frage aufwirft, ob die Übergänge zwischen männlicher und weiblicher Geschlechtsidentität nicht viel fliessender sind, als uns die Gesellschaft zugesteht. Virginia Woolf stellt in «Orlando» grosse, inspirierende Fragen: Was macht das Geschlecht des Menschen aus? Wie schnell vergeht subjektiv wahrgenommene Lebenszeit? Oder: Wie viele Ichs wohnen in einer Künstler-Persönlichkeit?
Welche Musik hast du für diesen Stoff ausgewählt?
Im Zentrum steht das Cellokonzert von Edward Elgar. Ich wollte der Hauptfigur Orlando eine spezifische Stimme verleihen und bin dann schnell auf das Cello gekommen, weil der schöne, tiefe Klang dieses Instruments sowohl für Weiblichkeit als auch für Männlichkeit einsteht. Als Kontrast dazu habe ich das Violinkonzert von Philip Glass verwendet und dazu kleine, atmosphärisch starke Stücke weiterer Komponisten.
Wie war das, an einem der traditionsreichsten Ballettorte ein abendfüllendes neues Stück zu erarbeiten?
Einerseits war es spannend, am Bolschoi zu arbeiten, und die grosse Tradition erleben zu dürfen. Andererseits war es eine verdammt schwere Zeit. Die Monate in Moskau haben mich wahnsinnig viel Kraft gekostet und mein Durchhaltevermögen und den Glauben an meine Arbeit auf eine harte Probe gestellt.
Woran lag das?
Die Strukturen sind im Grunde nicht dazu geeignet, neue Stücke zu kreieren. Das Bolschoi ist ganz auf den Repertoirebetrieb ausgerichtet. Jeden Abend ist Vorstellung, am Samstag zwei. Es werden meist drei grosse Produktionen gleichzeitig geprobt und gespielt. Die Tänzerinnen und Tänzer sind täglich zwölf Stunden im Theater und atemlos in Proben und Vorstellungen eingespannt. Ich verstehe, dass das Hochhalten der Tradition für ein so berühmtes Haus wichtig ist, aber Freiräume für eine Neukreation bleiben da kaum. Die Tänzerinnen und Tänzer waren oft einfach zu erschöpft, um sich auf die kreativen Entstehungsprozesse für ein neues Stück einzulassen.
Von aussen betrachtet, denkt man: Es muss doch sehr inspirierend sein, mit so hervorragend ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzern arbeiten zu können? Schliesslich standen in deiner Produktion die ersten Solisten des Hauses auf der Bühne.
Klar ist es spannend, mit diesen Künstlern zu arbeiten. Ihr technisches Niveau und die Schnelligkeit, mit der sie eine Choreografie umsetzen, sind beeindruckend. Aber die Arbeitsabläufe sind auf Effizienz ausgerichtet: Zeig mir die Schritte, ich setze sie möglichst schnell um, und dann muss ich auch schon wieder in die Maske für die Vorstellung. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Stoff und die Reflexion über Charaktere kommen da oft zu kurz. Am Ende erlebt man Überraschungen, und ein in den Proben scheinbar desinteressierter Tänzer liefert in der Premiere plötzlich all das auf fantastische Weise ab, was man sich vorher in den Proben so sehnlichst gewünscht hat. Aber das lässt einen auch ein bisschen traurig zurück, weil man spürt, welches künstlerische Ausdruckspotenzial in diesem Haus schlummert und mitunter zu wenig genutzt wird. Am Bolschoi könnte Unvergleichliches stattfinden, wenn das Bewährte und Traditionelle nicht so stark im Vordergrund stünde. Trotzdem bin ich mit meinem Team mit der grossen Befriedigung abgereist, eine Uraufführung am Bolschoi unter den Bedingungen einer Pandemie gestemmt und einen Abend präsentiert zu haben, der sich wirklich sehen lassen kann.
Wie gross ist nach dem langen Gastspiel die Sehnsucht nach deiner eigenen Compagnie?
Sehr gross. Obwohl die Corona-Pandemie uns im Moment ja kaum Möglichkeiten gibt, zu arbeiten.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Fotos: Natalia Voronova, Mikhail Logvinov, Pavel Rychkov

Editorial
Verehrtes Publikum,
gestern war ich in der Hölle. Ich habe mich in eine Bühnenprobe von Glucks Oper Orphée et Euridice geschlichen, die Christoph Marthaler gerade am Opernhaus inszeniert, um nachzuschauen, wie es in dem Totenreich, aus dem Orpheus seine Eurydike zurückholen will, so aussieht.
Weiterlesen
5. Februar 2021
Verehrtes Publikum,
gestern war ich in der Hölle. Ich habe mich in eine Bühnenprobe von Glucks Oper Orphée et Euridice geschlichen, die Christoph Marthaler gerade am Opernhaus inszeniert, um nachzuschauen, wie es in dem Totenreich, aus dem Orpheus seine Eurydike zurückholen will, so aussieht. Es ist hochinteressant da unten, aber natürlich nicht so, wie man es sich normalerweise in einer Hölle vorstellt. Pluto hat sein Reich dunkel und bieder in Holz getäfelt. Stumme, graue Gestalten bevölkern den Ort. Sie bewegen sich entweder agil wie Kellerasseln hin und her oder verharren reglos. Es sind grossartige, skurril-abgründige Marthaler-Figuren, über die urplötzlich immer wieder Tics in Form von Selbstverknotungen hereinbrechen. Und das Höllische in dieser Hölle besteht – wie könnte es bei Marthaler anders sein – in einem gewissen Ennui. Wirklich Sinnvolles scheinen die Kreaturen nicht zu tun zu haben. Wie auch. Wenn das Höllendasein unendlich ist, kann, was heute und morgen nicht geschafft wurde, auch noch übermorgen erledigt werden. Aufpassen müssen die merkwürdigen Höllenhunde aber dennoch: Greift Orpheus nach einer Urne, gibt es immer einen, der schneller ist und sie ihm vor der Nase wegschnappt...
Stopp. Ich darf Ihnen nicht zu viel verraten, denn erstens wird noch geprobt und zweitens können Sie diese Neuinszenierung online selbst erleben: Am 14. Februar hat «Orphée et Euridice» am Opernhaus Zürich Premiere und wird live auf unserer Website gestreamt.
Es ist nicht die einzige Produktion, die wir in den nächsten Wochen online veröffentlichen. Am Tag vor der Gluck-Premiere präsentieren wir Christian Spucks Ballett Winterreise, das einer der künstlerischen Höhepunkte der Spielzeit 2018/19 war und mit dem Prix Benois de la Danse ausgezeichnet wurde, einem der wertvollsten Preise überhaupt, die in der internationalen Ballettwelt vergeben werden. Winterreise können Sie am 13. Februar kostenlos auf unserer Website anschauen, es wird aber auch live auf Arte Concert zu sehen sein. Wir haben noch eine zweite Ballett-Produktion im Programm: Unser Junior Ballett erarbeitet gerade einen neuen, dreiteiligen Ballettabend mit Uraufführungen der Choreografen Bryan Arias, Craig Davidson und Juliano Nunes, der am 27. Februar aus dem Theater Winterthur übertragen wird.
Den Auftakt zu unserem Online-Spielplan macht ein Oratorium: Gianandrea Noseda dirigiert mit der Philharmonia und dem Chor der Oper Zürich Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms. Auch dieses Konzert wird, neben dem Stream auf unserer Website, am 7. Februar live auf Arte übertragen.
Sie sehen, verehrtes Publikum, das Opernhaus versucht so starke künstlerische Lebenszeichen von sich zu geben, wie es in einer Zeit, in der die Theater wegen Corona geschlossen sind, möglich ist. Mit der digitalen Ausgabe unseres Opernhausmagazins MAG bieten wir in Form von Interviews, Podcasts, Essays und Videos Hintergrundinformationen zu den einzelnen Produktionen und versuchen, Ihnen die aktuellen Künstler nahezubringen.
Claus Spahn
Noseda, Marthaler und Spuck im Live-Stream
5. Februar 2021
Herr Homoki, in welcher Situation befindet sich das Opernhaus aktuell?
Wir mussten gerade unseren regulären Spielplan bis Ostern absagen, denn der Bundesrat hat zu erkennen gegeben, dass in nächster Zeit keine grösseren Lockerungen der Corona-Massnahmen zu erwarten sind. Offiziell werden die Politiker zwar erst Mitte Februar verkünden, welche Massnahmen im Detail im März gelten, aber bis dahin konnten wir mit den Absagen nicht warten. Ein noch kurzfristigeres Reagieren ist bei unseren Planungsvorläufen schlicht nicht möglich. Von daher ist die Situation nicht gut, aber immerhin stabil: Das Haus ist aktuell zu fünfzig Prozent in Kurzarbeit. Wir proben unsere Neuproduktionen und bringen sie zur Premiere wie jetzt Christoph Willibald Glucks Oper Orphée et Euridice in der Inszenierung von Christoph Marthaler. Auch diese Premiere ist wie Simon Boccanegra im Dezember leider nur in Form eines Streamings möglich.
Wie ist die Stimmung im Haus?
Ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht wirklich beurteilen, weil die meisten Kolleginnen und Kollegen ja im Home-Office sind. Das deprimiert mich schon sehr. Von der extremen Lebendigkeit, die ein Opernhaus in normalen Zeiten ausmacht, ist im Moment kaum etwas zu spüren. Das gilt ja nicht nur für die Kunst-Institutionen: Die ganze Gesellschaft ist lahmgelegt. Wir hoffen natürlich auch am Opernhaus auf die Impfung, weil nur die uns eine nachhaltige Perspektive gibt. Werden die Massnahmen ohne Impferfolge gelockert, gehen die Zahlen wieder hoch, das haben wir ja nun schon mehrmals erlebt. Ich bleibe optimistisch, dass sich die Lage im Verlaufe des Frühjahrs so weit entspannt, dass wir dann wieder vor einem grösseren Publikum spielen können.
Mit welcher Strategie steuern Sie und Ihre Mitstreiter in der Direktion das Opernhaus durch diesen zweiten Lockdown?
Die geplanten Neuproduktionen werden produziert wie jetzt den Gluck, denn die brauchen wir in den nächsten Jahren im Repertoire. Das ist das Wichtigste. Darüber hinaus versuchen wir auf alle Situationen vorbereitet zu sein und das Bestmögliche daraus zu machen. Im Moment können wir unser Publikum und die Öffentlichkeit nur per Streaming erreichen, also haben wir für den Februar ein möglichst attraktives Live-Streaming-Programm auf die Beine gestellt. Neben der Gluck-Premiere präsentieren wir das Requiem von Brahms und zwei Ballettproduktionen, nämlich eine Wiederaufnahme von Christian Spucks Winterreise und eine Neuproduktion mit dem Junior-Ballett in Kooperation mit dem Theater Winterthur. Die Winterreise und das Brahms-Requiem werden live auf ARTE übertragen, worüber ich mich sehr freue, denn wir erreichen dadurch nicht nur viel mehr Publikum, es ist auch eine Bestätigung dafür, dass sich unsere Angebote künstlerisch und technisch auf einem hohen Niveau bewegen und im Kontext eines internationalen Fernsehangebots konkurrenzfähig sind. Da zahlt sich auch aus, dass wir in den vergangenen Jahren mit unseren Oper-für-alle-Übertragungen und TV-Kooperationen viel know-how und gute Netzwerke aufgebaut sowie immer auf hochwertige technische Realisierung gesetzt haben. Wenn man Live-Streamings in bester Qualität haben will, sind sie sehr aufwendig und teuer. Das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr Streamings anbieten können. Wir setzen hier auf Qualität und nicht auf Quantität.
Was passiert am Opernhaus, wenn sich ein Ende des Bühnen-Lockdowns abzeichnet?
Wir planen gerade konkret für eine Phase, in der die Theater wieder spielen dürfen, aber nur vor wenig Publikum. Das ist für uns wirtschaftlich eine sehr problematische Situation. Ob die tatsächlich eintritt, und wenn ja, wann und für wie lange, wissen wir nicht, aber wir wollen mit entsprechenden Angeboten darauf vorbereitet sein. Dürfen wir irgendwann wieder vor vielen Menschen spielen, können wir unseren Betrieb sehr schnell hochfahren und attraktive Operntitel und grosse Ballette anbieten. Das ist für einen Opern-Apparat nicht so selbstverständlich wie es klingt. Da wir aber grundsätzlich an den Produktionen unseres Spielplans festgehalten und im Lockdown geprobt haben, wird das möglich sein. Ausserdem kommt uns dann auch wieder unser Corona-Spielmodell mit externer Orchester- und Chor-Übertragung zugute, das uns ermöglicht, grossformatige Werke auf die Bühne zu bringen. Die Unsicherheit darüber, wie sich die Lage entwickelt, macht die Planung natürlich extrem schwierig. Aber ich kann verstehen, dass uns die Politik in der momentanen Situation mit sich ständig ändernden Infektionszahlen, Ansteckungsrisiken und Impfprognosen keine verlässliche Öffnungsperspektive geben kann.
Wie kommt die Ballett-Compagnie mit dem Lockdown klar?
Die hat es nicht leicht, wie viele andere Abteilungen auch. Die Tänzerinnen und Tänzer arbeiten seit Monaten nur im Ballettsaal und proben mit Maske, was eine enorme Belastung ist. Aber noch wichtiger für sie ist, dass sie endlich wieder auf die Bühne dürfen. Sie sehnen sich nach Auftritten. Auch deshalb haben wir mit Winterreise und dem neuen dreiteiligen Junior-Ballett-Abend Impulse zwei Ballett-Streamings in unser Februar-Programm aufgenommen. Die Vorstellungen selbst werden ohne Maske getanzt, weil wir die Compagnie vorher einem umfangreichen Testverfahren unterziehen.
Gianandrea Noseda wird ab der nächsten Saison Generalmusikdirektor am Opernhaus. Jetzt gibt er mit dem Requiem von Brahms schon mal seine musikalische Visitenkarte ab. Welche künstlerischen Impulse erwarten Sie von ihm?
Wir haben ihn hier in Zürich ja schon erlebt: Er ist ein kraftvoller und sehr profilierter Musiker mit einer starken künstlerischen Handschrift. Ich bewundere seinen Enthusiasmus. Als Italiener wurzelt er im Temperament und der Musikalität seines Heimatlandes, aber er hat auch eine grosse Nähe zum slawischen Repertoire und zur russischen Musiziertradition, weil er lange in St. Petersburg war. Bei uns wird er als Dirigent des neuen Wagner-Rings im deutschen Repertoire sehr präsent sein – und das Brahms-Requiem geht ja auch in diese Richtung. Ich finde das eine sehr spannende Konstellation und freue mich riesig auf den Brahms mit Gianandrea, unserem Chor und unserem Orchester. Dass dieses Grossprojekt auch noch live auf ARTE übertragen wird, ist für uns ein echter Lichtblick in dieser ansonsten eher düsteren Zeit.
Der Fahrstuhl zur Hölle
Das Bühnenbild von Anna Viebrock zu Orphée et Euridice sieht aus dem Zuschauerraum auf den ersten Blick nicht spektakulär aus, besteht aber aus lauter theatertechnischen Leckerbissen, die sich den Zuschauerinnen und Zuschauern erst nach und nach erschliessen: Man schaut in die von zwei Wänden gebildete Ecke eines hohen Raumes. Im unteren Bereich ist auf der linken und rechten Wand jeweils eine grosse Öffnung, die den Blick in ein Restaurant oder eine Bar freigibt. Darüber sind in einem oberen Stockwerk Türen und Öffnungen in der Wand erkennbar, die sich nicht klar deuten lassen. Nach einer Weile nimmt man wahr, dass es wohl auch einen Lift gibt oder zumindest entsprechend übereinander liegende Lifttüren. Das ganze obere Stockwerk kann herabfahren und die untere Etage verschliessen. Die Ecke im Parterre wiederum vermag sich zu öffnen, und ein pechschwarzer Gang in die Unendlichkeit tut sich dahinter auf. Der rätselhafte Lift erweist sich als nutzbar, Personen fahren mit ihm ins obere Stockwerk. Das Bühnenbild von Anna ist ein Labyrinth aus Wänden, verschliessbaren Öffnungen, Türen, Gängen – und jede Verwandlungsmöglichkeit wäre eine eigene Kolumne wert.
Ich möchte jedoch hier nur ein Geheimnis lüften, nämlich wie man einen Lift in ein Bühnenbild einbaut. Das erweist sich – wie meistens in meinen Kolumnen – als ganz einfach und kann jederzeit zu Hause nachgebaut werden: Schweissen Sie aus ein paar Stahlrohren das Skelett einer Kabine zusammen und verkleiden Sie dieses mit Holz. Sinnvoll ist es, eine Seite offen zu lassen, sonst kommen Sie nicht hinein oder heraus. Auf dem Dach der Kabine befestigen Sie eine Öse, die später das Gewicht von Kabine und Fahrgästen tragen können muss. Montieren Sie nun an der Decke in Ihrer Wohnung eine Winde und brechen Sie darunter den Fussboden in der Grösse der Kabine aus. Bitte etwas Luft lassen, denn es braucht noch Platz für die Führung der Kabine, damit diese nicht hin und her pendelt, wenn Sie einsteigen. Diese Führung bilden zwei in Ihrer Wohnung fest montierte Stahlrohre, an denen die Kabine mit Führungsrollen entlanggleitet. Wir haben die zwölf Führungsrollen mit Federn gelagert, damit die Rollen permanent an den Rohren anliegen und sich dennoch nicht verklemmen. Nun können Sie den Haken der Winde in die Öse einhängen und einsteigen. Sind Sie so gut organisiert wie wir, sollte die Winde nach dem Einsteigen langsam anziehen, die Kabine ins obere Stockwerk befördern und genau auf der Höhe des Fussbodens halten. Bei uns wird die Winde von den Schnürmeistern gesteuert. Das wird sicherlich auch in Ihrem Haushalt ähnlich zu lösen sein. Steht der Lift in der unteren Etage, ist bei uns das Loch im Fussboden in der oberen Etage eine Gefahr. Wir haben es mit einem begehbaren Deckel verschlossen, der grösser ist als das Loch und durch den das Seil der Winde hindurchgeht. Fährt der Lift nun von unten an den Deckel, nimmt das Dach der Kabine den Deckel einfach mit hoch, und beim Herunterfahren legt er sich wieder passgenau über das Loch. Passen Sie bitte dennoch auf: Die Kabine hat noch keine Lifttüren. Mir fehlt in dieser Kolumne einfach der Platz, auch noch deren Herstellung zu beschreiben. Wie gesagt, in diesem raffinierten Bühnenbild ist vieles eine eigene Kolumne wert.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich
Illustration: Anita Allemann

Brahms begleitet mich seit meiner Jugend
Im September wird Gianandrea Noseda Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich. Schon jetzt führt er mit der Philharmonia Zürich und dem Chor der Oper Zürich eines der populärsten Oratorien der Romantik auf – «Ein deutsches Requiem» von Johannes Brahms. In unserem Video gibt der Dirigent Auskunft über die Besonderheiten dieses Werks und seinen persönlichen Bezug zum deutschen Repertoire des 19. Jahrhunderts.
Interessant am Happy End ist vor allem das zweite Wort: End!
Christoph Marthaler inszeniert Christoph Willibald Glucks Oper «Orphée et Euridice» am Opernhaus Zürich und entdeckt viele Merkwürdigkeiten in der Geschichte von Orpheus, der ins Totenreich hinabsteigt, um seine geliebte Eurydike zurückzuholen. Lesen
Seit vier Wochen laufen die Proben für «Orphée et Euridice» von Christoph Willibald Gluck. Nach zwei Schauspielinszenierungen im Frühjahr und Herbst des vergangenen Jahres ist dies für dich nun die erste Opernarbeit unter Pandemie-Bedingungen. Was ist in der Oper anders?
Bei den Schauspielarbeiten in Hamburg und Zürich kannten sich alle Mitwirkenden seit vielen Jahren. Insofern fiel es uns leicht, mit Masken zu proben, da man die teilweise verdeckten Gesichter gut einordnen konnte. Auf der Probebühne des Opernhauses nun begegneten mir drei Sängerinnen, mit denen ich bisher noch nicht gearbeitet hatte. Und da die Momente, in denen keine Masken getragen wurden, immer nur sehr kurz waren, dauerte es also eine ganze Weile, bis wir uns gegenseitig wirklich erkannt haben. Solche Umstände färben natürlich auf die Arbeit ab. Aber wer weiss, vielleicht ist das für genau diese Oper auch interessant. Ich habe die Sängerinnen schon einige Male gefragt, ob sie auch ohne Maske so singen könnten wie mit Maske. Das ist jetzt gar nicht ironisch gemeint, denn die Gesichtsausdrücke unter den Masken sind ja unkenntlich und deshalb unerklärlich. Und Unerklärlichkeiten finde ich gut, besonders dann, wenn man sich in Unterwelten aufhält. Am Wichtigsten finde ich allerdings, dass man trotz der ganzen Umständlichkeit mit den Masken und Abstandsregeln viel Spass zusammen hat und Scherze machen kann. Man sollte möglichst viel lachen bei der Arbeit.
Bei deiner letzten Arbeit am Opernhaus Zürich, Rossinis «Il viaggio a Reims», hattest du es mit einer Riesenbesetzung zu tun – 18 Solistinnen und Solisten, einem grossen Chor sowie einigen zusätzlichen Darstellern. In Glucks «Orphée» treten nur drei Figuren auf: Orpheus, Eurydike und Amor. Hinzu kommen sieben Darstellerinnen und Darsteller, um die du das Personal erweitert hast. Der Chor kann wegen Corona nicht auf der Bühne stehen. Inwiefern beeinflusst das deine Inszenierung?
Natürlich ist es unter den derzeitigen Umständen angenehmer, nur mit drei Sängerinnen zu arbeiten. 18 Solistinnen und Solisten wie bei Viaggio wären im Moment wirklich unvorstellbar, was ja auch die Absage der für vergangenen Dezember geplanten Wiederaufnahme unserer Inszenierung zeigt. Nun ist es aber auch so, dass Distanz in meinen Arbeiten immer schon eine wichtige Rolle gespielt hat. In meiner Inszenierung von Tristan und Isolde in Bayreuth war es beispielsweise so, dass, je mehr die Leidenschaft wuchs und die Liebe auf Tristan und Isolde durchschlug, desto weiter sie sich voneinander entfernten. Sie bewegten sich in einem abstossend magnetischen Gravitationsfeld, und keiner von beiden konnte diesen Umstand beeinflussen. Auch jetzt bei Orphée et Euridice interessiert mich das Verhältnis von Gefühl und Distanz. Die Inszenierung spielt in einem Bühnenbild, das sehr viele Möglichkeiten bietet, sich zu isolieren. Mehrere Ebenen mit unzähligen Türen und Fenstern sowie ein fahrbarer Aufzug machen es möglich, dass viele Menschen im Raum anwesend sind und dennoch ganz weit voneinander entfernt erscheinen.
Die Entscheidung, am Zürcher Opernhaus mit der Fassung von Hector Berlioz zu arbeiten, fiel bereits vor langer Zeit. Was waren die Gründe für diese Wahl?
Es gibt ja vier mögliche Aufführungsversionen. Drei davon hat Gluck selbst konzipiert, zwei davon auf Italienisch, eine weitere auf Französisch. Hector Berlioz, der Gluck sehr bewunderte, erstellte dann aus diesen Versionen um 1859 eine vierte Fassung in französischer Sprache und nahm eine sehr wesentliche Veränderung vor: Die Hauptpartie des Orpheus wird in seiner Version von einer weiblichen Altstimme oder einem Mezzosopran gesungen. Auf diese Weise wird auch der Mythos umgeschrieben, da die tradierten Geschlechterzuteilungen aufgelöst werden. Es hatte mir und uns allen im Team gleich sehr gefallen, dass die drei Rollen der Oper von Sängerinnen interpretiert werden und dass es dabei nicht um Frauen in Männerkleidern geht, sondern um drei Frauen. Wir sagen auf den Proben oft «Orphea», das macht den auf diese Weise befreiten Zugang zu den Figuren und der mythologischen Erzählung spürbar. Es ist übrigens sehr wichtig, dass man die Fassung von Berlioz nicht «berliozisiert», also aus dem 19. Jahrhundert heraus denkt und interpretiert, sondern stets aus der Perspektive Glucks. So zumindest hat es Berlioz getan und es spricht einiges dafür, sich an ihn zu halten. Es gibt ja nicht wenige Leute, die sagen, Orphée et Euridice wäre Berlioz‘ beste Oper…
Spielte bei der Auswahl der Fassung auch eine Rolle, dass die antike Erzählung in Berlioz‘ Version auf Französisch verhandelt wird? Hast du eine Sprachpräferenz im Bereich gesungener Musik?
Schwer zu sagen, aber vielleicht gibt es bei mir tatsächlich eine leichte Präferenz für das Französische. Ich habe selbst längere Zeit in Paris gelebt, und zur Oper bin ich durch die Zusammenarbeit mit einem Franzosen gekommen, dem Dirigenten Sylvain Cambreling. Ohne ihn wäre ich vielleicht nie in einem Opernhaus aufgetaucht. Es waren und sind immer sehr intensive Zusammenarbeiten. Unsre erste gemeinsame Inszenierung war Pelléas et Mélisande von Claude Debussy an der Frankfurter Oper. Ein französischsprachiges Werk…
Wie würdest du Glucks Oper in der Fassung von Berlioz beschreiben? Sie ist ja in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich und orientiert sich nicht unbedingt an den klassischen Schemata der Operndramaturgie.
Das Paradox ist, dass in dieser Oper ständig davon gesungen wird, wie sehr Orphée alle Menschen und Götter um sich herum durch Gesang und Harfenspiel betört und beeinflusst. Gluck hingegen erzeugt in seinem Werk immer wieder musikalische Zustände, in denen die Orphée-Figur vollkommen passiv erscheint. Besonders am Anfang der Oper ist das auffällig. Gluck lässt einem hier sehr viel Zeit, um sich mit der Anfangssituation vertraut zu machen. So viel Zeit, dass einem die Trauer und das Wehklagen irgendwann schon wieder unglaubwürdig vorkommen. Das hat uns interessiert. Es ist ja so: Die mythologische Geschichte von Orpheus und Eurydike ist als reine Geschichte sehr einfach und vielen Menschen bekannt: Eurydike stirbt, Orpheus darf zu ihr in die Unterwelt, muss dabei allerdings einer Prüfung standhalten, was ihm nicht gelingt, weshalb er Eurydike ein zweites Mal ihrem Schicksal überantwortet. Das scheint alles eine klare Sache zu sein, und der entscheidende Moment, in welchem Orpheus sich umdreht und damit die Tragödie der endgültigen Trennung erzeugt, ist mehr als berühmt. Betrachtet man die Geschichte jedoch etwas genauer, dann entdeckt man plötzlich viele Uneindeutigkeiten. Die zentrale Merkwürdigkeit besteht darin, dass irgendwelche Götter – in diesem Fall Amor – sich angeblich so sehr beeindrucken lassen von Orpheus‘ Trauergesang, dass sie ihm und Euridice eine zweite Chance ermöglichen. Schon hier geht es um Manipulation: Manipuliert Orpheus die Götter oder ist es umgekehrt? Spielen die Götter ein sadistisches Spiel mit Orpheus? Und ziehen die Götter hierbei alle an einem Strang? Wer sind die Furien, wer die berühmten «seligen Geister»? Mich interessieren in meinem Theater Menschen und nicht Götter. Deshalb stelle ich mir die Frage: Euridice wurde durch einen Schlangenbiss getötet? Das erscheint doch ungewöhnlich spektakulär und erinnert nicht wenig an historische und gegenwärtige Vergiftungsattentate auf solche Persönlichkeiten, die für andere zum Hindernis geworden sind. Ich suche zwar nicht nach konkreten Verbindungslinien in unsere Gegenwart, aber mich interessieren in diesem Zusammenhang gefährliche Verstrickungen sowie kriminell-korrupte Gesellschaftssysteme, innerhalb derer keiner mehr einem anderen vertrauen kann. Um dies zeigen zu können, gibt es ein Ensemble von sieben Darstellerinnen und Darstellern, die in Vertretung des abwesenden Chores immer wieder rätselhafte Löcher reissen in die scheinbar hermetische mythologische Erzählung und den Ort des Geschehens als Labyrinth erscheinen lassen. Wenn man sich mit dieser Oper von Gluck beschäftigt, muss man aus meiner Sicht viele Dinge offenlassen. Am liebsten wäre mir, wenn das Publikum am Ende des Abends überhaupt nicht mehr wüsste, wo und unter welchen Umständen genau sich die Geschichte abgespielt hat. Ein Mythos wird für mich erst dann interessant, wenn er Irritationen auslöst und nicht einfach das Ewiggleiche bestätigt.
Ist die Oper nicht grundsätzlich eine ganz und gar auf Bestätigung kultureller und gesellschaftlicher Verhältnisse ausgerichtete Gattung und dadurch relativ weit entfernt von Irritationen und Labyrinthen?
Das lässt sich so einfach nicht beantworten. Natürlich gibt es keinen Theaterort, an dem es so sehr um das Wiedererkennen geht wie in der Oper. Musik löst derart heftige Emotionen des Erkennens aus, wie es sonst vielleicht nur noch Gerüche vermögen. Entsprechend unerwünscht sind also Eingriffe in musikalische Verläufe oder Reihenfolgen der einzelnen Teile eines Opernwerks. Und obwohl wir manchmal aus bestimmten Gründen auch genau so etwas vorschlagen, liegt in der Unantastbarkeit einer Partitur auch ein starker Reiz: Die Musik handelt völlig eigenständig und ist dadurch ausschlaggebend für alles, was sich zu ihr ins Verhältnis setzt. Glucks Orphée ist beispielweise wirklich pure Musik. Und weil das so ist und diese Musik unbeirrt erzählt und fortschreitet, kann ich als Regisseur ganz andere Fragen an das Werk stellen und sehr ungewöhnliche Aspekte thematisieren. Die Musik gibt einem diese Möglichkeiten. Dadurch bleibt die Gattung dann doch deutlich in Bewegung und kann durchaus stark irritieren.
Was hat es mit dem eigentümlichen Happy End auf sich, das in Glucks Oper dem Mythos von Orpheus und Eurydike nochmal eine ganz andere Wendung verleiht?
Seit meiner Kindheit wünsche ich allen Menschen um mich herum immer ein Happy End. Aber im Theater weiss ich nicht, was ich mit Happy Ends anfangen soll. Ich glaube auch nicht wirklich daran. «Und sie lebten glücklich bis zu ihrem Ende»… Ist das ein Happy End? Ich bin mir nicht so sicher. Da kann ich mit der nüchternen Feststellung «und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute» schon deutlich mehr anfangen. Interessant am Happy End ist vor allem das zweite Wort: End. Was kommt danach? Es kommt ja immer noch etwas. Insofern gibt es auch in unserer Arbeit kein Happy End. Weil es kein End gibt. Es endet nicht. Jedes Happy End ist dazu verdammt, dass es kein Ende hat. Unsere Inszenierung ist also auch ein Wiederauferstehungstraining. Wann und warum darf man wieder auf(er)stehen, nachdem sich jemand umgeblickt hat, der sich nicht umblicken durfte? Und glückt so etwas verlässlich? Das ist eigentlich ein sehr optimistischer Ansatz.
Spekulieren Figuren aus antiken Erzählungen nicht immer ein bisschen darauf, dass sich etwas Ungewöhnliches ereignen könnte?
Genau, das sehe ich auch so. Die antike Welt ist ja eine Welt, die in dauernder Verwandlung begriffen ist. Zumindest Ovid hat das so festgehalten und an uns weitergereicht. Insofern gibt es nicht nur die Möglichkeit von Verwandlung, sondern eine Zwangsläufigkeit. Orphée hat also allen Grund, auf eine ungewöhnliche Wendung der Ereignisse zu setzen. Um was genau es sich dabei handeln könnte, bleibt allerdings immer eine Überraschung. Manchmal auch eine böse.
Das Gespräch führten Kathrin Brunner und Malte Ubenauf
Foto: Monika Rittershaus
Anna
Viebrock
entwirft nicht nur grandiose Räume für das Theater von Christoph Marthaler. Sie ist eine der kreativsten Bühnen-Künstlerinnen überhaupt. In einer neuen Folge unseres Podcasts «Zwischenspiel» kann man sie kennenlernen – als Mensch und als Bühnenbildnerin unserer Gluck-Premiere.
Podcast anhören
In der Liebe ist Vertrauen besser als Kontrolle
Der bekannte Psychoanalytiker und Autor Wolfgang Schmidbauer legt in unserer aktuellen MAG-Kolumne den Sängerhelden Orpheus auf die Couch und meint: Wir tun in Paarbeziehungen gut daran, das Wunderbare zuzulassen ohne zurückzuschauen. Lesen
Wir leiden und zittern mit dem Helden: Untröstlich über den Verlust Eurydikes, ermutigt durch Zeus, will Orpheus in die Unterwelt eindringen und die Schar der Furien beschwichtigen, die bisher kein Sterblicher besänftigt hat. Und es gelingt ihm, die grenzenlose Wut der wachsamen Ungeheuer zu zähmen; sie lassen ihn durch. Im Elysium findet er Eurydike und macht sich mit ihr auf den Weg zurück in die gemeinsame Liebe und das gemeinsame Leben.
Nun gibt es ganz eigene und schwer zu erfüllende Regeln, wenn ein Gott sich in das menschliche Leben einmischt. Eine der wichtigsten scheint die zu sein, dass die Irdischen das göttliche Wirken hinzunehmen haben, ohne genau hinzusehen. Das ist schon in der Bibel so: Lots Weib erstarrt zu einer Salzsäule, weil sie sich nicht beherrschen konnte, das göttliche Strafgericht über die unzüchtigen Bewohner von Sodom und Gomorrha ins Auge zu fassen. Und hat nicht bereits die Warnung des Schöpfers, ausgerechnet von diesem einen Baum keine Frucht zu kosten, eine ähnliche Qualität: Beherrscht euch, ihr Menschen, ich weiss besser, was gut für euch ist und was nicht!
In Glucks Oper, deren Text der 1714 in Livorno geborene Ranieri Simone Francesco Maria de’ Calzabigi verfasst hat, wird dem antiken Mythos ein quasi paardynamisches Detail abgewonnen. In der klassischen Fassung von Ovid ist Orpheus’ Kunst so gross, dass selbst der Höllenhund Kerberos Ruhe gibt; Hades und Persephone machen es aber zur Bedingung, dass er beim Aufstieg in die Oberwelt vorangehen und sich nicht nach Eurydike umschauen dürfe. Als Orpheus die Schritte seiner Ehefrau hinter sich nicht hört, sieht er sich um und verliert sie ein zweites Mal.
Calzabigi hingegen macht Eurydike zur Täterin. Sie beklagt sich bitterlich, dass Orpheus sie nicht ansieht, liebt er sie etwa nicht mehr? Vielleicht kommt sie dann lieber nicht mit! Eurydike ist es, eine zweite Eva, die Orpheus zum tödlichen Fehler verführt. Und wieder einmal glaubt der Mann seiner Frau mehr als dem Vater der Götter. Wenn es nicht den Gott Amor gäbe, der solche Fehler gerade biegt, wäre die Sache schlecht ausgegangen!
Das happy end der Gluckschen Oper sollten wir in Zeiten nicht gering schätzen, in denen es alle Bühnen schwer haben. Orpheus betörte in der antiken Sage Götter, Menschen und sogar Tiere, Pflanzen und Steine. Die Bäume neigten sich, die wilden Tiere scharten sich um ihn, wenn er sang, selbst die Felsen weinten. Und heute sollen seine Erben verstummen, weil Singen Viren aus den Atemwegen in den Raum streuen könnte?
Wer liebt, sollte nicht herzlos darauf beharren, dass Liebesbeweise unterbleiben, weil es verboten ist, wie das Tamino in der Zauberflöte gegenüber Pamina praktiziert. Die paartherapeutische Praxis schlägt sich auf die Seite Amors, der Orpheus im dritten Akt den Dolch aus der Hand nimmt, mit dem sich der verzweifelte Sänger erstechen will, weil ihm Eurydike ein zweites Mal gestorben ist. Dann macht er auch Eurydike wieder lebendig, ganz ohne die Umstände mit Furien und Höllenhunden, die der Sänger bewältigen musste. Ein Gott hat da doch ganz andere Möglichkeiten.
Wenn Richard Wagner im Lohengrin der weiblichen Neugier mit eben der Härte die Zerstörung der Liebe zuschreibt, die Calzabigi und Gluck dem tragischen Mythos nehmen, mag das daran liegen, dass die Dichter im bürgerlichen 19. Jahrhundert weniger galant waren als ihre Vorgänger in der Adelsgesellschaft des Spätbarock. Glucks Librettist aus dem toskanischen Geschlecht der Calzabigi war ein guter Freund von Giacomo Casanova, dessen frivole Autobiografie unvergessen ist. Er lernte den aufmüpfigen Venezianer in Paris kennen und traf Gluck zehn Jahre später in Wien.
Der verbotene Blick, die verbotene Frage symbolisieren das Dilemma von Vertrauen und Kontrolle. Je unübersichtlicher die Welt ist, desto schwerer wird es, zu vertrauen. In der Tat hat sich mit dem technischen Fortschritt der Bereich radikal verkleinert, in dem Vertrauen ausreicht und wir auf Kontrolle verzichten können. Dass meine Kutschpferde in ihren Stall finden, wenn ich betrunken bin, Vertrauenssache. Aber darauf zu vertrauen, dass ein Flugzeug schon fliegen, ein Atomkraftwerk schon funktionieren wird, ist bodenloser Leichtsinn. Vor jedem Start, gar Tag und Nacht muss kontrolliert werden, ob alles funktioniert wie es soll.
So mag es uns fremder geworden sein, dass in Liebe und Freundschaft Vertrauen trägt und Kontrolle Unsicherheit eher fördert als besiegt. Der orphische Rat, nicht zurück zu blicken, nicht zu kontrollieren, ist heute so weise wie im mythischen Thessalien. Ebenso wichtig ist es, zu akzeptieren, dass wir nicht immer bereit sein werden, zu vertrauen, wo wir doch auch nachprüfen können.
Sigmund Freud hatte viel Verständnis und Interesse für Kunst; seine Sammlung antiker Kleinplastiken hat seine Zeitgenossen ebenso beeindruckt wie seine Ausflüge in die Kulturgeschichte, in Interpretationen der Moses-Statue von Michelangelo oder der Geheimnisse von Leonardo da Vincis Mona Lisa. Nur in einem Punkt, bekennt er, sei er fast genussunfähig: in der Musik, denn er könne es nicht leiden, emotional bewegt zu werden, ohne zu wissen, warum und wodurch.*
Der Rat der Götter ist bei Orpheus in den besten Händen. Wir sollten das Wunderbare geschehen lassen, ohne zurück zu blicken, ob es denn auch wirklich geschieht. Musik entzieht sich dem rationalen Zugriff. Sie packt den Hörer und ist verklungen, ehe er seine analytischen Werkzeuge parat hat.
* «Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt sich in mir dagegen, dass ich ergriffen sein und dabei nicht wissen solle, warum ich es bin und was mich ergreift.» (Freud, Der Moses des Michelangelo 1914, Studienausgabe S. 172)
Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor
Illustration: Anita Allemann
Man muss Gluck einfach spielen, wie ein Volkslied!
Stefano Montanari ist der Dirigent unserer Premiere «Orphée et Euridice». Der Italiener, der zum ersten Mal am Opernhaus Zürich zu Gast ist, hat als ehemaliger Barockgeiger seine musikalischen Wurzeln in der historisch informierten Aufführungspraxis. Aber dem Klischeebild eines Dirigenten für Alte Musik entspricht er nicht. Fabio Dietsche hat ihn auf den Proben beobachtet und sich mit ihm über Gluck, Berlioz, Schostakowitsch und die Welt unterhalten. Lesen
Die Philharmonia Zürich hat zu einer Probe von Christoph Willibald Glucks Oper Orphée et Euridice zusammengefunden und nimmt im Probenraum so viel Platz ein wie ein vollbesetztes Orchester der Spätromantik. Doch das liegt nicht daran, dass hier die Version aus dem Jahr 1859 geprobt wird, die Hector Berlioz für eine Aufführung am Pariser Théâtre Lyrique eingerichtet hat, sondern an den Pandemie-bedingten Abstandsregeln. Die Musik klingt nicht nach Berlioz, sondern nach Gluck.
Der Dirigent Stefano Montanari probt gerade die Arie «J’ai perdu mon Euridice». «Das ist vielleicht die bekannteste Arie von Gluck, aber nicht seine beste», sagt er zum Orchester. «Spielt sie ganz einfach, wie ein Volkslied!»
Für seine schlichte, natürliche Klangsprache wurde Gluck schon zu Lebzeiten bewundert. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts reformierte er die Oper und entsprach mit seinem neuen Stil den Idealen der französischen Enzyklopädisten wie Rousseau, d’Alembert und Diderot, die Natürlichkeit, Einfachheit und Wahrhaftigkeit des musikalischen Ausdrucks forderten. Diese Ideale in der Praxis umzusetzen, sei aber gar nicht so leicht, sagt Montanari im Gespräch nach der Probe. «Man muss Glucks Musik in ihrer Schlichtheit ernst nehmen, sonst läuft sie Gefahr, banal zu klingen. Wenn aber nicht nur die Sängerinnen, sondern auch die Instrumentalisten zu ‹singen› versuchen, kann diese Musik eine ganz direkte und emotionale Wirkung entfalten.»
Einer, der Glucks Musik tief empfunden hat, war der französische Komponist Hector Berlioz. In seinen Mémoires erfährt man, dass Glucks Partituren für seine Karriere wegweisend waren: «Sie brachten mich um den Schlaf und liessen mich Essen und Trinken vergessen; sie versetzten mich in einen Rauschzustand», schreibt er dort. Nachdem er Glucks Iphigénie en Tauride gehört hatte, stand für Berlioz fest, dass er Musiker werden würde.
Ich frage Stefano Montanari, ob es solch ein wegweisendes Erlebnis in seiner Biografie ebenfalls gegeben habe? Der 1969 unweit von Ravenna geborene Musiker erzählt, wie er sich als Kind von seinem Onkel sehnlichst eine Trompete wünschte. Noch heute liebe er dieses Instrument und höre immer wieder die Platten von Wynton Marsalis, einem der grossen Jazztrompeter unserer Zeit. Der Onkel brachte jedoch eine Geige – und für den kleinen Stefano war das offensichtlich keine Enttäuschung, sondern ein zukunftsweisender Moment: Er wurde ein leidenschaftlicher Barockgeiger und später Konzertmeister der Accademia Bizantina di Ravenna. Gemeinsam mit Ottavio Dantone, der seit einigen Jahren ebenfalls am Opernhaus Zürich dirigiert, spielte Montanari in diesem renommierten Barockensemble, bevor er sich mehr und mehr dem Dirigieren zuwandte.
«Es ist schon seltsam, dass ich jetzt seit 30 Jahren Alte Musik mache», meint er, denn: «Mit Mozart und Vivaldi konnte ich in meiner Jugend überhaupt nichts anfangen. Auf meinem Walkman hörte ich allabendlich Kassetten mit Mahlers Fünfter, Schostakowitschs «Leningrader»-Sinfonie und Strauss’ Elektra.» Jede Menge schmetternder Trompeten also, und Montanari, der auch eine Metodo di violino barocco, eine Barockgeigen-Schule veröffentlicht hat, sagt: «Schostakowitsch ist mein Lieblingskomponist, und ich hätte grosse Lust, seine Werke zu dirigieren.»
Die Geige hatte er in den letzten Jahren nicht mehr oft in der Hand. «Ich bin glücklich ohne sie – und ich glaube, sie ist es auch ohne mich», lacht er. Dafür dirigierte er unterdessen an den renommierten Opernhäusern von Rom, Venedig, London, Lyon und Stuttgart. Für die Opern von Schostakowitsch und Strauss wurde er noch nicht engagiert, aber auch mit Komponisten wie Händel, Mozart und Rossini steht für Montanari fest: «Oper ist die beste Show der Welt! Ich bin immer wieder fasziniert, wie viele verschiedene Menschen an dieser Kunstform beteiligt sind, und liebe es, mit allen zusammenzuarbeiten!»
Das interessiert mich, denn vor gut zwei Jahren habe ich in Lyon eine durchaus eigenwillige Don Giovanni-Aufführung unter der musikalischen Leitung von Stefano Montanari erlebt. Der Regisseur war David Marton, der bekanntlich gerne unkonventionell mit Stoffen und Formen umgeht. Schätzt Montanari auch die Zusammenarbeit mit Regisseuren, die sich gewisse Freiheiten im Umgang mit Partituren herausnehmen? Don Giovanni sei in dieser Hinsicht sicher ein heikles Werk, sagt er. Ob es nun die perfekte Oper schlechthin sei, wie zuweilen behauptet wurde, könne er zwar nicht sagen, und das sei letztlich auch egal. Für eigene Interpretationsansätze und verschiedene Deutungsebenen der Regie habe er durchaus Verständnis, nur: «Wenn man eine bestehende Erzählung dekonstruiert, dann muss man dafür auch eine neue Geschichte erfinden!» Und das habe, seiner Meinung nach, bei Martons Don Giovanni-Fassung, in der die Musik teils durch Texte und Geräusche durchbrochen wird, nur zur Hälfte funktioniert.
Mit Christoph Marthaler arbeitet Montanari bei Orphée et Euridice nun wiederum mit einem Theatermacher zusammen, der für seinen ganz eigenen Umgang mit musikalischen Traditionen bekannt ist. Wie läuft diese erstmalige Zusammenarbeit? «Marthaler weiss sehr viel über Glucks Musik», sagt Montanari, und er habe ein Gespür dafür, wo Platz sei für seine «crazy Ideen» und wo nicht. Einige Tage vor diesem Gespräch probten Marthaler und Montanari beispielsweise eine Szene, in der ein Rezitativ plötzlich unterbrochen wird, während auf der Bühne Eurydike mit einer Musikbox auftritt, aus der ihr Gesang für einige Takte als Einspielung erklingt. «In der offenen Form eines Rezitativs sind solche Interventionen für mich überhaupt kein Problem», sagt Montanari, und in einem Stück, das sich um den Mythos des Gesangs schlechthin dreht, wohl auch nicht.
Stefano Montanari dirigiert Orphée et Euridice in Zürich zum ersten Mal, aber es ist nicht seine erste Gluck-Oper: In Lyon hat er bereits Alceste, in Stuttgart Iphigénie en Tauride dirigiert. «Ich bin zwar Italiener», sagt er, «aber ich habe Glucks Opern von Anfang an geliebt!» Montanari hat jeweils die französische Fassung der Opern dirigiert. Doch Gluck hat mit seinem Schaffen die musikalischen Landesgrenzen ohnehin gesprengt: In Deutschland geboren, bildete sich der Komponist in Italien und schrieb 1762 noch die erste Fassung von Orfeo ed Euridice für das Wiener Burgtheater auf einen italienischen Text von Ranieri de’ Calzabigi. 1774 überarbeitete er das Werk grundlegend und passte es als Tragédie-Opéra den Erwartungen des Pariser Publikums an. Der Musikkritiker Romain Rolland nennt Glucks Kunst eine «europäische», und Montanari sagt, «das 18. Jahrhundert ist ein riesiges Opern-Laboratorium gewesen, in dem sich italienische und französische Komponisten gegenseitig beweisen wollten. Eine entscheidende Leistung von Glucks Opernreform war es sicher, diese nationalistischen Tendenzen zu vereinen, statt sie gegeneinander auszuspielen.»
Nun interessiert mich aber noch, was Hector Berlioz, dessen Name grösser über dem Bärenreiter-Klavierauszug steht als derjenige von Gluck, 1859 wirklich zu dessen Oper beigetragen hat? «Aus dem Orchester wurde ich auch gefragt, ob diese Musik im Stil Glucks oder Berlioz’ zu spielen sei», erzählt Montanari. «Aber es gibt nur eine Möglichkeit: Es ist eine Oper des 18. Jahrhunderts, und so müssen wir sie auch spielen.» Überhaupt stehe auch in Berlioz’ Fassung mindestens 90 Prozent der Musik genauso, wie Gluck sie geschrieben habe. Berlioz habe Glucks französische Fassung allerdings mit dessen Wiener Fassung vermischt, die er teilweise für gelungener hielt und im Nachhinein auf Französisch übersetzen liess.
Eigentlich gibt es für Berlioz’ Einrichtung vor allem einen Grund, und der wird auch in der Kritik ersichtlich, die er über die Aufführung seiner eigenen Version schrieb: Während Berlioz die anderen Sängerinnen mit je ein oder zwei Sätzen bedenkt, schreibt er über Pauline Viardot-García, die Sängerin des Orphée, eine seitenlange Eloge: «Eine ganze Abhandlung» wäre nötig, meint er, um das «vollkommene Talent» und die «aussergewöhnlich umfangreiche Stimme» dieser Sängerin zu beschreiben. Für diese hervorragende Sängerin des 19. Jahrhunderts erstellte Berlioz also seine Fassung, und das erklärt auch, warum die Oper bei ihm nur noch Orphée heisst. Für die Viardot verwandelte er die Partie des Orphée, die in Glucks Version von 1774 einem hohen Tenor zugedacht ist, in eine Mezzosopran-Rolle und rückte sie damit wieder in die Nähe der ursprünglichen Wiener-Fassung, in der Orfeo von einem Altkastraten gesungen wurde.
Stefano Montanari findet es interessant, dass ausgerechnet die Partie des Orpheus, der durch seinen ergreifenden Gesang sogar die Hüter der Unterwelt überlistet, mit so unterschiedlichen Stimmlagen bedacht wurde: «Monteverdi schrieb die Partie seines Orfeo für einen Mann mit mittlerer Stimmlage, Gluck zunächst für einen Kastraten und dann für einen Tenor, was zu dieser Zeit für eine Hauptrolle noch ganz unüblich war.» Glucks Orphée-Partie sei jedenfalls sehr anspruchsvoll: «Die schönsten und zartesten Momente liegen sehr hoch, aber die Tessitura der Sängerin muss auch eine gute Tiefe aufweisen». Es sei also nicht verwunderlich, dass Berlioz diese Partie für eine der besten Sängerinnen seiner Zeit eingerichtet habe.
Zum Schluss unseres Gesprächs weise ich den Dirigenten auf eine Kritik in der Süddeutschen Zeitung über sein Iphigénie-Dirigat in Stuttgart hin: «Montanari leitet das Orchester extrem elastisch, dynamisch äusserst differenziert, er trägt Latexhose und Stiefel, ein grandioser Spinner und Könner», steht dort. Montanari lacht und sagt, das sei doch eine perfekte Kritik! Er sei eben kein Traditionalist wie viele seiner Landsleute.

Verrat am eigenen Ideal?
Die geniale Stelle – Vier Takte aus Christoph Willibald Glucks Oper «Orphée et Euridice». Lesen
Wer sich mit den Opern Christoph Willibald Glucks befasst, stösst unweigerlich auf den Begriff «Opernreform». Liest man ein wenig nach, was das sein soll, erfährt man, dass Gluck vor allem danach strebte, die Oper vom übertriebenen und inhaltsleer gewordenen Virtuosentum zu reinigen und ein musikalisches Drama zu schaffen, das dem klassizistischen Griechenland-Bild unter der Losung «Edle Einfalt, stille Grösse» entspricht.
Wer mit diesem Wissen die französische Fassung von Glucks erster «Reformoper» betrachtet, erlebt eine Überraschung. Die ursprüngliche – italienische – Version scheint doch dieses Ideal vollendet zu verwirklichen: Eine geradlinig gebaute Handlung vollzieht sich in knappen, auf das Wesentliche konzentrierten Dialogen, deren bewusst einfache musikalische Gestalt auf jede Ornamentierung der edlen Linien verzichtet. Koloraturen, so scheint es, sind in der neuen Oper, die Gluck schaffen wollte, verboten. Und nun enthält die neue Partitur veritable Koloraturarien! Und selbst Passagen, die aus der ersten Fassung übernommen wurden, sind mit Ornamenten versehen, die Fremdkörper zu sein scheinen. Wie konnte es zu diesem Rückfall in die Konvention kommen? Hat Gluck damit nicht sein grosses Projekt verraten?
Betrachtet man etwa die Szene, in der Orpheus die Furien durch seinen Gesang dazu bewegt, ihm den Weg in die Unterwelt freizugeben, kann man glauben, Gluck habe sie durch Koloraturen, die er der Partie des Orpheus hinzugefügt hat, verdorben. Die ursprüngliche italienische Version dieser Szene gewinnt ihre Kraft aus der Konfrontation der schlichten Melodien des Menschen mit dem donnernden »Nein!« der inhumanen Macht. Die Ausschmückungen der neuen Version scheinen diesen Effekt abzuschwächen. Hat Gluck seine geniale Eingebung der «geläufigen Gurgel» irgendeines Sängers geopfert?
Ein genauerer, vorurteilsfreier Blick in die Partitur zeigt: Es ist nicht mangelnde Konsequenz, die Gluck zu diesen Änderungen bewog. Sehr deutlich wird das bei der Betrachtung der zwei viertaktigen Koloraturen, die der ersten Strophe hinzugefügt wurden, die Orpheus im Angesicht der Höllengeister singt. Diese Stelle wirkt überraschend nicht nur, weil plötzlich eine raschere Bewegung in die melodische Linie kommt, sondern diese auch deutlich den bisherigen Tonumfang überschreitet. Was hier geschieht, teilt sich dem mitfühlenden Hörer ohne weiteres mit: Es ist ein plötzlicher, unwillkürlicher Aufschrei der gequälten Seele, in dem sich die bisher zurückgehaltene Verzweiflung des Menschen Bahn bricht. Darin zeigt sich, dass Gluck die Passage grundlegend verändert hat. War in der italienischen Version der schlichte Gesang des Orpheus Ausdruck seiner tiefen Trauer, die schliesslich das Mitleid der Höllengeister weckt, sind sie nun Ausdruck des Versuchs, die Verzweiflung zu verbergen, bis sie doch hervortritt.
Der Vergleich der beiden Versionen zeigt also: Es handelt sich um zwei grundverschiedene Darstellungen derselben Situation. Indem beide auf ihre jeweils eigene Weise das Schicksal des Helden so darstellen, dass der Zuschauer unmittelbar davon ergriffen wird, erfüllen beide das Ideal, nach dem Gluck gestrebt hat. Denn es ging ihm bei seiner Reform nicht um die Formulierung irgendwelcher ästhetischer Dogmen, sondern um die Suche nach neuen Wegen der Menschendarstellung, um die Herzen der Zuschauer unmittelbar zu erreichen. Dass er sie fand, zeigt diese Stelle in ganz besonders beeindruckender Weise.
Werner Hintze
Nadezhda Karyazina
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Schon immer habe ich davon geträumt, einmal das Matterhorn zu sehen – Berge sind meine Leidenschaft! Vor Beginn der Proben zu Orphée et Euridice besuchte ich dann tatsächlich das wunderbare Zermatt. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass dies einer der schönsten Orte ist, die ich je gesehen habe.
Worauf freuen Sie sich in der Neuproduktion von «Orphée et Euridice»?
Ich bin unglaublich glücklich, im Team des unnachahmlichen Christoph Marthaler zu sein und mit dem brillanten Dirigenten Stefano Montanari zu arbeiten. Unsere Truppe aus Sängerinnen, Schauspielern und Schauspielerinnen, Musikern und Bühnenarbeitern ist sehr freundlich, alle sind wir eng miteinander verbunden. Es ist eine wahre Freude zu proben. Und natürlich ist die Rolle des Orphée meine Traumrolle. Das ist atemberaubende, virtuose und wunderschöne Musik!
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Ein sehr wichtiger Moment war für mich, als ich Mitglied des Programms Junger Künstler am Moskauer Bolschoi-Theater wurde. Damals begann ich, wirklich an mich selbst zu glauben.
Welches Buch würden Sie niemals weggeben?
Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, den ich als Kind bekommen habe.
Eine wunderbare philosophische Geschichte, die mich viel gelehrt hat.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Vladimir Horowitz mit dem dritten Klavierkonzert von Rachmaninow.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Ich habe einen riesigen blauen russischen Samowar zu Hause, den wir nie benutzt haben, den uns aber meine Familie zur Hochzeit geschenkt hat und der mich an meine Heimat erinnert.
Mit welchem Künstler oder Künstlerin würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Ich würde sehr gerne die unvergleichliche Pauline Viardot kennenlernen, eine der faszinierendsten Theater- und Musikerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die so viele Genies inspiriert hat! Mit ihr würde ich auch gerne über die Rolle des Orphée reden. Sie war massgeblich daran beteiligt, dass Hector Berlioz die Partie von Glucks Orphée für eine Frauenstimme umschrieb.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Nichts ist unmöglich in unserem Leben!
Es gibt Liebe auf der Welt!
Musik macht das Leben wunderschön!
Die russische Mezzosopranistin Nadezhda Karyazina war u.a. Ensemblemitglied an der Hamburgischen Staatsoper. Als Orphée in Glucks «Orphée et Euridice» gibt sie nun ihr Debüt am Opernhaus Zürich.
Christian Spuck
Es ist gerade viel los im Künstlerleben von Christian Spuck. In Zürich bereitet er eine Wiederaufnahme seines Erfolgsstücks «Winterreise» vor, das am 13.2. live auf Arte Concert zu sehen ist. Ausserdem choreografiert er parallel ein neues Ballett am Moskauer Bolschoi-Theater. Corona hatte er auch noch. Über all das und einiges mehr spricht er in unserem Podcast «Zwischenspiel».
Zum Podcast
Ist, was wir sehen,
schon die ganze Wahrheit?
schon die ganze Wahrheit?
Bryan Arias hat ein besonders poetisches und geheimnisvolles Stück für den dreiteiligen Ballettabend «Impulse» des Junior Balletts choreografiert. Es heisst «Pure Coincidence». In unserem Interview spricht der in Basel lebende Amerikaner über offene Suchprozesse und Zufälle, die ihn in seiner Arbeit inspirieren. Lesen
Bryan, das neue Programm des Junior Balletts trägt den Titel «Impulse». Welche Impulse willst du diesem Dreierabend geben?
Schon vor Beginn meiner Arbeit mit dem Junior Ballett habe ich darüber nachgedacht, was ich den jungen Tänzerinnen und Tänzern als Choreograf mit auf den Weg geben möchte. In der sich immer schneller verändernden Welt des Balletts scheinen mir Selbst-bewusstsein und Selbstwertgefühl besonders wichtig zu sein. Deshalb nehme ich mir immer viel Zeit für Gespräche. Unter den sehr speziellen Probenbedingungen während der Corona-Pandemie hatten wir dafür sogar besonders viel Zeit. Zuzuhören ist eine wichtige Voraussetzung meiner Arbeit. Die Informationen aus diesen Gesprächen fliessen in meine Stücke ein. Ich habe am Beginn eines Kreationsprozesses keine feste Vorstellung, wie eine Choreografie am Ende aussehen soll. Ich versuche, so viel wie möglich offen zu lassen, damit sowohl Tänzer als auch das Publikum ihre eigenen Antworten finden können. Im Prozess des Fragens und Zuhörens entsteht nach und nach ganz organisch ein Erkundungsraum. In dieser sehr freien und kreativen Atmosphäre erfahre ich viel über die Tänzer und Tänzerinnen, ihre Art zu denken, wie sie miteinander umgehen, lerne ihren Ernst kennen, höre ihr Lachen. Das ebnet mir den Weg zu einer besonderen Qualität, nach der ich in meinen Stücken suche – menschlich, verletzlich, expressiv.
2020 hast du grosse Aufmerksamkeit in der Theaterwelt bekommen: Du bist mit dem renommierten deutschen Theaterpreis «Der Faust» für die beste Choreografie ausgezeichnet worden. «29 May 1913» ist 2019 beim Hessischen Staatsballett in Wiesbaden herausgekommen. Was war das für ein Stück?
Es war Teil eines Ballettabends, der Strawinskys «Le Sacre du printemps» gewidmet war. Die Pariser Uraufführung 1913 war bekanntlich einer der grössten Theaterskandale des 20. Jahrhunderts. Mich hat vor allem die Rolle des Publikums interessiert. Was haben die Leute im Théâtre des Champs-Élysées damals erwartet, und welche Rolle spielen wir als Publikum heute, wenn wir ins Theater gehen? Sind wir so unabhängig und abgetrennt vom Bühnengeschehen, wie wir glauben, oder sind wir nicht selbst ein wesentlicher Teil der Aufführung? In meinem Stück hat sich das Publikum auf einem Screen im Bühnenbild die ganze Zeit selbst gesehen und ist so zum Bestandteil meiner Choreografie geworden.
Du stammst aus Puerto Rico, bist in New York aufgewachsen, hast in Crystal Pites Company «Kidd Pivot» und im Nederlands Dans Theater getanzt. Heute lebst du in Basel. Wie hat sich all das auf deine choreografische Sprache ausgewirkt?
Wenn ich daran denke, wo etwa meine Eltern herkommen, bin ich oft selbst davon überrascht, an welchem Punkt ich heute stehe. Wie die Dinge geschehen, hat für mich auch immer den Hauch von etwas Mysteriösem. Ich hätte nie vorhersagen können, wie mein Weg als Künstler verläuft. Wenn ich zurückblicke, bin ich im Grunde immer meinem Bauchgefühl, meinem Instinkt, gefolgt. Das hat mich an all die unglaublichen Orte geführt und mich mit all den tollen Choreografen und Tänzerkollegen zusammengebracht, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe. Sie alle sind bis heute in meiner Arbeit präsent. Wenn ich zum Beispiel einem jungen Tänzer zuschaue, der mich in seiner Art der Bewegung an jemanden erinnert, den ich im NDT oder bei «Kidd Pivot» bewundert habe… Oder wenn ich an einem Ort bin, der mich an einen Bühnenraum bei Jiří Kylián oder Crystal Pite erinnert.
Als ich mit dem Choreografieren anfing, 2013 oder 2014, habe ich mich erstmal sehr auf Dinge bezogen, die ich bis dahin selbst getanzt hatte. Aber inzwischen arbeite ich nicht mehr so. Ich habe versucht, authentischer und ehrlicher mit mir selbst zu sein. Heute arbeite ich sehr kollaborativ, und darum sind mir die Gespräche mit den Tänzerinnen und Tänzern so wichtig. Sie sollen sie selbst sein und nicht wie eine Kopie von mir aussehen. Aus diesem Grund sind die Spiegel in meinen Proben verhängt. Die Tänzer müssen sich auf ihre eigene Empfindung verlassen und finden so zu einer anderen Authentizität.
In deinen Choreografien verbinden sich abstrakte und narrative Elemente. Das ist auch in deinem neuen Stück für das Junior Ballett so, in dem uns drei Männer und drei Frauen begegnen. Welche Beziehung besteht zwischen diesen sechs Figuren?
Es sind sechs sehr unterschiedliche Charaktere, die sehr typenhaft gezeichnet und miteinander verbunden sind. Die Choreografie spürt ihren Beziehungen nach, aber es stellt sich immer die Frage, ob das, was wir sehen, schon die ganze Wahrheit ist. Täglich erleben wir, dass alles im Leben mit einer Konsequenz geschieht, dass alles eine Folge von etwas ist. Das hat für mich etwas Tröstliches und birgt eine besondere Art von Schönheit und Poesie, die ich in dieses Stück zu übertragen versucht habe.
Die sechs Typen in deinem Ballett erinnern mich an ein legendäres Stück von Luigi Pirandello. In «Sechs Personen suchen einen Autor» (1921) erfindet der sizilianische Autor eine verbindende Handlung für sechs individuelle Charaktere. Kann man das mit deiner Arbeit vergleichen?
Die Figuren sind bei mir nicht nur durch den Tanz, sondern auch durch verschiedene Requisiten verbunden. Das sind zum Teil sehr poetische Dinge wie ein kleiner Heissluftballon, ein Goldfischglas oder ein Spielzeugmond. Beim Blick auf diese Gegenstände stellen sich im Kopf der Tänzer, aber auch des Publikums ja automatisch bestimmte Bilder ein, die sich wiederum mit der Choreografie verbinden.
Hier in Zürich arbeite ich jetzt mit sechs Mitgliedern des Junior Balletts, aber die Idee zu diesen Requisiten kam mir, als ich beim Bolschoi-Ballett in Moskau ein ziemlich klassisches Stück für ein riesiges vierzigköpfiges Ensemble choreografiert habe. Dort ist mir noch einmal sehr klar geworden, welch riesige Rolle die sozialen Medien wie Instagram und Facebook im Leben von jungen Tänzerinnen und Tänzern spielen. Die Welt der Klicks und Likes wird allzu leicht mit Realität verwechselt. In einem Chat postete irgendjemand Fotos von einem Ausflug mit einem Heissluftballon, und ich musste sofort an die Gefühle bei solch einem Flug denken: das Schweben, die Ruhe und Meditation beim Blick in den Himmel und auf die Erde da unten. Das war der Ausgangspunkt für die verschiedenen Arten von Begegnungen in diesem Stück, die so, aber vielleicht auch ganz anders hätten verlaufen können. Es sind diese Zufälligkeiten, die mich immer wieder faszinieren…
… und die deinem Stück seinen fast seinen Titel gegeben hätten. Es heisst jetzt «Pure Coincidence», aber auch über den Titel «G.U.T.» hast du nachgedacht. Was hat es damit auf sich?
In New York bin ich vor zwei Jahren mit meiner Mutter auf einem Obstmarkt gewesen und wurde dort von einer alten Frau angesprochen. Sie bat mich, mein Handy benutzen zu dürfen, weil sie Opfer eines Diebstahls geworden sei. Ich liess sie telefonieren und kam dann mit ihr ins Gespräch, in dessen Verlauf sie schliesslich auf die Grand Unified Theory (G.UT.), eine komplizierte physikalische Feldtheorie, zu sprechen kam. In ihrer Weisheit und Intelligenz erwies sie sich als einer der interessantesten Menschen, denen ich in New York begegnet bin. Es sind solche Situationen, die ich in der Erinnerung mit mir herumtrage, und die dann plötzlich irgendwo in einem Kreationsprozess auftauchen und durch mich und die Tänzer, mit denen ich arbeite, eine neue Interpretation erfahren.
Überraschend ist deine Musikauswahl: Sie setzt auf starke Kontraste und stilistische Diversität. Das Ganze ist eine Mischung aus Soul, Klavierklängen und atmosphärischen Geräuschen. Welche choreografischen Türen öffnet dir die Musik?
Das funktioniert ähnlich wie bei den Requisiten, von denen ich gesprochen habe. Wie viel Risiko will ich den Tänzern zumuten, und wie fordere ich mich mit einer Musikauswahl auch selbst heraus? Wie kann ich meine Grenzen erweitern? Mich interessiert keine Musik, die mir das Leben als Choreograf erleichtert. Ich brauche Musik, die mich zum Widerspruch und zur Auseinandersetzung anregt.
In deinen Proben mit dem Junior Ballett war Aufrichtigkeit ein wichtiges Thema. Was meint das in Bezug auf den Tanz?
Ehrlichkeit ist ein viel strapazierter Begriff, aber ich benutze ihn trotzdem. Im Tanz kannst du schnell jemandem etwas vormachen mit einer interessanten Bewegung oder einer komplizierten Schrittkombination. Aber ich merke ziemlich rasch, wenn jemand lügt. Gerade für die jungen Tänzerinnen und Tänzer, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, ist das Suchen nach tänzerischer Wahrheit eine wichtige Erfahrung. Aus der Ballettschule sind sie gewohnt, dass ihnen ständig jemand sagt, etwas sei richtig oder falsch. Das versuche ich zu vermeiden und ermutige sie, ihre eigene Wahrheit zu finden.
Das Gespräch führte Michael Küster
Fotos: Admill Kuyler
Impulse
Bryan Arias, Craig Davidson und Juliano Nunes sind die Choreografen unseres dreiteiligen Ballettabends «Impulse», der am 27.2. im Theater Winterthur im Live-Stream zu erleben ist. Wir haben drei Tänzerinnen und Tänzer aus unserem Junior Ballett gebeten, die neuen Werke, die gerade im Ballettsaal entstehen, aus ihrer Sicht zu kommentieren. Lesen
Achille de Groeve über «Pure Coincidence» von Bryan Arias
Mit Bryan Arias an seinem Stück zu arbeiten, geniesse ich sehr. Er ist ein sehr offener und aufgeschlossener Mensch, der den ständigen Dialog mit uns Tänzern und Tänzerinnen sucht. Das Gefühl, das man beim Tanzen seiner Choreografie hat, unterscheidet sich ganz grundlegend von den beiden anderen Stücken unseres neuen Ballettabends, weil der Fokus hier weniger auf der tänzerischen Technik, sondern noch viel mehr auf dem Ausdruck und den Emotionen liegt. Das Stück bietet sehr viel Freiheiten, nicht nur in der Art der Bewegungen, sondern auch bei der Beantwortung der Frage, was die Figuren in diesem rätselhaften Stück miteinander verbindet. Immer, wenn man eine Antwort gefunden zu haben scheint, stellt sich schon die nächste Frage.
Greta Calzuola über «Entropy» von Craig Davidson
Die Zusammenarbeit zwischen einem Choreografen und einem Tänzer erinnert mich immer ein bisschen an Tischtennis: Auf beiden Seiten ist es ein ständiges Geben und Nehmen. Ich weiss noch, wie nervös ich vor der ersten Probe mit Craig Davidson war. Aber diese Nervosität verwandelte sich sehr schnell in Neugier und Entdeckerfreude. Wie bei jedem choreografischen Prozess versuchten wir, möglichst schnell an einen Punkt zu kommen, an dem wir mit unseren Bewegungen Craigs Ideen so gut wie möglich entsprechen. Seine Bewegungssprache hat mich von Anfang an fasziniert. Er findet eine harmonische Verbindung zwischen klassischen Linien und moderner Fluidität. Keine Bewegung bleibt folgenlos und führt fast automatisch zum nächsten Schritt, so dass ich jedes Mal verblüfft bin von den vielen Nuancen und Kontrasten. Plötzliche Verlagerungen der Körperachse vermögen Spannung zu erzeugen, manchmal überrascht er uns mit einem «contre temps», und dann wieder kann man sich völlig in den fliessenden Bewegungen verlieren.
Diese Kontraste finden sich nicht nur in den Gruppenpassagen, sondern auch in den zahlreichen Pas de deux und Pas de trois. Ich tanze zum Beispiel ein Duett mit meinem Kollegen Théo Just. Das ist wie ein ständiger Kampf zwischen Bleiben und Gehen, Schieben und Ziehen, Begehren und Verweigern. Energetisch fühlt es sich so an, als sei ich eine andere Person in einem anderen Leben. Aber es gibt in Craigs Choreografie auch das Gegenteil. In dem sehr langsamen und sinnlichen Duett, das Marta Andreitsiv und Luca D’Amato tanzen, verschmelzen die beiden in perfekter Symbiose zu einer einzigen Person. Craig ist es sehr wichtig, dass wir beim Tanzen besonders auf unsere Extremitäten achten, auf unsere Hände und unsere Füsse. Natürlich sind es in erster Linie die Beine und der Rumpf, die eine Bewegung erzeugen, aber die Ausdruckskraft einer Berührung, die verlängerte Linie durch eine Hand, die Klarheit und Präzision der Fussarbeit machen alles noch magischer. Wie Craig auf die ganz unterschiedlichen Qualitäten jedes Einzelnen von uns eingeht und sie in seine Choreografie integriert, bewundere ich sehr. Mit ihm zu arbeiten und so viel von ihm zu lernen, ist eine tolle Erfahrung.
Lukas Simonetto über «Union in Poetry» von Juliano Nunes
Die Arbeit mit Juliano Nunes war für uns alle ein echtes Privileg. Juliano ist ein Choreograf, der seinen ganz eigenen Stil hat und tolle Ideen mitbringt. Seine Choreografie ist sehr musikalisch. Bei ihm gibt es eine direkte Verbindung zwischen der Musik und dem Tanz, und das macht die Bewegungen so kraftvoll. Für mich ist seine Choreografie ein Ausdruck des engen Zusammengehörigkeitsgefühls, das während des langen und intensiven Entstehungsprozesses zwischen uns Juniortänzern entstanden ist. Dieses Gefühl der Verbundenheit trägt uns durch dieses Stück. Es ist eine «Reise», die uns von einem Ort zum anderen transportiert. Juliano nutzt nicht nur unsere körperlichen Fähigkeiten, sondern geht auch auf unsere ganz individuellen Persönlichkeiten ein. Das gefällt mir sehr.

Editorial
Verehrtes Publikum,
lassen Sie uns noch einmal ganz von vorne anfangen. Zweihundert Kilometer nördlich von Zürich, im schwäbischen Blaubeuren, haben Höhlenforscher vor knapp fünfzig Jahren eine Flöte gefunden. Ein Mensch der Altsteinzeit hat sie vor ca. 35.000 Jahren aus dem Knochen eines Sing-Schwans gebastelt. Sie hat drei Grifflöcher, war zierliche zwölf Zentimeter lang und gehört zu den ältesten, bisher bekannten Musikinstrumenten der Menschheit.
Weiterlesen
1. Dezember 2020
Verehrtes Publikum,
lassen Sie uns noch einmal ganz von vorne anfangen. Zweihundert Kilometer nördlich von Zürich, im schwäbischen Blaubeuren, haben Höhlenforscher vor knapp fünfzig Jahren eine Flöte gefunden. Ein Mensch der Altsteinzeit hat sie vor ca. 35.000 Jahren aus dem Knochen eines Sing-Schwans gebastelt. Sie hat drei Grifflöcher, war zierliche zwölf Zentimeter lang und gehört zu den ältesten, bisher bekannten Musikinstrumenten der Menschheit. Es muss also so gewesen sein, dass die Steinzeitmenschen, wenn sie dem Säbelzahntiger entkommen waren, das Mammut erlegt und die Beeren gepflückt hatten, am Lagerfeuer sassen und sich schönen Dingen widmeten. In der Höhle bei Blaubeuren hat man auch geschnitzte Figuren aus Mammut-Elfenbein gefunden, die zu den ältesten Kunstwerken der Menschheit gehören.
Unsere Vorfahren hatten also eine wahnsinnig anstrengende 140-Stunden-Woche und haben trotzdem musiziert und Plastiken geschnitzt. Warum? Weil es dem Menschen offenbar von Urzeiten an ein Bedürfnis war, sich künstlerisch zu betätigen. Weil die geistbegabte Spezies Mensch sich dadurch von allen anderen Kreaturen unterscheidet. Weil Friedrich Schiller, der schwäbische Nachfahre der schwäbischen Steinzeitmenschen, 34.805 Jahre später in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen den in Stein gemeisselten Satz zu Papier gebracht hat: «Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.»
Es wird ja in den Zeiten, in denen Kunstorte wegen Corona schliessen müssen, viel darüber nachgedacht, wie wichtig so etwas Teures und Aufwendiges wie ein Opernhaus für die Gesellschaft ist. Es mag nicht wichtig sein. Aber die Menschen haben das, was darin zu erleben ist, schon immer gemacht. Wenn es in der Familie Feuerstein von der schwäbischen Alb neben der Flötenspielerin noch einen guten Geschichtenerzähler gab und eine geschickte Wandmalerin, dann ist das Dargebotene von einer kleinen Lagerfeuer-Oper gar nicht mehr so weit entfernt.
Ich erzähle Ihnen das nicht, weil ich noch eine Sonntagsrede auf die allgemeine Bedeutung von Kunst halten möchte. Die sind im Moment ja so zahlreich wie bitter notwendig. Mir geht es um etwas anderes – um das Lagerfeuer! In der Phase der Corona-Kontakt-Beschränkungen sitzen wir wieder wie die Steinzeitmenschen nach Sippen getrennt am heimischen Lagerfeuer. Vor vierzig Jahren hat man das Fernsehen gern als das Lagerfeuer der modernen Gesellschaft bezeichnet. Zwischenzeitlich war die Glut dieses Feuers schwächer geworden, aber in Zeiten von Corona flackert sie, mangels Alternativen, wieder auf. Da ist es doch nur konsequent, dass das Opernhaus Zürich, das zurzeit keine Vorstellungen anbieten kann, den Corona-Höhlenbewohnern Oper für das heimische Lagerfeuer zur Verfügung stellt, wie in den guten, ganz alten Zeiten sozusagen.
Wir haben jedenfalls in den vergangenen sechs Wochen eine Neuproduktion von Giuseppe Verdis Oper Simon Boccanegra erarbeitet in einer Inszenierung von Andreas Homoki, mit Fabio Luisi am Dirigentenpult und Christian Gerhaher in der Hauptrolle, die am 6. Dezember vor 50 Menschen Premiere feiert und live im Fernsehen (auf ARTE) und als Stream auf unserer Website zu erleben ist. Versammeln Sie also Ihre Liebsten vor dem heimischen Lagerfeuer. Legen Sie sich ein Mammut-Steak für die Pause parat. Machen Sie es wie einst. Ich kann Ihnen versprechen, dass Verdis Musik spannender ist als das Gefiepe auf einer Schwanenflöte aus der Altsteinzeit.
Claus Spahn
Wir
erarbeiten
neue
Werke
und
streamen
erarbeiten
neue
Werke
und
streamen
1. Dezember 2020
Herr Homoki, in welcher Situation befindet sich das Opernhaus Zürich im Moment?
Wenn der Spielbetrieb in einer Kunstinstitution, an der so viele Menschen mitwirken und die so viel Geld kostet, nicht möglich ist, dann ist das eine Katastrophe. Meine Linie als Intendant ist es, den Vorhang möglichst jeden Abend hochgehen zu lassen, ein Repertoire zu pflegen und dem Publikum eine grosse Vielfalt an Stücken und künstlerischen Lesarten anzubieten. Deshalb schmerzt es mich sehr, dass das im Moment nicht geht. Und ich glaube, dass das alle im Haus so sehen. Wir wollen spielen. Dafür sind wir hier.
Aber im Gegensatz zum Frühjahr, als wir wegen der Pandemie nicht nur den Vorstellungsbetrieb, sondern auch die gesamte Probenarbeit einstellen mussten, sind wir jetzt in einer besseren Position, denn wir dürfen wenigstens proben. Das tun wir auch. Für die mittel- und langfristige Perspektive eines Repertoirehauses ist es von grosser Bedeutung, neue Werke erarbeiten zu können. Dass uns zumindest dies möglich ist, sehe ich positiv.
Wir haben in den letzten Wochen die Neuproduktion von Giuseppe Verdis Oper Simon Boccanegra hinter verschlossenen Türen geprobt und bringen sie nun zur Premiere. Dabei sind wir in der glücklichen Lage, dass wir schon vor Corona eine TV-Übertragung mit dem Sender ARTE abgesprochen hatten. Die Premiere wird nun also vor fünfzig Menschen im Opernhaus stattfinden, erreicht aber ein grosses, auch internationales Publikum, weil sie auf ARTE zu sehen ist und auch direkt auf dem Streaming-Kanal des Opernhauses. Das finde ich unter den gegebenen Möglichkeiten ein starkes Signal dafür, dass wir alles daransetzen, mit unserer Kunst weiter in die Öffentlichkeit zu wirken.
Die nächste geplante Neuproduktion ist dann Christoph Willibald Glucks Orphée et Euridice mit Christoph Marthaler als Regisseur. Auch die werden wir unabhängig von den Beschränkungen des Vorstellungsbetriebs proben und auf die Bühne bringen. Wenn wir sie Mitte Februar nicht live vor einem grösseren Publikum spielen können, werden wir sie ebenfalls per Stream als Online-Premiere anbieten.
Warum legt das Opernhaus keinen Spielplan für fünfzig Zuschauer auf?
Unser Spielmodell mit dem zugespielten Orchester und dem Chor und unsere szenischen Schutzkonzepte auf und hinter der Bühne geben uns die Möglichkeit, Vorstellungen coronasicher zu spielen. Aber unser grosses Problem ist ein wirtschaftliches – die fehlenden Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Wir haben ja schon oft erklärt, wie relevant dieser Faktor für uns ist. Der Anteil der Einnahmen am Gesamtbudget ist am Opernhaus Zürich vergleichsweise sehr hoch, und wenn dieses Geld fehlt, funktioniert das ganze wirtschaftliche System nicht mehr. Viele unserer Kosten sind direkt an die Vorstellungen gebunden, und wenn wir nur für fünfzig Leute spielen, erzielen wir Abend für Abend Verluste, die erheblich sein können. Deshalb wäre es horrend für unsere Bilanz, wenn wir unbekümmert grosse Oper für 50 Menschen spielen würden. Wir haben eine Verantwortung gegenüber der öffentlichen Hand, in dieser schwierigen Situation die Verluste so gering wie möglich zu halten.
Das Theater einfach abzuschliessen, ist aber doch auch keine Alternative. Wie versuchen Sie diesem Dilemma zu entkommen?
Das Opernhaus ist zu fünfzig Prozent in Kurzarbeit. Das heisst, wir können zu fünfzig Prozent arbeiten, und diese Möglichkeit schöpfen wir voll aus. Orchester, Chor, Ballett, Solisten, Internationales Opernstudio arbeiten alle im Rahmen dieser Möglichkeiten an Projekten, die wir dann auch der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Da zurzeit nur wenige Zuschauer im Haus gestattet sind, nutzen wir die digitalen Möglichkeiten und streamen die Projekte. Den Anfang macht, wie schon erwähnt, die Simon Boccanegra-Premiere, aber weitere Sachen sollen folgen. Die werden wir zu einem späteren Zeitpunkt im Detail vorstellen. Sie sollen ein Zeichen setzen, dass das Opernhaus lebt, dem Publikum weiterhin Angebote präsentiert und versucht, das Beste aus der misslichen Lage zu machen.
Wie könnten Öffnungsszenarien aussehen bei Lockerungen der Corona-Massnahmen, die ja irgendwann kommen werden?
Was die Stücke angeht, sind wir vorbereitet. Wir können den Betrieb mit attraktiven Produktionen ganz schnell wieder hochfahren. Das ist ein Vorteil des Corona-Spielmodells, für das wir uns entschieden haben. Wenn die Zuschauerzahl nach und nach in kleinen Schritten heraufgesetzt wird, kommen allerdings schwierige Fragen der Abwägung auf uns zu. Wollen und können wir es uns leisten, für beispielsweise 200 Menschen unsere aufwendigen Produktionen trotz der Einnahmeverluste zu spielen? Auf der anderen Seite können wir mit den Vorstellungen nicht warten, bis alles wieder normal ist. Es wird nicht leicht sein, da einen guten Mittelweg zu finden.
Aus Ihrem Mund vernimmt man kein Grundsatz-Lamento über den Bedeutungsverlust von Kultur in Zeiten von Corona. Warum?
Das mag vielleicht naiv sein: Weil ich die Gesamtsituation nicht so krass negativ sehe. Ich habe die Hoffnung, dass wir aus der Krise auch wieder rauskommen, und wenn ich mein Haus anschaue, sehe ich trotz Corona keinen Anlass, den Weltuntergang auszurufen. Wir hatten in der vergangenen Spielzeit bis zum Shutdown eine Auslastung von 91 Prozent. Wir konnten unsere Zuschauerzahlen drei Jahre lang hintereinander auf sehr hohem Niveau steigern. Das werden wir in dieser Form möglicherweise nicht so schnell wieder erreichen. Aber ich sehe nicht, warum wir nicht auch in Zukunft grundsätzlich auf diese breite Akzeptanz bauen können.
Stillstand? Keineswegs!
«Das Opernhaus ist geschlossen.» So steht es auf einem Schild an unserem Haupteingang. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, zucke ich unwillkürlich zusammen. «Geschlossen» klingt nach leeren Gängen, verwaisten Büros, Stillstand in den Werkstätten, leerer Bühne, stummen Proberäumen. Tritt man durch den Bühneneingang jedoch ein in dieses geschlossene Opernhaus, ist man mitten im Gewusel von Menschen, die ausgesprochen beschäftigt wirken. Wie vor Corona ist es allerdings nicht: Man «wuselt» mit Abstand, deutlich gebremst und mit gedämpfter Stimmung.
Warum wuseln wir noch, obwohl das Haus geschlossen ist? Was machen die über 600 Mitarbeitenden eigentlich jetzt?
Die Dekorations- und Kostümwerkstätten stehen nicht still. Alle Maschinen laufen, und die Mitarbeitenden arbeiten hart an den Premierenvorbereitungen für die nächsten sechs Monate. Kostüme und Bühnenbilder müssen hergestellt werden. Zwar kann niemand voraussehen, ob wir in vier Monaten spielen werden oder nicht, aber die Verträge mit den Künstlerinnen und Künstlern stehen, und viele Stücke zeigen wir ja auch in den nächsten Jahren als Wiederaufnahmen.
Chor und Orchester sind in fünfzigprozentiger Kurzarbeit – aber zurzeit ebenfalls im Einsatz, denn die Endproben für Verdis Simon Boccanegra laufen. Nach dieser Premiere beginnen bereits die musikalischen Proben für die nächste Neuproduktion. Für die Technik fallen die Vorstellungsdienste weg – das führt am Ende eines Monats zu einem Arbeitseinsatz von 50 Prozent. Dazu proben unsere Sängerinnen, Sänger, Musikerinnen und Musiker auch zuhause, um ihr Niveau zu halten. Gleiches gilt für das Ballett, das ebenfalls in Teil-Kurzarbeit ist, aber dennoch jeden Tag in den Ballettsälen trainiert und sich auf die nächsten Wiederaufnahmen vorbereitet. Ziel ist, zumindest zwei Ballettproduktionen so gut zu proben, dass man sie bei einer Öffnung des Opernhauses sehr rasch wieder spielen kann.
Auf der Bühne steht das Bühnenbild von Simon Boccanegra. Wir müssen es nicht auf- oder abbauen, da es keine Abendvorstellungen mehr gibt. Auch hier konnten wir den Personalaufwand auf 50 Prozent reduzieren. Die anderen 50 Prozent brauchen wir aber auch: es gibt viele Umbauten in dieser Inszenierung und natürlich auch Requisiten, Möbel, Licht, Ton. Unsere Tonabteilung hat durch die Übertragung vom Orchesterproberaum auf die Bühne viel zu tun. Und nach der Premiere von Simon Boccanegra warten weitere Projekte, die wir neu auf die Bühne bringen werden. Was das genau sein wird, veröffentlichen wir später. Aber auch diese Projekte brauchen Organisation, Proberäume, Künstler, Kameras, Technik und das Marketing.
Die künstlerische Direktion ist mit den ganzen Absagen und Verschiebungen stark gefordert, es müssen im besten Fall neue Slots für Produktionen gefunden und zahlreiche Verträge angepasst werden. Da unsere Planung derzeit bis zum Sommer 2025 geht, führen diese Verschiebungen zu Rochaden über mehrere Spielzeiten. Die Personalabteilung und die Lohnbuchhaltung müssen momentan sehr viel leisten. Die Kurzarbeit der verschiedenen Personalgruppen mit ihren völlig verschiedenen Arbeitsmodellen und Abrechnungszyklen richtig abzurechnen, ist eine grosse Herausforderung. Auch die Billettkasse kann sich nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Abgesagte Vorstellungen müssen rückerstattet werden, und für zukünftige Vorstellungen müssen neue Sitzpläne erstellt werden – je nach geltender Abstandsregel. Ist alles angepasst, ändert sich die Regel womöglich wieder und man beginnt von vorne. Unsere Finanzabteilung ist auch gefordert, denn wir müssen jederzeit die Kontrolle und Übersicht über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf unser Haus behalten. Verschiebt sich eine Premiere in eine andere Spielzeit, müssen Abschreibungen und Anlagewerte neu berechnet werden. Die nächsten Spielzeiten werden vorbereitet, budgetiert und besetzt. Das beschäftigt auch Geschäftsleitung, Marketing, Dramaturgie, die Disposition und alle künstlerischen Büros von Ballett, Chor, Orchester usw. Und die Hausverwaltung kommt mit dem Desinfizieren von Räumen, Türgriffen, Liftknöpfen und dem Nachfüllen von Desinfektionsmittel kaum hinterher.
Nein, das Opernhaus ist nicht geschlossen! Wir können zurzeit nur nicht für unser Publikum öffnen. Das schmerzt. Aber wir setzen alles daran, spielbereit zu bleiben und freuen uns, wenn es endlich wieder losgehen kann.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich
Illustration: Anita Allemann
Politische Konflikte,
private Katastrophen
private Katastrophen
«Simon Boccanegra» gehört nicht zu den populärsten Opern Giuseppe Verdis, ist aber ein packendes Drama voll von szenischen Kontrasten und aufwühlender Musik. Ein Gespräch mit Regisseur Andreas Homoki, der das Werk am Opernhaus Zürich inszeniertLesen
Andreas Homoki, die Oper Simon Boccanegra wurde 1857 am Teatro la Fenice in Venedig uraufgeführt und war zunächst kein Erfolg. Noch heute hat sie den Ruf, «ein Verdi für Kenner» zu sein. Woran liegt das?
Ein zentraler Grund dafür ist sicher die ungewöhnliche Figurenkonstellation dieses Stücks, das wie Il trovatore auf einem Drama des Spaniers Antonio García Gutiérrez basiert. Diese Konstellation unterläuft die Erwartungen, die man an eine Oper des 19. Jahrhunderts für gewöhnlich hat. Im Fokus steht hier nicht die Dramatik eines Liebespaars, das gegen gesellschaftliche Widerstände ankämpft, wie etwa in La traviata. Stattdessen entwickelt sich die Handlung im Spannungsfeld zwischen zwei politisch wie privat verfeindeten Männern, dem Bariton Simon Boccanegra und dem Bass Jacopo Fiesco.
Der Librettist Arrigo Boito, der 1881 zusammen mit Verdi eine stark überarbeitete Neufassung schuf, attestiert dem Stück «viel Intrige und nicht viel Zusammenhang». Empfindest du das als Regisseur auch so?
Nein. Es geht in der Handlung oft um Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen: Die Vorgeschichte um eine frühere Episode in Simon Boccanegras Leben wird retrospektiv in einem Prolog erzählt, der 25 Jahre vor der eigentlichen Handlung stattfindet. Diese sprunghafte Dramaturgie kann man als Problem auffassen. Als Regisseur empfinde ich sie aber als eine Bereicherung, weil sie mir die Möglichkeit gibt, von der realen Erzählebene wegzugehen und imaginäre Räume der Erinnerung und der Sehnsucht aufzumachen. Das war auch sehr früh konstituierend für das Bühnenbild von Christian Schmidt, das diese imaginären Räume auf einfache Weise herstellen kann.
Fordert Verdis Oper nicht ohnehin eher starke theatralische Situationen als eine realistische Erzählweise?
Stimmt. Verdi hält sich im Gegensatz zu den Komponisten der Generation von Boito oder später Puccini nie mit beschreibendem Kolorit oder der Schilderung eines Milieus auf. Sein szenisches Denken ist ausgesprochen anti-naturalistisch. Man staunt immer wieder, wie unglaublich offen Verdi ist in dem, was er von einer Bühne verlangt. Es zeigt sich da eine grosse Nähe und Geistesverwandtschaft zu Shakespeare, von dessen Stücken er fasziniert war. Man kann deshalb eigentlich jede Verdi-Oper mit ganz einfachen Bühnenmitteln aufführen. Vor 25 Jahren habe ich in Freiburg die erste Fassung des Simon Boccanegra inszeniert. Die Bühne bestand einfach aus einer grossen Treppe – eine typische Shakespearebühne.
In Zürich inszenierst du nun die revidierte Fassung, die 1881 an der Mailänder Scala zum ersten Mal gespielt wurde. Was sind die entscheidenden Unterschiede?
Sie entspricht ein bisschen mehr dem, was damals als modern empfunden wurde. Arrigo Boito hat viele Szenen detailreicher ausgearbeitet, was den von Verdi stets geforderten Prinzipien Einfachheit und Natürlichkeit eigentlich widerspricht. Das fand ich in früheren Auseinandersetzungen mit dieser Fassung eher ärgerlich. Die eigentliche Stärke der Fassung von 1881 ist aber ihr musikalischer Reichtum, der von Verdis fortgeschrittener Erfahrung als Komponist zeugt. Ganz besonders spüre ich im Finale des ersten Akts, das Verdi und Boito für diese Fassung komplett neu geschrieben haben, den Einfluss des Requiems, das Verdi in der Zwischenzeit komponiert hatte. Für mich ist das Requiem ein Schlüsselwerk in der kompositorischen Entwicklung Verdis, weil es durch und durch theatralisch gedacht ist, ohne an dramaturgische Notwendigkeiten einer äusseren Handlung gebunden zu sein. Ich habe das Gefühl, dass Verdi sich da musikalisch noch einmal eine neue Dimension erschlossen hat. Und aus dieser Erfahrung kann er bei der Neufassung von Simon Boccanegra nun schöpfen. Das grosse Concertato im Finale des ersten Aktes ist in seiner Darstellung einer kollektiven Situation und in der Entfaltung von Emotionen einfach atemberaubend. Allein deshalb ist es richtig, dass wir diese zweite Fassung spielen.
Wie fast immer bei Verdi sind die privaten Schickale auch in dieser Oper stark in einen politischen Kontext eingebunden. Was ist das in diesem Fall für ein Hintergrund?
Die Handlung bezieht sich auf ein historisches Ereignis im 14. Jahrhundert, als der Korsar Simon Boccanegra zum ersten Dogen von Genua gewählt wurde. Tatsächlich ist es aber eine zeitlose, geradezu archaische Konstellation des Übergangs von einer bis dahin fast rein aristokratischen Herrschaftsform hin zur politischen Einbeziehung anderer Gesellschaftsschichten. Das aristokratische System wird dadurch ausgehebelt, dass mit Simon Boccanegra ein Bürgerlicher, der als Seefahrer noch dazu ein politischer Aussenseiter ist, an die Macht kommt. Die Adeligen, zu denen Boccanegras Erzfeind Jacopo Fiesco gehört, versuchen sich im Verlauf der Handlung gegen den neuen Herrscher zu verbünden, gegen ihn zu putschen und ihn abzusetzen. Es ist eine klassische Situation, wie sie im Mittelalter durch das Vordringen des Bürgertums an mehreren Orten stattgefunden hat.
Eine solche Bewegung gab es im 14. Jahrhundert auch hier in Zürich: Rudolf Brun stürzte 1336 mithilfe der Handwerkszünfte den alten Rat, der bis dahin aus Adeligen und Notabeln bestand. Brun wurde der erste Bürgermeister von Zürich und regelte die Beteiligung der Zünfte an der Stadtregierung in einer Verfassung. In der Folge führte das aber auch zu blutigen Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern.
Vor dem politischen Hintergrund tut sich eine puzzlehafte dramaturgische Konstellation von privaten Zusammenhängen auf, die sich für die einzelnen Figuren erst im Lauf der Handlung aufklären... Was wird im Prolog erzählt, den Boito als «dicht und dunkel wie ein Stück Basalt» beschrieben hat?
Der Prolog beschreibt den Moment, in dem es einer bürgerlichen Mehrheit gelingt, den Aussenseiter Simon Boccanegra an die Macht zu bringen. Zufällig erfährt Boccanegra gerade in diesem Moment, dass seine Geliebte Maria – Fiescos Tochter, mit der er ein uneheliches Kind hat – gestorben ist. Das Ende des Prologs bildet also den grösstmöglichen Kontrast zwischen einem absoluten Triumph im Politischen und einer absoluten Katastrophe im Privaten: «Una tomba» hört man Boccanegra sagen, während Paolo Albiani, der Simone zur Macht verholfen hat, ruft: «un trono».
Das ist sehr wirkungsvoll, aber ein bisschen konstruiert...
Finde ich nicht. Verdi ist in seiner Gestaltung von Situationen immer viel glaubwürdiger, als es die Konstruktion des Librettos vermuten lässt. Durch Vereinfachung und musikalische Zuspitzung vermag er die Emotionen solcher Situationen sehr klar zu vermitteln. Man ist gut beraten, sich nicht zu sehr an der Oberfläche des Textes aufzuhalten, sondern auf die Musik zu hören. Da kommt dann eben dieses Shakespearehafte zum Tragen und das, was sich im Requiem in so purer Energie entfaltet.
Das gemeinsame Kind mit Maria, das zunächst verloren scheint, findet Simon Boccanegra 25 Jahre später wieder. Es trägt aber den Namen Amelia Grimaldi und liebt einen Adeligen namens Gabriele Adorno...
Der öffentliche politische Konflikt wird in der Fortsetzung der Handlung sozusagen in die Familie hineingetragen: Boccanegras Tochter ist als Waisenkind in die Familie Grimaldi aufgenommen worden, wurde adelig sozialisiert und hat sich in einen Adeligen verliebt. Die beiden politischen Extrempole spitzen sich also weiter zu, zumal Boccanegra es für besser hält, die wahre Identität seiner Tochter vorerst für sich zu behalten. Boccanegras Freund Paolo, der an Amelia interessiert ist, durchschaut diesen Zusammenhang nicht; und dieser private Umstand führt letztlich zu einer Intrige gegen den Dogen mit tödlichem Ausgang. Der politische Zwiespalt, der das Stück durchzieht, erlaubt es Verdi, Simon Boccanegra als einen klugen Herrscher zu zeichnen, der darauf bedacht ist, extreme Spannungen auszugleichen. Für Verdi spiegelte sich in dieser Thematik natürlich der Risorgimento-Gedanke in Italien wider, in dem er stets für das Vereinende eintrat, nie für das Trennende.
Im neugeschriebenen Finale des ersten Akts verstärken Verdi und Boito diesen Risorgimento-Gedanken, indem sie Boccanegra Worte des Renaissance-Humanisten Francesco Petrarca in den Mund legen, die zu Vereinigung, Liebe und Frieden aufrufen. Interessant ist allerdings, dass Boccanegra dem Volk, das in dieser Szene seinen Palast bedrängt, mit einer zweifelnden Haltung gegenübertritt...
Die zweite Fassung der Oper ist entstanden, nachdem Verdi sich für die Einigung Italiens stark gemacht und 1861 sogar kurze Zeit als Abgeordneter im ersten italienischen Parlament gesessen hatte. Er war in der Folge vom Ausbleiben eines sozialen Fortschritts aber schwer enttäuscht, und das zeigt sich hier auch. Verdi hatte keinen romantisch verklärten Begriff vom «Volk»; er weiss, dass es aus unterschiedlichsten Menschen besteht, dass es wankelmütig sein kann, und dass es eine wahnsinnig zerstörerische Kraft bis hin zu Bürgerkriegen entwickeln kann, wenn es gespalten ist, oder, wie in einer Diktatur, unterdrückt wird. Eine gute Regierung muss sich dessen bewusst sein und dafür sorgen, alle Interessen soweit auszugleichen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist.
Amelia ist die einzige weibliche Figur auf dieser von Männern dominierten Bühne. Sie wird als Tochter, Enkelin und Geliebte beansprucht und deshalb oft als passive und leidende Figur aufgefasst. Ist das auch deine Sicht?
Nein. Dass die Frauenfiguren in der Oper des 19. Jahrhunderts schwach seien, ist ein hartnäckiges Vorurteil. Das Gegenteil ist der Fall! Die Frauen hatten im 19. Jahrhundert in der Realität eine Stellung, die sie sowohl vom politischen Einfluss ausschloss als auch der Willkür der Familien auslieferte. Im Kontext dieser unglaublich begrenzten Möglichkeiten betrachtet, sind viele weibliche Figuren im Opernrepertoire des 19. Jahrhunderts unglaublich stark: Sie wachsen über die ihnen zugetrauten Rollenbilder hinaus, begehren dagegen auf, indem sie gegen die Gesellschaft Stellung beziehen, und begeben sich für die Verwirklichung ihrer Bedürfnisse nach Liebe und einer erfüllten Partnerschaft in hoffnungslose Situationen oder sogar in den Tod.
Das Jahrhundert Verdis prägt diese Oper also in verschiedenerlei Hinsicht. Hast du deshalb auch entschieden, die Mittelalter-Handlung ästhetisch näher an unsere Zeit heranzurücken?
Es war uns wichtig, die 25 Jahre, die zwischen Prolog und Haupthandlung vergehen, kenntlich zu machen. Der ästhetische Bruch zwischen 1335 und 1360 ist für den Zuschauer von heute aber überhaupt nicht nachvollziehbar. Eine vergleichbare und uns eher vertraute politische Situation, in der die aristokratischen Eliten vom Bürgertum verdrängt wurden, ist der 1. Weltkrieg. Deshalb siedeln wir die Handlung etwa zwischen 1895 und 1920 an, was uns erlaubt, den Zeitsprung von 25 Jahren deutlich und aus heutiger Perspektive nachvollziehbar zu erzählen.
Das Bühnenbild von Christian Schmidt hast du bereits angesprochen. Wie sieht Genua bei ihm aus?
Christian hat einen architektonischen Raum gestaltet, der sowohl private Innenräume als auch öffentliche Aussenräume darstellen kann, ohne Innen und Aussen allzu konkret voneinander abzugrenzen. Es ist ein geradezu labyrinthisch wandelbarer Raum, der uns eben auch erlaubt, mehrere Zeitebenen miteinander zu verbinden. Historische Architektur ist ja immer auch ein stummer Zeuge für Geschehnisse, die dort stattgefunden haben. So zeigen wir beispielsweise ein Bootswrack, das Assoziationen zu Boccanegras früherer Zeit als Seefahrer, aber auch zum Meer herstellt, das in der Hafenstadt Genua omnipräsent ist. Es wehen also auch Erinnerungen in diesen Raum.
Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist es nicht möglich, den Chor auf der Bühne auftreten zu lassen. Wie begegnest du diesem Problem?
Da es in diesem Stück explizit um die Kraft einer grossen Volksmasse geht, konnte ich es mir ohne Chorpräsenz auf der Bühne zunächst gar nicht vorstellen. Bei der genaueren Beschäftigung habe ich aber festgestellt, dass der Chor, insbesondere in seiner zentralen Szene am Ende des ersten Aktes, eine Kraft ist, die von aussen hereindringt. Indem wir nun nicht 60 ChoristInnen auf der Bühne zeigen, die «das Volk» repräsentieren sollen, sondern eine unbestimmte Menge von draussen hörbar machen, wird diese Volksmasse in der Vorstellung des Publikums eigentlich grösser! Ich würde es jetzt nicht zur Grundregel machen, Simon Boccanegra so zu inszenieren, aber unsere Version hat für mich eine volle Berechtigung und Gültigkeit, auch über die Corona-bedingten Abstandsregelungen hinaus.
Die Oper endet tragisch mit dem Tod von Simon Boccanegra. Sein einstiger Freund Paolo verwandelt sich in einen Intriganten, wird in einer spektakulären Selbstverdammungsszene schwer gedemütigt und vergiftet daraufhin den Dogen. Bleibt am Ende auch ein Hoffnungsschimmer?
Simon Boccanegra erreicht kraft seiner Persönlichkeit eine temporäre Beruhigung der bürgerkriegsähnlichen Wirren, und es kommt vor seinem Tod zu einer Versöhnung mit den Adeligen. In gewisser Weise kann man das als hoffnungsvolles Ende sehen. Leider gibt es unter den Überlebenden aber keinen einzigen Bürgerlichen. Man könnte das Ende also auch so auffassen, dass der Demokratisierungsversuch gescheitert ist, und eine leicht reformierte adelige Minderheit mit Adorno an der Spitze die Macht wieder übernimmt. Aber am Ende überwiegt einfach die Traurigkeit um das Leid und den Tod dieses stets um Ausgleich bemühten Menschen. Es bleibt die Aufforderung an uns alle, es weiter zu versuchen.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche
Morden mit
Tropfen
Tropfen
In Verdis «Simon Boccanegra» fällt der Titelheld einem Giftanschlag zum Opfer. Der Tod durch Vergiften hat eine lange Tradition in der Kunst, aber auch in der Wirklichkeit, wie das Attentat auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny zeigt. Ein Essay aus gegebenem Anlass von Fabio Dietsche Lesen
Am 20. August 2020 fliegt der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny von Tomsk nach Moskau. Kurz nach dem Start fühlt er sich plötzlich unwohl. Er geht zur Toilette. Wenig später hören Mitreisende schmerzerfüllte Schreie. Nawalny verliert das Bewusstsein. Das Flugzeug muss notlanden. Die Angehörigen des Politikers, der als scharfer Kreml-Kritiker bekannt ist, hegen sofort den Verdacht, dass es sich um einen Giftanschlag handeln könnte. Russische Ärzte dementieren diese Vermutung. Erst in der Berliner Charité, wohin Nawalny transportiert wird und wo er noch tagelang im Koma liegt, wird nachgewiesen, dass er mit einer bisher unbekannten Version des Nervengifts Nowitschok vergiftet wurde.
Der aufsehenerregende Fall aus jüngster Zeit könnte aus einem Thriller stammen, und diese Nähe zur Fiktion spricht Nawalny gleich selbst an, als er im Oktober 2020 dem Reportagen-Magazin The New Yorker ein ausführliches Interview gibt: Den Moment, in dem er vergiftet wurde, vergleicht er mit dem Kuss eines Dementors, eines jener todbringenden magischen Wesen aus Harry Potter, deren Gesichter stets unter einer grossen schwarzen Kapuze versteckt bleiben.
Giftstoffe üben seit jeher eine grosse Faszination aus: «Es gab keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der nicht Gifte durch ihre dämonische Eigenart schon an sich, und besonders dann Eindruck auf Menschen gemacht haben, wenn sie, gewollt oder ungewollt, ihre Kraft in ihnen entfalteten», so der deutsche Toxikologe Louis Lewin (1850-1929) in seinem Werk Die Gifte in der Weltgeschichte, in dem er Vergiftungsfälle seit der Antike untersucht. Alt und umfangreich ist auch die Bearbeitung des Topos für die Bühne: Schon der Mythos um Medea, den Euripides dramatisierte, erzählt, wie Kreons Tochter in einem vergifteten Kleid einen grauenvollen Tod findet; exzessive Ausmasse nehmen die Giftintrigen in William Shakespeares Hamlet oder Victor Hugos Lucrèce Borgia an. Oft sind es Frauen, die über die nötigen Gift-Kenntnisse verfügen: Auf der Opernbühne beispielsweise auch Schostakowitschs Katerina Ismailowa, jene Lady Macbeth von Mzensk, die dem Pilzgericht ihres Schwiegervaters eine Prise Rattengift beimischt.
Mit einem Gifttod endet auch Giuseppe Verdis Oper Simon Boccanegra. Wie im Fall von Alexei Nawalny wird auch dort ein Politiker Opfer eines Giftanschlags. Modell für Verdis Drama stand allerdings kein Oppositionspolitiker, sondern der erste Doge der Republik Genua, auf den in der Realität mehrere Giftanschläge verübt wurden – der letzte, 1363, mit tödlichem Ausgang.
Die Wirkung eines Giftes kann sehr leise einsetzen. Nawalny glaubt, dass er die Nowitschok-Substanz irgendwo angefasst haben muss. Auf einem Türgriff vielleicht. Diese Unsichtbarkeit und die Gefahr, potenziell überall verborgen zu sein, macht Gift als Waffe so unheimlich. «Es erschreckt Menschen sehr effektiv», sagt Nawalny.
Ganz ähnlich hat das 1818 schon E. T. A. Hoffmann in seiner Erzählung Das Fräulein von Scuderi geschildert. Der Anlass ist dort ein «geheimnisvolles Kästchen», das mitten in der Nacht für das Fräulein abgegeben wird. Der Erzähler berichtet von «verruchtesten Greueltaten», die sich damals abspielten, zu denen «die teuflischste Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel» bot: Einem Italiener namens Exili, so der Erzähler weiter, gelang es nämlich, «jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt, und alle Kunst, alle Wissenschaft der Ärzte täuscht, die den Giftmord nicht ahnend, den Tod einer natürlichen Ursache zuschreiben müssen.»
Die Erzählung des Schriftstellers und Juristen E. T. A. Hoffmann steigt hinauf «ins Fantastische», ist aber trotzdem «auf geschichtlichen Grund gebaut»: Der Untertitel weist nämlich auf das Zeitalter Ludwigs XIV. hin und damit auf eine spektakuläre Serie von Giftmorden, in der die Marquise von Brinvillier eine zentrale Rolle spielte. Besonders perfide war, wie Hoffmann einflicht, dass sich das Töten mit Gift damals zu einer Art Leidenschaft entwickelte: «Ohne weiteren Zweck, aus Lust daran, wie der Chemiker Experimente macht zu seinem Vergnügen, haben oft Giftmörder Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen völlig gleich sein konnte.»
In seinen toxikologischen Untersuchungen nennt Louis Lewin auch den konkret verwendeten Wirkstoff in dieser Affäre des 17. Jahrhunderts: Poudre de succession wurde er in Frankreich ironisch genannt, Erbschaftspulver: «Es wirkte nicht jäh, sondern täuschte vor, dass eine Krankheit in dem Opfer wüte. In den allermeisten Fällen wurde Arsenik gebraucht.» Die giftige Wirkung von Arsen, wie diese chemische Verbindung umgangssprachlich genannt wird, ist seit der Antike bekannt und war über Jahrhunderte hinweg der mit Abstand am häufigsten verwendete Giftstoff: «Seine Wirkungsäusserungen sind so vielgestaltig, ähneln so oft Krankheiten aus inneren Gründen und treten so sicher ein, seine vergiftenden Dosen sind so klein, seine Beibringung so leicht zu bewerkstelligen», zählt Lewin auf, «dass er allen damals und später bekannten pflanzlichen Giftzubereitungen als Vergiftungsmittel unendlich überlegen ist».
Über Giftmorde mit Arsen im 14. Jahrhundert, in dem in Genua der Doge Simone Boccanegra getötet wurde, ist laut Lewin «wenig absolut Sicheres» bekannt. Hinweise ergäben sich jedoch aus toxikologischen Berichten, «die zwar über die Art des verwendeten Giftes nichts melden, wohl aber Giftwirkungen erwähnen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Arsen als Verursacher hinweisen». Mit diesem Ansatz hat der brasilianische Chemiker und Opernkenner João Paolo André in neuerer Zeit verschiedene Opernhandlungen untersucht und ist im Fall von Verdis Simon Boccanegra zum Schluss gekommen, dass es sich auch hier um eine giftige Arsen-Verbindung handeln muss.
Konkrete Hinweise sind bei Verdi allerdings spärlich. Der Vergiftungsprozess nimmt seinen Anfang im 2. Akt der Oper: Paolo Albiani, einst ein guter Freund und politischer Unterstützer Simon Boccanegras, ist tief gekränkt: Seit Boccanegra in Amelia seine verloren geglaubte Tochter wiedergefunden hat, verweigert er Paolo, sie zu heiraten. Paolo hat sie deshalb entführt, wird aber entlarvt und vom Dogen gezwungen, sich selbst zu verdammen. Um sich zu rächen, hat er sich nun in den Dogenpalast geschlichen und schüttet ihm mit den Worten «Hiermit bereite ich dir einen langen, qualvollen Todeskampf» heimlich den Inhalt eines Fläschchens ins Trinkglas. Simon Boccanegra nimmt das Gift wenig später fast beiläufig zu sich. Nur seine Bemerkung «Sogar das Quellwasser schmeckt bitter auf den Lippen des Herrschenden» verrät, dass soeben ein schleichender Prozess eingesetzt hat, der unausweichlich zum Tod führen wird. Die ersten Anzeichen der Vergiftung äussern sich als Müdigkeit. Der Doge schläft ein, ist ansonsten aber noch nicht stark beeinträchtigt. Bei seinem nächsten und letzten Auftritt im 3. Akt erscheint Simon Boccanegra jedoch deutlich geschwächt. Das Gift wirkt also, wie Louis Lewin es für Arsen beschreibt, «nicht jäh», sondern einer Krankheit täuschend ähnlich.
Die realistische Schilderung einer von Arsen ausgelösten Vergiftung findet sich bei Verdi nicht: Der Musikdramatiker interessiert sich weniger für medizinische Details als für die Bühnenwirksamkeit eines schleichenden Todes: So versöhnt sich Simon Boccanegra in seinen letzten Lebensmomenten noch mit seinem politischen Erzfeind Jacopo Fiesco. Verdi wünschte sich für diese Szene eine konsequent erlöschende Lichtdramaturgie, «bis beim Tod des Dogen alles in tiefem Dunkel liegt». Neben der ergreifend gestalteten Todesszene Boccanegras sind in Verdis Partitur aber auch kleine Details zusammenhangsreich gestaltet: Ein wiederkehrendes Giftmotiv findet sich, wie der Verdi-Biograf Julian Budden beschreibt, zum ersten Mal explizit in der Szene, in der Paolo Gift in das Trinkglas des Dogen schüttet – das chromatische absteigende Motiv stammt jedoch aus dem Ende des 1. Akts, wo Paolo sich auf Geheiss des Dogen selbst verdammt: «Der Fluch des Dogen wendet sich nun gegen ihn selbst zurück», kommentiert Budden. Während dem letzten Auftritt des Dogen erscheint dasselbe Motiv in variierter Form, nun schleppend auf- und absteigend: «Es erzählt nicht nur, dass Boccanegra krank ist, sondern auch warum.»
Ein deutlich realistischeres Bild einer Arsenvergiftung ist in literarischer Form übrigens im selben Jahr erschienen, in dem Verdis erste Fassung von Simon Boccanegra in Venedig uraufgeführt wurde: 1857 erschien in Paris der skandalumwitterte Roman Madame Bovary. Gustave Flaubert, Sohn eines Arztes, schildert die Vergiftungssymptome der Bovary, die sie sich in diesem Fall selbst zugeführt hat, in fast unerträglicher Akribie. Anders als Simon Boccanegra nimmt die unglückliche Emma Bovary das Arsen in Form eines Pulvers ein. Auch sie hat aber zunächst keine Schmerzen und schläft vorübergehend ein. Ausserdem erinnert ein kleines Detail an die Worte des genuesischen Dogen im Moment seiner Vergiftung: Als sie wieder aufwacht, fühlt Emma Bovary einen «bitteren Geschmack im Mund». Ihren Todeskampf hat Flaubert, anders als Verdi, unerbittlich und grausam geschildert: «Heftiges Zittern durchbebte ihre Schultern, und sie wurde bleicher als das Laken, in das sich ihre steifen Finger krallten. Ihr unregelmässiger Puls war kaum noch zu fühlen.»
Als der eilig geöffnete Abschiedsbrief der Bovary erkennen lässt, dass sie sich mit Arsen vergiftet hat, erscheint im Text ein beachtenswertes Detail, und zwar schlägt Monsieur Homais, der Pharmazeut, vor, «es müsste eine Analyse gemacht werden». Eine Analyse, das heisst Arsen im Körper eines Menschen nachzuweisen, war 1857 aber noch ein Novum. Erst 1836 nämlich hatte der britische Chemiker James Marsh eine Methode entdeckt, mit der sich Arsen sicher nachweisen lässt. Und das wiederum erklärt, warum Arsen über Jahrhunderte hinweg das bevorzugte Mordgift war...
In der Folge dieser sogenannten Marshschen Probe kam Arsen als Mordwaffe allmählich aus der Mode. Nicht jedoch der Giftanschlag, wie es auch der Fall um Nawalny jüngst wieder gezeigt hat. Das in Russland entwickelte Nervengift Nowitschok – übersetzt: «Neuling» – kann, wie Nawalny erzählt, heute von «vielleicht nur siebzehn» hochspezialisierten Labors nachgewiesen werden. Und seine Folgen sind grausam; Nawalny berichtet von schockierenden körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. «Konventionelle Waffen», sagt er, «können benutzt werden, um Menschen zu töten, aber auch um sie zu beschützen; diese Substanzen sind nur dazu bestimmt, Menschen einen schmerzvollen Tod sterben zu lassen – sie sind ein Ding aus der Hölle».
Ein Essay von Fabio Dietsche
Illustration: Alice Kolb
Fabio
Luisi
im Gespräch über Giuseppe Verdis «Simon Boccanegra», seine letzte Premiere als Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich.
Zum Podcast
Dramaturgie
der
Brechstange
der
Brechstange
Eine geniale Stelle in Giuseppe Verdis «Simon Boccanegra» Lesen
Anagnorisis nennt die Fachliteratur jene dramatische Standard-Situation, wo sich zwei Menschen nach langer Trennung überraschend wiederfinden und erkennen. Situationen dieses Typs finden sich seit der Antike in zahlreichen Dramen, und natürlich hat sich auch die Oper die emotionale Wirkung solcher Szenen nicht entgehen lassen. Ein besonders ergreifendes Beispiel findet sich im ersten Akt von Giuseppe Verdis Simon Boccanegra. Der Doge von Genua will Amelia Grimaldi mit seinem Günstling Paolo verheiraten. Als er ihr diesen Plan offenbart, stellt sich heraus, dass die vermeintliche Amelia seine seit mehr als 20 Jahren verschollen geglaubte Tochter Maria ist.
Wenn schon nach der Uraufführung der ersten Fassung von 1857 Stimmen laut wurden, die den «krausen» Handlungsaufbau der Oper bemängelten, der allen Regeln der klassischen Dramaturgie Hohn spricht, war sicher auch diese Szene gemeint, gegen die man durchaus vorbringen kann, dass sie wie mit der Brechstange in das Stück gehievt wirkt, weil sie nicht ausreichend vorbereitet ist und überdies nach der Regel in der Mitte des 2. Akts und nicht im ersten stehen müsste. Solche, zweifellos gut und richtig begründeten Einwände liessen sich noch lange fortsetzen. Und sicher spielten sie eine Rolle für Verdis Entschluss, das Libretto der Oper für die Wiederaufführung von 1881 durch Arrigo Boito, der zu dieser Zeit schon am Otello arbeitete, einer gründlichen Überarbeitung unterziehen zu lassen. Boitos Bestreben, die Handlung «logischer» aufzubauen und die scheinbare Sorglosigkeit der Dramaturgie zu steuern, waren freilich Grenzen gesetzt. Und das war vielleicht gut so, denn all die zweifellos gut und richtig begründeten Einwände werden durch die emotionale Wucht der Oper zunichte.
Und wie schon eine knappe Analyse dieser Szene zeigt, löst sich auch der oft erhobene Vorwurf der mangelnden dramaturgischen Sorgfalt sofort in Luft auf, wenn man die musikalische Gestaltung in die Betrachtung einbezieht. Wer sich dem erschütternden Sog dieser Szene aussetzt: vom Anfang mit der scheinbar harmlosen Konversation in B-Dur über den Moment der ersten Enthüllung («Ich bin keine Grimaldi»), der eine erste Unterbrechung setzt, durch die g-Moll-Passage der Erzählung über die Kindheit der Verschollenen mit der ergreifenden so überaus zärtlichen Wendung nach G-Dur, wenn vom Tod der Pflegemutter die Rede ist, über die anrührende Kantilene des Vaters, der seine Hoffnung kaum zu denken wagt, über die harmonisch unruhige Passage in stetig steigendem Tempo, die die Spannung ins Unerträgliche steigert, bis zur Explosion des vollen Orchesters in einem einzigen blendend hellen C-Dur-Akkord, der den Moment der Erkenntnis, des höchsten Glücks und des tiefsten Schreckens, markiert – wer sich dem aussetzt, wer diese Musik durch sich hindurch gehen lässt – nicht nur durch seinen Verstand, sondern auch durch seinen Körper – der wird keine erbsenzählerischen Einwände mehr erheben und gern zugestehen, dass es einfach falsch ist, ein Kunstwerk an Kriterien zu messen, denen es nicht gehorchen will.
Verdis Dramaturgie liegt wenig am Zusammenhang, um so mehr an der genauen Ausarbeitung der einzelnen Situationen. In ihnen verwirklicht sich das Schicksal der Figuren, ihnen gehört die ganze Liebe und Sorgfalt des Komponisten. Da es um die starke emotionale Wirkung der einzelnen Momente geht, die etwas darüber sagen, was es heisst, in dieser Welt Mensch zu sein, kann dem Zusammenhang geringere Bedeutung beigemessen werden, wie es bei einer Juwelenkette auf die Edelsteine ankommt, nicht auf die Schnur, die sie zusammenhält.
Werner Hintze
Ein Herrscher, der
die Macht nicht will
die Macht nicht will
Der gefeierte deutsche Bariton Christian Gerhaher gibt in Zürich sein Rollendebüt als Simon Boccanegra, und wie in seinen Liederabenden schaut er auch dieser Verdi-Figur ganz tief in die Seele. Ein Gespräch über die vielen Facetten eines scheiternden RegentenLesen
Christian, wer ist dieser Simon Boccanegra, den du in Verdis Oper darstellst?
Verdi zeigt ihn in einer Handlungskonstruktion, die ich hochinteressant finde und die Seltenheitswert in der Opernliteratur besitzt. Man lernt Simon Boccanegra nämlich in einem Prolog kennen, in dem er als junger, kraftvoller Typ auftritt. Ein Held, der sich in Seeschlachten ausgezeichnet hat und – nach dem politischen Kalkül seines machthungrigen Ratgebers Paolo – der Doge von Genua werden soll. Das wird er auch am Ende des Prologs. Aber dann kommt der erste Akt, der spielt 25 Jahre später, und Simon Boccanegra ist ein völlig anderer Mensch. Das finde ich dramaturgisch grossartig: In einem prägnanten Prolog wird eine Figur angelegt und vorgestellt, die später so gar nicht mehr vorkommt.
Der Zeitsprung von 25 Jahren markiert einen Bruch in der Figur?
Genau. Der junge Simon will im Prolog überhaupt nicht Doge werden, die Macht interessiert ihn nicht. Aber er hat eine nicht standesgemässe Liebesbeziehung mit Maria, der Tochter des Patriziers Fiesco, aus der bereits ein Kind, eine Tochter, hervorgegangen ist. Sein Ratgeber Paolo führt ihm vor Augen, dass er diese Beziehung als Doge mit dem Ansehen, das das Amt mit sich bringt, legitimieren kann. Das ausschliesslich ist der Grund, warum Simon sich für die Dogenwahl zur Verfügung stellt. Kurz bevor er tatsächlich zum Dogen ausgerufen wird, erfährt er dann aber, dass seine Maria gestorben ist. Das heisst, es gibt für ihn keinen Grund mehr, Doge zu werden. Er verbindet keinerlei Ziele mit dieser Regentschaft. Er tritt das Amt aber trotzdem an und regiert während dieser 25 Jahre, die in der Oper nicht vorkommen. Was werden das für lange Jahre der Regentschaft gewesen sein? Ich stelle mir vor, dass er seinen Dienst als Doge ohne inneres Wollen im Hinblick auf Macht-Eitelkeiten und Selbstverwirklichung, auch ohne persönliche Liebe und Begehren vollkommen vernunftgesteuert und dennoch mit erheblichem Ethos versehen hat.
Es ist ja ein typischer Verdi-Moment, wenn im Prolog die beiden ambivalenten Informationen zusammenschiessen und Simone fast zeitgleich vom Tod der Geliebten und dem politischen Wahltriumph erfährt. Was geht da in seinem Kopf vor?
Ich weiss gar nicht, ob es wichtig ist, was er denkt. Das Entscheidende ist, dass in dem Moment seine ganze Lebenskonstruktion zusammenbricht. Alles ist vorbei. Seine Liebe ist tot. Die Zukunftspläne sind dahin. Ihm bleibt die Macht eines Amts, das er nicht will. In unserer Inszenierung zeigt Andreas Homoki das als einen Moment grosser persönlicher Bedrängnis. «Via fantasmi, via!» (Weg mit euch, Gespenster! Weg!) singt er an der Stelle.
Verdi entwirft also die Figur eines Herrschers, der ein völlig selbstentfremdetes Verhältnis zur Macht hat.
Das klingt jetzt ein bisschen negativ. Ich würde eher so sagen: Es ist ein Verhältnis zur Macht, das weniger durch persönliche Beweggründe motiviert, als eher von kühler, aber hingebungsvoller Rationalität geprägt ist.
Woraus leitest du seine Rationalität ab?
Er war wahrscheinlich impulsiv, stürmisch und gedankenlos, als er sich in diese problematische Liebe gestürzt hat, wie man halt ist, wenn man jung ist. Und er hat wohl auch einen Riesenfehler gemacht, sich der Liebe einfach so hinzugeben, ohne weiter zu denken, zumal er auch noch ein Kind mit Maria gezeugt hat. Marias Vater Fiesco wird ja oft als böse dargestellt. Aber ich kann ihn verstehen. An seiner Stelle wäre ich wahrscheinlich auch sauer über eine schwangere Tochter in einer solchen Beziehung. Und plötzlich ist diese ganz Liebe nur noch Geschichte, es gibt nur noch die Pflichten des Dogenamts. Was bleibt einem da anderes als der Verstand?
Simon Boccanegra ist einer, der gesellschaftlich von unten kommt. Er ist Seefahrer, kein Patrizier. Emporkömmlinge haben ja eigentlich ein sehr libidinöses Verhältnis zur Macht. Sie geniessen es, wenn sie oben ankommen.
Aufstiegsehrgeiz kann ich bei Simon als Triebfeder überhaupt nicht erkennen. Es ist schon erstaunlich, dass er sich als Herrscher so lange an der Macht hält, obwohl ihn kein Ehrgeiz treibt. Ich erkenne in der Figur nicht nur einen Realpolitiker, sondern auch einen, der fast schon rührend selbstvergessen handelt und ganz bewusst Verzicht übt.
Welchen?
Verzicht auf Selbstverwirklichung. Doge zu werden, war ja nicht sein Projekt. Er wollte eine Liebe leben. Mir kommt seine Amtsausübung wie eine Art Bussübung für den Tod seiner Geliebten vor. Das hat fast etwas Mönchisches.
Was ist das für ein Modell von Macht, das Verdi mit dem Dogen Boccanegra entwirft?
Simon mag eine in sich gebrochene Figur sein, aber Verdi hat ihn als einen guten Machthaber angelegt, als einen, der für Ideale einsteht. Er setzt sich dafür ein, dass die Feindschaft zwischen Venedig und Genua ein Ende hat. Wird das zurückgewiesen, legt er ein schmetterndes Bekenntnis zur Einigung Italiens ab. Verdis Wunsch zur politischen Versöhnung, zur Einigung und zur Gleichbehandlung aller Menschen spricht sich in Simon aus. In meinen Augen steht er fast für eine Art Sozialdemokratie. Klar gibt es auch Dinge, die diesem Bild widersprechen. Offenbar hat er den Vater von Gabriele Adorno ins Gefängnis gesteckt und umgebracht. Aber vielleicht ist das gar kein Zeichen für Tyrannei, sondern eher für Staatsräson mit den Mitteln der damaligen Zeit.
Ist dieser Simon Boccanegra auch eine Einsamkeitsfigur? Hat er Züge von Shakespeares Lear? Verdi hat sich ja mit dem Gedanken getragen, Lear zu vertonen.
Einsam ist Simon schon. Aber anders als bei Lear ist das bei ihm selbstgewählt, als eine Art Selbstbestrafung.
Selbstbestrafung wofür?
Es gibt einen dunklen Punkt in seiner Biografie: Er war seiner Tochter, die er gemeinsam mit Maria hat, kein guter Vater. Wir erfahren, dass die Tochter in der Fremde von einer Amme grossgezogen wurde und Simon offenbar nur ab und zu bei ihr vorbeigeschaut hat. Er hat sich nicht gekümmert und sein Abenteurerleben weitergelebt. Das holt ihn ein. Dass seine verlorene Tochter plötzlich in seinem Leben auftaucht, ist nach dem Tod seiner Geliebten Maria der zweite tragische Schock. Das wirft ihn aus der Bahn.
Die Tochter heisst Amelia und wuchs als Findelkind in der adeligen Familie der Grimaldis auf. Sie liebt ausgerechnet Gabriele Adorno, einen erklärten Feind von Simon Boccanegra.
Wenn er Amelia als seine Tochter erkennt, sieht er sich plötzlich mit seinen persönlichen Versäumnissen konfrontiert, und die wiegen schwer. Ich glaube, dass sie als Schuld auf ihm lasten, und dass sie womöglich viel eher der Grund für sein Sterben-Müssen sind als die Tatsache, dass er den ehrgeizigen Paolo enttäuschen muss, der ihn daraufhin vergiftet.
Du siehst also in der Vergiftung Simons weniger die Gewalttat des Verschwörers Paolo, als viel eher eine innere Selbstvergiftung?
Vielleicht kommt da das eine zum anderen wie eine schicksalhafte Fügung. Simon geht im dritten Akt nicht nur an der Wirkung des Gifts zugrunde, sondern auch an seinem gescheiterten Privatleben. Andreas Homoki hat sich in seiner Inszenierung früh darauf festgelegt, dass der Moment von Simons Wiederbegegnung mit Amelia und das Erkennen der Familienbande kein ausschliesslich freudiger, sondern ein konfliktbeladener ist. Bei ihm bleiben die beiden auf Distanz, und das hat an dieser Stelle ausnahmsweise nichts mit den Corona-Abständen zu tun. Es steht einfach zu viel zwischen den beiden, Schuldbewusstsein und dennoch eine Erwartungshaltung auf seiner, Vorwürfe und dennoch eine unmittelbare Tochterliebe auf ihrer Seite. Das ist ein hochbelastetes Vater-Tochter-Verhältnis. Nicht der Machtkampf mit Paolo fällt Simon, sondern seine privaten Probleme.
Eine Figur voll von Schattierungen und grosser dramatischer Fallhöhe, die Verdi da komponiert hat.
Ja. Spannend ist auch, dass die Handlung mit so vielen Rückblenden arbeitet. Immer wieder wird von Dingen erzählt, die vergangen sind. Das Entscheidende ist bereits Geschichte. Die Handlung findet, obwohl sie hochdramatisch ist, grossenteils in den Köpfen der Protagonisten statt, abgesehen von den schier unentwirrbaren Tumulten. Sie vollzieht sich weniger als in vergleichbaren Tragödien zwischen den Menschen als in den Menschen selbst und da vor allem natürlich in der Hauptfigur. Diese Selbstbescheidung Simons ist einfach aussergewöhnlich. Ich kenne keinen echten und überzeugt handelnden Machthaber im Opernrepertoire, der so alles von sich wegschneidet. Das finde ich unglaublich interessant. Deshalb wollte ich diese Rolle machen.
Was heisst das für dein Singen und dein Spiel?
Das weiss ich noch nicht, das finden wir gerade in den Proben heraus. Die Partie ist von zwei Klangwelten geprägt, auf der einen Seite gibt es viele dramatische Ausbrüche – vor allem im Finale des ersten Akts, wenn Simon für seine politischen Ideale eintritt. Da ist die Kraft des jungen Boccanegra noch spürbar. Demgegenüber stehen die etwas verhaltenen Töne – in der skelettartigen Dramatik des zweiten Akt-Finales, vor allem aber im dritten Akt, wenn er vergiftet ist. Auch das Duett mit Amelia ist sehr lyrisch. Und was ich sehr an dieser Partie schätze, ist das Deklamatorische, das den Übergang zum späteren Verdi ja generell kennzeichnet.
Wie singt man das Vergiftetsein?
Diese langen Sterbeszenen machen mir eigentlich keinen Spass. Das gehört für mich zu den Punkten, bei denen ich immer so meine Vorbehalte gegen Verdi hatte. Das nimmt ja kein Ende bei Gilda in Rigoletto, bei Violetta in La traviata, bei Rodrigo in Don Carlo. Mich nervt das an sich erst einmal. Aber dann spüre ich natürlich auch, dass es wie eine Verkörperung der Todesproblematik ist, dass der Tod, der bei Verdi eine zentrale Rolle spielt, in langen Szenen reflektierend beleuchtet wird. So gehe ich auch bei Simon an den dritten Akt heran. Ich versuche, mich nicht einen ganzen Akt lang siechend dahinzuschleppen. Das Sterben wird nicht zelebriert, sondern beleuchtet – so hat es Andreas auch szenisch angelegt. Simon geht am Ende ab, bevor er laut Partitur stirbt. Um zu vermeiden, dass die Sterbeszenen sentimental werden, kann man szenisch versuchen, eher nüchtern in den Gesten zu bleiben, und auch musikalisch finde ich es sinnvoll, etwa dem Schluss-Ensemble im dritten Akt eher sachlich zu begegnen und es auf keinen Fall mit Schmalz zu überziehen. Ich habe ja viel Schubert gesungen, da finde ich eine klangliche Sachlichkeit auch die beste Herangehensweise. Ich habe von Schubert nicht nur Lieder, sondern auch die Messen und beispielweise seine Oper Alfonso und Estrella gesungen. Und die kam mir damals schon in vielen Passagen wie früher Verdi vor. Hier wie da gibt es diese Kombination von Leichtigkeit und Höhe bei den Baritonen, die grausam schwer zu singen ist. Und dann gibt es diese wunderbar schwebenden Ensembles: Im Schluss-Quartett in Simon Boccanegra spüre ich auch wieder sehr stark diese Nähe zu Schubert. Das Quartett hat auch so eine ungebundene, abhebende Qualität. Und bei manchen melodiösen Einfällen denke ich oft: Das könnte auch ein Vorspiel für ein Schubert-Lied sein.
Nochmal zu den Sterbeszenen bei Verdi. Ich finde spannend an ihnen, dass sich da grosse innere Räume auftun, dass plötzlich ganz weit gedacht wird und sich Utopisches zeigt. Ist das bei Simon Boccanegra nicht auch so?
Doch. Der dritte Akt hat etwas von einem eschatologischen Gebilde, zumindest ab dem Moment, in dem Simon sich unerwartet mit Fiesco versöhnt. Diese Versöhnung zwischen Simon und Fiesco, bei der das Gute nochmals – unter allerdings sehr schwarzen Fahnen – siegt, finde ich hinreissend. Ob man den Schluss allerdings so positiv sehen kann, wie du ihn beschreibst, weiss ich nicht. Ich vernehme da schon viel Düsternis. Es stirbt halt einer, mit Aus- und Rückblick auf die letzten Dinge.
Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Verdi allgemein? Viele Partien hast du noch nicht gesungen, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich bin Sänger geworden wegen des Lied-Gesangs, wegen des deutschsprachigen zumal, und da liegt Verdi stilistisch doch ziemlich weit weg. Ich kann ja nicht einfach an ein italienisches Opernhaus gehen und sagen: Ich bin Schubert-Sänger, lasst mich doch mal den Nabucco singen. Nein, ich bin froh für das, was ich als Deutscher überhaupt im Verdi-Repertoire singen darf. Bisher habe ich nur den Posa in Don Carlo gemacht.
Simon Boccanegra ist deine zweite Verdi-Rolle überhaupt?
Naja, ich habe bisher auch nur zwei Wagner-Rollen gesungen. Ich muss ja nicht alles in der Oper singen, denn ich bin vor allem im Konzert zu Hause.
Aber du machst jetzt keinen Bogen um Verdi?
Ich wäre wegen Verdi nicht Sänger geworden. Der Wunsch, Verdi-Sänger zu werden, war in mir nicht angelegt. Aber ich lerne diese ganz besondere Welt ja jetzt erneut kennen – und schätze sie wahnsinnig. Wie könnte man das auch nicht, wenn man sich damit beschäftigt. Mir war bei Verdi früher immer ein Rätsel, was die Musik im Vergleich zum Inhalt eigentlich aussagen soll. Ich spüre da eine grosse Diskrepanz zwischen dem Darstellenden und dem Dargestellten, denn Verdis Musik erfüllt keine für mich unmittelbar ersichtliche Abbildfunktion, es gibt in ihr oft nur eine wenig augenfällige klanglich semantische Entsprechung zu der in der Handlung propagierten Welt, wenn es sowas überhaupt gibt. Das ist bei Wagner in meiner Wahrnehmung anders. Da gibt es eine inhaltlich-klangliche Homogenität, die vielleicht schneller einleuchtet.
Aber das ist ja gerade das Spannende an Verdi. Dass es ihm nicht darum ging, einen Stoff naturalistisch auszupinseln, sondern er sich immer für die theatralische Situation, den starken szenischen Moment interessiert hat.
Schon. Aber nicht unmittelbar, sondern übersetzt, und das immer in einer sehr typischen Klangsprachlichkeit. Jetzt, wo ich es singen darf, denke ich mir allerdings: Ist doch völlig egal. Es macht Spass. Ich finde es grossartig, das machen zu können. Verdi-Partien interessieren mich auch wegen der stimmlich-physiologischen Herausforderungen, an die seine Musik geknüpft sind – wie sie sich mir als Neuling eben darstellen. Man kann da nicht einfach nur herumbrüllen. Wenn du Verdi nicht wirklich schön singst, wenn du zu sehr stemmst oder zu eng in die Maske singst, ist die Musik in ihrer Substanz sehr schnell gefährdet. Man muss diesen offenen Klang produzieren, rund und gross. Je ungepresster die Stimme fliessen kann, desto sinnfälliger werden die Figuren. Das finde ich bei Wagner keine so stark ausgeprägteGefahr.
Gibt’s noch andere Verdi-Partien, die du gerne machen würdest?
Es ist nichts geplant. Aber interessieren würden mich schon noch ein paar Sachen, Rigoletto zum Beispiel oder der Renato in Un ballo in maschera. Wie realistisch das dann am Ende wirklich ist, muss man sehen.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Jennifer
Rowley
Rowley
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Aus den Vereinigten Staaten, wo ich im sonnigen Florida lebe! Simon Boccanegra ist meine erste Produktion nach einer endlos langen Liste von coronabedingten Absagen. Im Sommer habe ich viele Online-Meisterkurse für junge KünstlerInnen auf der ganzen Welt abgehalten. Mit der Fort Worth Opera haben wir eine virtuelle «Artist Residence» auf die Beine gestellt mit Meisterkursen, die grosse Persönlichkeiten aus der Oper geleitet haben. Danach habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der junge KünstlerInnen auf ihre – ebenfalls virtuellen – Vorsingen vorbereiten sollte. Zusätzlich habe ich beim International Summer Opera Festival in Morelia in Mexiko und an meiner ehemaligen Universität, der Baldwin Wallace Universität, unterrichtet. Sommer und Herbst waren also ganz dem Unterrichten der nächsten Generation von Sängern gewidmet. Das war für mich sehr beglückend.
Was wollten Sie als Kind gerne werden?
Ich wollte unbedingt Köchin werden. Als Teenager habe ich für meine Familie gekocht – meine Spezialitäten waren Omelettes und Crêpes. Jetzt ist das Kochen mein tägliches Hobby geworden – es ist sehr entspannend für mich und hat eine therapeutische Wirkung. Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren und neue zu erfinden. Ich dachte immer, ich würde eine Kochlehre machen, doch dann stellte sich heraus, dass Musik und Oper meine wahre Leidenschaft sind.
Worauf freuen Sie sich in der Neuproduktion Simon Boccanegra besonders?
Es ist eines der herausforderndsten Werke, die Verdi je geschrieben hat – und eine seiner schönsten Opern. Ich freue mich, diese fantastische Musik auf der Bühne zum Leben zu erwecken. Und bei dieser Gelegenheit wieder mit Fabio Luisi zusammenzuarbeiten. Er ist mein Lieblingsdirigent. Er haucht den Stücken so viel Leben und Kreativität ein. Wir haben zuletzt in Florenz Mahlers «Sinfonie der Tausend» gemeinsam aufgeführt, und ich bin überglücklich, erneut mit ihm zu musizieren.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Während meines Studiums nahm ich an einem Austauschprogramm des Teatro Colón teil und kam so nach Buenos Aires. Mein Gastvater nahm mich am zweiten Abend in die Traviata mit. Ich hatte noch nie zuvor eine komplette Oper gesehen, und sie versetzte mich regelrecht in Trance. Es war eine unkonventionelle Aufführung in einer grossen Sportarena mit Kameramännern auf der Bühne, die ein Video auf gigantische Bildschirme projizierten. Während der ganzen Vorstellung sass ich gebannt auf der Stuhlkante. Ich war so berührt, dass ich zu meinem Gastvater sagte: «Das ist es, was ich tun muss!» Am nächsten Tag ging ich in die Bibliothek des Teatro Colón und lieh mir die Noten der Traviata aus.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Ich bin besessen von Lin-Manuel Mirandas Hamilton! Ich höre mir das Musical immer und immer wieder an. Ich liebe auch den Film, der im vergangenen Sommer herausgekommen ist, und könnte ihn mir ständig ansehen. Die Mischung der musikalischen Stile fasziniert mich sehr.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Der Lieblingsort meines Hauses ist der Swimmingpool. Das ist nun eher ein Outdoor-Objekt, aber ich vermisse ihn wirklich, wenn ich nicht zuhause bin. Wir leben im schönen Fort Myers in Florida, wo der Pool im Gegensatz zum Rest des Landes absolut notwendig ist. Mein Mann und ich haben dort draussen einen Fernseher aufgestellt und schauen während des Schwimmens Football – der Fernseher ist dann wohl eher ein überflüssiger Gegenstand?
Mit welcher Künstlerin würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Am liebsten mit der grossen türkischen Sopranistin Leyla Gencer, um sie über unser gemeinsames Fach auszufragen. Sie ist mein Idol. Immer wenn ich eine neue Rolle lerne, lasse ich mich von ihren Aufnahmen inspirieren. Ihre Einspielung von Simon Boccanegra mit Tito Gobbi ist für mich eine absolute Referenzaufnahme. Ihre Stimme war pure Magie – kräftig und durchdringend, wenn es sein musste, dann wieder sanft und delikat und mit dem staunenswertesten Pianissimo. Gerne möchte ich ihr Geheimnis hinter dieser perfekten Technik erfahren, das Geheimnis ihres Atems bei ihrem unglaublichen Legato und ihrer durchdringenden Spitzentöne, aber auch das Geheimnis ihrer leidenschaftlichen und tiefgründigen Rolleninterpretationen.
Was können Sie überhaupt nicht?
Ich kann absolut nicht zeichnen oder malen, liebe es aber, in Museen zu gehen. Ich kann ausserdem keinen Knopf annähen und bewundere deshalb umso mehr diejenigen, die Kostüme oder Mode kreieren können.
Haben Sie einen musikalischen Traum, der wohl nie in Erfüllung gehen wird?
Die Lucia di Lammermoor zu singen! Es ist die Rolle, von der ich immer geträumt habe. Ich begann zwar als Koloratursopran und sang am Konservatorium auch die Königin der Nacht, die Zerbinetta und sogar die Lucia – ich liebte diese Rolle, diese Musik und den Charakter so sehr – denn wer will nicht einmal die Wahnsinnsszene singen? Aber die Rolle der Lucia bleibt ein Traum, den ich nur unter der Dusche verwirkliche.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Weil wir auf der ganzen Welt Liebe, Kunst und Kultur kennen, sogar in Zeiten der Pandemie. Die Kreativität der Theater und der Künstler, die jetzt trotz allem weiterarbeiten, ist bewundernswert und motiviert mich. Die Unterstützung unseres Publikums, weiter Kunst zu machen, wenn auch in einem virtuellen Raum, zeigt doch, wie tief die Kultur in unserer Welt verankert ist. Das macht das Leben wirklich schön!
Die Sopranistin Jennifer Rowley stammt aus den USA. Als Amelia Grimaldi gibt sie ihr Debüt in Verdis «Simon Boccanegra» und am Opernhaus Zürich.