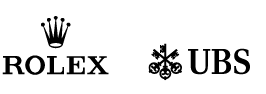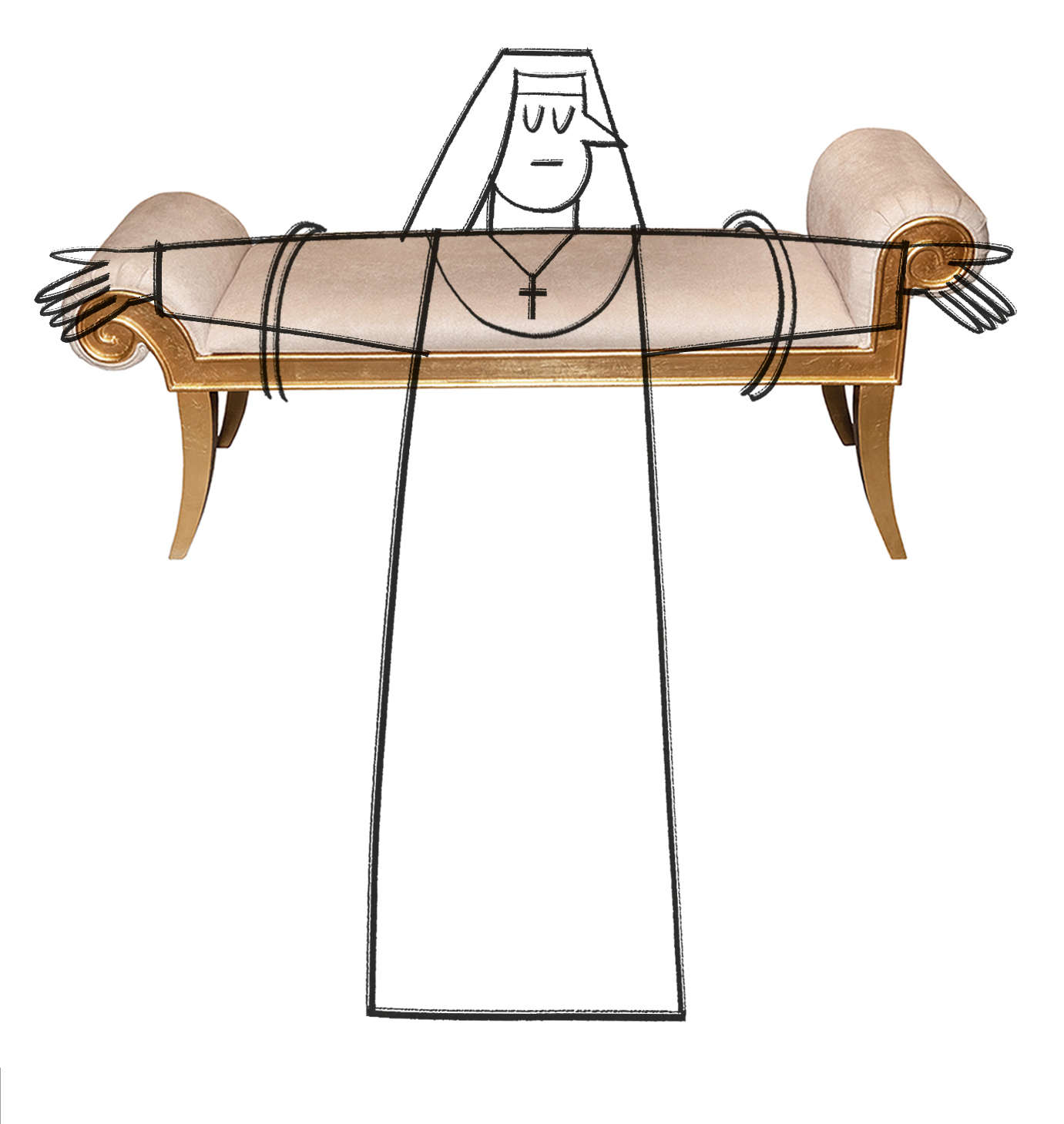Dialogues des Carmélites
Francis Poulenc (1899-1963)
Oper in drei Akten (zwölf Bildern)
Libretto vom Komponisten nach dem Drama von Georges Bernanos
In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 2 Std. 50 Min. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 10 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Die Einführungsmatinee findet am 30. Januar 2022 statt.
Unterstützt von 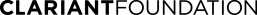
Gut zu wissen
Pressestimmen
«Was man hier erlebt, ist so erschütternd und existenziell, wie Musiktheater nur sein kann.»
Tages-Anzeiger vom 14. Februar 2022«Wenn man so genau arbeitet und das Ganze sängerisch auch so gut besetzen kann, wie es hier der Fall ist, ist es ein Gesamtkunstwerk, das dem Stück total angemessen ist.»
Deutschlandfunk vom 14. Februar 2022
Drei Fragen an Andreas Homoki

Herr Homoki, die Oper Dialogues des Carmélites von Francis Poulenc, die am 13. Februar am Opernhaus Premiere hat, gehört zu den selten gespielten Randwerken des Repertoires. Wie wichtig ist es, solche Stücke auf den Spielplan zu setzen?
Sehr wichtig, denn das sogenannte Randrepertoire ist voll von grossartigen Stücken, und die soll man natürlich auch spielen. Wir tun das, aber wir sind am Opernhaus Zürich auch in der glücklichen Situation, dass wir neun Opernpremieren pro Spielzeit herausbringen, so viele wie nur wenige andere Häuser. Deshalb fällt es uns leichter, auch ausgefallene Titel zu spielen. Bei einer so hohen Premierenfrequenz braucht man dieses Repertoire, um einen Spielplan interessant zu gestalten. Ich stelle immer wieder fest, dass man auf einen unglaublichen Reichtum an kaum gespielten Werken stösst, wenn man ein bisschen tiefer im Opernrepertoire gräbt. Natürlich sind Traviata und Don Giovanni tolle Opern, aber Juliette von Bohuslav Martinů oder Der feurige Engel von Sergej Prokofjew – um zwei der Titel zu nennen, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben – sind genauso spannend. Im Haus ist übrigens die Leidenschaft für unbekannte Werke oft viel grösser als bei den Standardwerken, die andauernd gespielt werden. Es befeuert, wenn man gemeinsam etwas Neues entdeckt und die Qualitäten einer Oper im Entstehungsprozess einer Inszenierung immer deutlicher zutage treten. Wir hoffen natürlich, dass sich diese Freude am Entdecken auch auf unser Publikum überträgt.
Für wie offen und abenteuerlustig halten Sie das Zürcher Publikum?
Ich erlebe es als sehr offen. Das gilt für neue Interpretationen bekannter Werke die grundsätzlich mit Neugier und einer positiven Haltung aufgenommen werden, und auch für unbekannte Stücke. Bei ihnen müssen wir natürlich Überzeugungsarbeit leisten, denn viele werden diese Oper des Franzosen Francis Poulenc, die 1957 uraufgeführt wurde, noch nicht kennen. Das Wichtigste dabei ist, dass das Publikum Vertrauen haben kann, dass die Stücke, die wir aussuchen, Substanz haben und in bestmöglicher Qualität auf die Bühne kommen. Und das schafft man nur, wenn man selbst an sie glaubt, sie ernst nimmt, erstklassig besetzt und in einer starken Inszenierung auf die Bühne bringt.
Wie überzeugt sind Sie von Dialogues des Carmélites, einer Oper, die in den für uns ja sehr fernen Sphären des klösterlichen Glaubens spielt?
Das ist ein tolles Stück. Man mag auf den ersten Blick vielleicht denken, so eine Geschichte über Nonnen sagt mir nichts. Aber dem Stoff wohnt grosse Relevanz und Allgemeingültigkeit inne. Er geht auf ein historisches Ereignis während der französischen Revolution zurück, als sechzehn Karmeliterinnen es vorzogen, hingerichtet zu werden, statt ihr Klosterleben aufzugeben. Da werden überzeitliche Fragen aufgeworfen: Woran glauben wir? Wofür sind wir bereit zu sterben? Wie gehen wir in einer existenziellen Situation mit unseren Ängsten um? Mein Eindruck aus den ersten Probenwochen ist: Das wird eine emotional ganz starke Produktion. Unsere Regisseurin Jetske Mijnssen schafft intensive Beziehungsspannungen zwischen den Figuren, die der Komponist mit einem faszinierenden psychischen Innenleben ausgestattet hat. Und wir haben eine hochkarätige Besetzung, etwa mit Olga Kulchynska in der Hauptrolle der Blanche, die sich tief in diese Figur hineindenkt, oder einer tollen Charakterdarstellerin wie Evelyn Herlitzius als Klosterpriorin Madame de Croissy. Ich freue mich sehr auf diese Premiere.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Interview

Die Ängste vor dem letzten Weg
Francis Poulencs Oper «Dialogues des Carmélites» erzählt von einer Nonnengemeinschaft, die es vorzieht, zum Schafott zu schreiten, statt ihr Klosterleben aufzugeben. Was hat uns diese Geschichte aus dem Kloster heute zu sagen? Sehr viel, finden die Regisseurin Jetske Mijnssen und der Dirigent Tito Ceccherini, die künstlerisch für die Neuproduktion der Poulenc-Oper verantwortlich sind.
Jetske Mijnssen und Tito Ceccherini, die Oper Dialogues des Carmélites von Francis Poulenc spielt hauptsächlich in einem Nonnenkloster, es geht um Märtyrertode. Eine richtige Liebesgeschichte gibt es nicht. Das hat mit der Lebensrealität der meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wenig zu tun. Weshalb packt uns dieses Stück trotzdem?
Jetske Mijnssen: Es geht hier nicht nur um Karmeliterinnen, um Nonnen, sondern der Titel macht es deutlich: Im Zentrum steht der Dialog, das Gespräch, das für mich ein Gespräch ganz generell unter Frauen ist. Diese Nonnen sind keine anonyme Figuren, sondern von Poulenc ausserordentlich individuell und plastisch gezeichnet. Jede hat ihre ganz eigene Persönlichkeit und besondere Haltung. Wir erleben ihre Ängste und existenziellen Sorgen – als Zuschauerin gehe ich mit diesen Figuren mit. Im Zentrum steht die Hauptfigur Blanche, die mit ihrer Herkunft zu kämpfen hat: Sie ist in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen. Das macht sie für uns zu einer nachvollziehbaren, modernen Figur.
Tito Ceccherini: Vielleicht bin ich jetzt zu dialektisch, aber ich finde, gerade weil es nicht um eine Liebesgeschichte geht, werden endlich einmal Dinge verhandelt, die alle betreffen. Natürlich versteht jeder, was Liebe bedeutet, wir alle sind mit den damit verbundenen Emotionen wie Hass, Zweifel oder Eifersucht vertraut. Aber das Leben ist selten so einseitig. Wir stellen uns doch ständig Fragen, Fragen wie: Was möchte ich im Leben machen? Schaffe ich das auch? Geschieht das genau so, wie ich mir das vorstelle?
Diese Fragen stellt sich Blanche, mit der wir durchs Stück gehen.
Tito Ceccherini: Ja. Sie ist eine Suchende, die ihren Weg geht, ja gehen muss. Sie kann in dieser dysfunktionalen Familie nicht bleiben. Die Rollen haben sich völlig verkehrt: Der Bruder bemuttert Blanche und bedrängt sie mit überzärtlicher Fürsorge. Doch wenn es darum geht, den adeligen, von der Französischen Revolution bedrohten Vater zu beschützen, reist der Bruder ab und Blanche, die gerade ins Kloster eingetreten ist, soll sich um ihn kümmern. Das sind menschliche Verhaltensweisen, die durchaus mit uns heute zu tun haben.
Jetske Mijnssen: Du sprichst den Vater an. Der Vater verdrängt alle Probleme und bemerkt nicht, was mit Blanche los ist. Wenn der jakobinische Terror ausbricht, kümmert es ihn nicht, dass er als Adliger in Gefahr ist. Er glaubt, ihm könne nichts passieren. Aber dann geht alles schief.
Das kann man ja generell über diese Oper sagen: Nichts geschieht so, wie vorgesehen. Alle planen etwas für sich, doch es kommt ganz anders …
Tito Ceccherini: Die alte, schwerkranke Priorin zum Beispiel sollte in den Augen ihrer Mitschwestern einen leichten Tod sterben. Sie hat immer Gott gedient und gebetet, doch im Angesicht des Todes ist sie vollkommen verzweifelt und stirbt qualvoll. Eine andere einflussreiche Nonne im Kloster, die Lehrerin der Novizinnen, Mère Marie, die der Gemeinschaft das Martyriumsgelübde abringt, ist am Ende die Einzige, die nicht aufs Schafott geht. Und was Blanche betrifft: Wir lernen sie als eine Figur kennen, die primär von ihren Ängsten geleitet wird. Am Ende überrascht sie uns aber, wenn sie mit ihren Mitschwestern freiwillig in den Tod geht. Es ist eine wirklich komplexe Oper …
Am Anfang dieser Geschichte steht ein Familientrauma. Welches ist das?
Jetske Mijnssen: Als Blanche zur Welt kam, ist ihre Mutter bei der Geburt gestorben. Das macht der Vater der Tochter unausgesprochen zum Vorwurf. Es ist ein Trauma, das immer wieder in ihm hochkommt. Poulenc deutet Ungesagtes zwischen den Figuren ja generell immer ganz fein an, man spürt ständig diese unterschwelligen Spannungen. Es gibt einen bemerkenswerten Moment am Ende der Familienszene: Blanche erklärt dem Vater, dass sie ins Kloster, in den Karmel eintreten will. In diesem Augenblick kippt etwas im Vater und man merkt, dass er seine Tochter zum ersten Mal als eigenständigen Menschen wahrnimmt. Das Tragische ist: In dem Moment entgleitet sie ihm bereits.
Tito Ceccherini: «Au Carmel!» – das ist einer der ganz wenigen Takte in dieser Oper, wo zwei Figuren gleichzeitig singen, Vater und Tochter. Ensembles gibt es in Carmélites eigentlich nur in den mehrstimmigen, lateinisch gesungenen Gebeten, die sich immer wie Inseln in dieser Oper ausnehmen. Daher ist dieser Moment sehr auffällig. Der Vater singt eigentlich nur in Rezitativen, und selbst wenn er Legato singt, ist das immer noch ein Rezitativ. Er spricht, spricht, spricht…
Ist diese Textlastigkeit ein Problem? Das Libretto basiert ja auf einem Bühnen stück von Georges Bernanos, der wiederum als Vorlage die Novelle Die Letzte am Schafott von Gertrud von Le Fort verwendet hat.
Tito Ceccherini: Ich lerne den Wert des Textes von Bernanos immer mehr zu schätzen. Er ist aussergewöhnlich nuancenreich, überaus präzise in den Emotionen und den Gedanken.
Jetske Mijnssen: Genau. Der Dialog ist trotz des philosophischen Tones, der immer wieder angeschlagen wird, so menschlich. Die Figuren werden in keinem Moment zu Karikaturen.
Diese Figuren haben ja tatsächlich gelebt: Es sind die Karmeliterinnen von Compiègne, die während der Französischen Revolution wegen ihres Glaubens hingerichtet wurden. Nur Blanche ist eine freie Erfindung von Gertrud von Le Fort. Poulenc hat sich sehr mit dieser Figur identifiziert.
Jetske Mijnssen: An ihr wird das Thema der Angst, das zentral für diese Oper ist, in ihrer vielfältigsten Erscheinungsform aufgezeigt. Blanche leidet unter einer extremen Lebensangst, unter ständigen Panikattacken. Sie ist immer die Aussenseiterin, zuhause in der Familie, aber auch im Kloster. Sie erwartet vom Kloster im Grunde die Erlösung von ihrer Angst, Sicherheit und Geborgenheit. Aber bereits bei ihrem Eintrittsgespräch nimmt ihr die alte Priorin alle Illusionen. Wie das im Leben eben so ist: Man geht auf eine Reise, um vor seinen Problemen zu fliehen, kommt nach Hause, und die Probleme liegen noch immer auf dem Tisch.
Tito Ceccherini: Ich sehe Blanche ein wenig als Traumwandlerin. Ihr Instinkt führt sie auf diesen Weg…
Jetske Mijnssen: Dabei trifft sie auf Frauen, die ihren Weg sehr prägen. Die alte Priorin ruft Blanche kurz vor ihrem Tod als Einzige zu sich. Sie will, dass Blanche es besser macht als sie selbst. Durch ihren furchtbaren Tod und ihre Angst vor dem Tod nimmt sie es gewissermassen auf sich, dass Blanche am Ende ohne Angst und Schmerzen sterben kann. Dann gibt es diese Begegnungen von Blanche mit Sœur Constance, die in ihrer Frische und Leichtigkeit eine sehr anziehende Figur ist. Gleichzeitig hat Constance eine tiefe Reife, sie weiss über Leben und Tod Bescheid und hat vor nichts Angst. Constance lässt sich von Blanches Strenge und Härte ihr gegenüber nie abschrecken. Selbst wenn Blanche die Gemeinschaft plötzlich verlässt, hält Constance zu ihr.
Um auf den zentralen Aspekt der Angst zurückzukommen: Wie transportiert die Musik dieses Gefühl, diese permanente Spannung?
Tito Ceccherini: Da reicht eine überraschende, innerhalb von Poulencs musikalischer Sprache weniger selbstverständliche Dissonanz, um das anzudeuten. Plötzlich tauchen musikalische Schatten auf, die völlig quer zur vorgängig etablierten Musiksprache stehen: ganz andere Akkorde, oder Töne in anderen Registern, tiefe Bässe mit Pauken zum Beispiel. Das ist überraschend in Poulencs tonaler, mit klassischen Mitteln gestalteten Sprache.
Poulenc gliedert die Oper in dreimal vier Bilder, also insgesamt 12 Bilder, die jeweils durch musikalische Zwischenspiele voneinander abgetrennt werden. Wie schafft er diesen Bogen, ohne dass das Werk in Einzelteile zerfällt?
Jetske Mijnssen: Die Dramaturgie ist wirklich bemerkenswert. Auffällig ist, dass die Szenen immer bereits am Laufen sind, wenn sich der Vorhang erneut hebt. Sie sind nie die Fortsetzung der vorherigen Szene. Manchmal kann man sich, sobald der Vorhang zugeht, sogar vorstellen, dass die Szenen weiterlaufen. Das ist Suspense. Man merkt, dass Bernanos’ Stück ursprünglich ein Filmscript war.
Tito Ceccherini: In der Musik gibt es dieses fliessende, schreitende Tempo, das durch die ganze Oper geht und nie aufhört. Es mündet schliesslich in die letzte Szene: dem Schreiten zum Schafott.
Wie ist diese berühmte Schlussszene musikalisch gestaltet?
Tito Ceccherini: Im Grunde unterliegt ihr ein ganz einfaches musikalisches Konzept, aber die Elemente, die dazu kommen, wirken überraschend. Die schneidenden Guillotinenschläge erklingen zum Beispiel an völlig unerwarteten Stellen, in unregelmässigem Abstand. Auch die dynamischen Nuancen sind in dieser Szene nicht vorhersehbar. Natürlich beginnt die Szene leise, sie wird lauter und endet leise. Aber dazwischen gibt es überraschende, dynamische Stufen. Nach den vielen Dialogen gibt es hier keine Gespräche mehr, nur noch das Murmeln des Chores und den Hymnus «Salve Regina». Mit jedem Schlag erstirbt eine Stimme. Durch das Ende der Gespräche ist die Individualität der Schwestern ausgelöscht, das Ende des menschlichen Dialogs überhaupt.
Wie ergeht es dir mit der Schlussszene, Jetske? 16 Frauen sterben hintereinander auf dem Schafott, und wir müssen dabei zusehen …
Jetske Mijnssen: Ich bin jedes Mal entsetzt, wenn diese Szene kommt. Auch unseren Sängerinnen fällt es schwer, das zu singen und zu spielen. Der Gang zum Schafott wird radikal durchgeführt. Der grausame Tod von Madame de Croissy im ersten Teil der Oper ist eine Vorbereitung auf dieses Ende, doch sie stöhnt und schreit – das fehlt am Schluss, da schreit es in uns. Szenisch suche ich dafür natürlich alles andere als eine platt realistische oder gar blutrünstige Lösung, denn es geht ganz allgemein um das brutale Auslöschen von Individuen. Die Nonnen sterben zwar für ihren Glauben, aber dieser freiwillige Tod ist unter enormem Druck der revolutionären Kräfte zustande gekommen, durch äussere Gewalt. Und die Nonnen haben Angst! Das Martyriumsgelübde haben die Schwestern auch nur deshalb abgelegt, weil Mère Marie so radikal, fast ideologisch darauf beharrte.
Zum Zeitpunkt der Komposition war der Tod im Leben von Francis Poulenc allgegenwärtig. Er war während der Komposition der Carmélites in einer tiefen persönlichen Krise, litt unter Todesängsten und bildete sich eine Krankheit ein. Gestorben ist dann aber während der Fertigstellung der Partitur Poulencs ehemaliger Partner.
Jetske Mijnssen: Dass sich Poulenc in diesem Stück mit den letzten Dingen auseinandersetzt, ist klar. Die Dialoge sind fast immer ein Austausch über den Tod. «Gott, warum hast du mich verlassen?» – Das ist die zentrale Frage, die immer wieder im Stück auftaucht. Bei der sterbenden und Gott verfluchenden alten Priorin Madame de Croissy, aber auch bei Madame Lidoine, die in der Gefängnisszene die verängstigten Nonnen darauf hinweist, dass Jesus im Garten Gethsemane auch Angst hatte. Und Blanche nennt sich im Kloster Blanche de l’Agonie du Christ, also von Christi Todesangst – ein Name, den auch die alte Priorin trug. Poulenc verbindet seine Figuren mit unseren eigenen tiefen Fragen und Ängsten.
Wie empfindest du den Katholizismus in diesem Stück? Wie ist er dargestellt?
Jetske Mijnssen: Im Stück ist Religiosität spürbar, aber nicht explizit Katholizismus. Auch wenn Poulenc selbst bekennender Katholik war, waren ihm allzu strenge Glaubensvertreter suspekt, das weiss man. Er suchte immer das Lebendige. In Carmélites ist nichts manifest, sondern es wird gezweifelt und diskutiert.
Noch ein letztes Wort zu Poulenc als Komponisten, dessen musikalische Sprache für ein Werk der 1950erJahre überraschend tonal ist, vergleicht man sie mit anderen musikalischen Strömungen in dieser Zeit. Serialismus oder Zwölftonmusik interessierte Poulenc kaum. Dafür wird er im deutschsprachigen Raum gerne belächelt …
Tito Ceccherini: Ich bin ein Enthusiast der Neuen Musik, das muss ich vorausschicken. Aber ich habe in meinem Leben immer mehr Abstand von der Frage genommen, wie man sich legitimieren soll. Dass die Vier letzten Lieder von Richard Strauss oder sein Oboenkonzert zeitgleich wie die Erste Klaviersonate von Pierre Boulez entstanden sind, ist zwar erstaunlich, aber muss ich das auch bewerten? Es gibt so viele unterschiedliche Arten, neu zu sein, und das hat nicht unbedingt damit zu tun, ob man nun tonal oder atonal komponiert. Letztlich geht es darum, was und nicht wie man etwas mit seiner musikalischen Sprache erzählt. Auch wenn Poulencs Oper nichts mit der Darmstädter Schule zu tun hat, hätte sie kein Jahr früher komponiert werden können.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
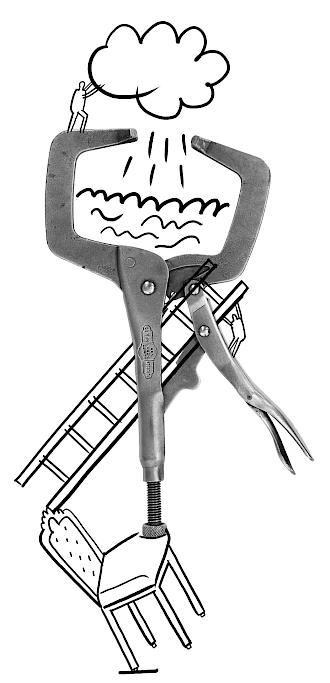
Altes Gemäuer, frisch gemalt
Wahrscheinlich haben Sie sich noch nie mit der Frage auseinandergesetzt, wie Sie etwas Neues möglichst einfach alt aussehen lassen können. Meistens ist es ja eher umgekehrt. Doch gerade unsere Bühnenbilder sollen oftmals nicht so aussehen, als wären sie soeben aus der Werkstatt gekommen, sondern so, als würden ihre Bewohner schon seit vielen Jahren in ihnen leben.
Im Bühnenbild zu Dialogues des Carmélites – ein altes Kloster, entworfen von Ben Baur – wohnen die Nonnen augenscheinlich schon seit Jahrhunderten und unterhalten das Kloster perfekt. Kein Staubkorn liegt herum, dennoch ist das Alter des Gemäuers offensichtlich: Die Wände scheinen im Laufe der Zeit immer wieder feucht geworden zu sein und haben Flecken, und die Farbe von Fenstern und Türen hat Risse. Flecken malen kann vermutlich jeder, aber rissige Farbe malen? Nach einem Besuch bei Christian Hoffmann, unserem Leiter der Theatermalerei, kann ich Ihnen das Rezept verraten, und Sie können damit einfach alles alt aussehen lassen:
Nehmen wir an, Sie wohnen in einem Märchenschloss. Nun zog es durch die Fenster immer fürchterlich, und Sie haben diese neu machen lassen. Von aussen ist der Anblick nun unerträglich: Alte Mauern, die mit verwunschenem Efeu bewachsen sind, in Kombination mit einer neuen Dreifachverglasung in weissen Kunststoffrahmen – das geht natürlich gar nicht! Grundieren Sie die Rahmen mit einer Kunststoffgrundierung aus dem Baumarkt, kaufen Sie auch noch 2K PU Pigmentlack in dunklem Braun (z.B. RAL 8017 Schokoladenbraun), die Farbe Hellelfenbein (RAL 1015) und Reisslack für lösungsmittelhaltige Farben. Dann lackieren Sie den Rahmen in Schokoladenbraun, möglichst unregelmässig – dies wird die Farbe der späteren Risse. Das lassen Sie trocknen. Mindestens 24 Stunden lang. Nun tragen Sie mit dem Pinsel fett das Hellelfenbein auf und lassen dieses nur antrocknen. Beim Testen mit der Fingerkuppe sollte der Lack nicht kleben bleiben. Nach 50 Minuten alle 10 Minuten testen. Wenn Sie lange warten, werden die Risse feiner, wenn Sie zu lange warten gibt es gar keine Risse… Nun tragen Sie auf die angetrocknete Farbe mit dem Pinsel gleichmässig den durchsichtigen Reisslack auf. Während des Trocknens des Reisslackes zieht dieser nach mehreren Stunden die darunterliegende Farbe zusammen und sorgt für grosse Risse im Hellelfenbein und das Schokoladenbraun kommt zum Vorschein. Lassen Sie das in der Nacht durchtrocknen und entfernen Sie dann die Reisslackschicht mit einem feuchten Schwamm. Sie haben ein «Craquelée», ein Rissnetz, erzeugt und Ihr Märchenschloss ist wieder makellos verwunschen.
Für das Kloster auf der Bühne konnten wir übrigens ohne lösungsmittelhaltige Farben arbeiten. Aber ich gehe davon aus, dass Sie nicht möchten, dass die Farbe Ihrer Fensterrahmen im Laufe der Jahre verwittert.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Interview

Olga, wir sprechen noch vor der ersten szenischen Probe über deine Rolle. Wie ergeht es dir in deinen Vorbereitungen mit Blanche?
Als ich das Libretto las, ergaben sich für mich so viele Fragen an das Stück und an Blanche! Wenn ich an einer Rolle arbeite, suche ich die Charakterzüge einer Figur auch immer in mir selbst. Doch in diesem Fall war das anders. Für mich ist Blanche ein grosses Mysterium und emotional noch nicht richtig greifbar. Bis jetzt empfinde ich sie als eine völlig wahnsinnige, verrückte Person. Noch immer suche ich die richtige psychologische Diagnose für sie, vielleicht ist sie bipolar. Auch musikalisch gesehen ist diese Rolle voller Kontraste. Manchmal ist Blanche sehr ruhig, fast apathisch, manchmal ist sie völlig überdreht, ja hysterisch. Ihr Ausser-Atem-Sein, ihre Zartheit und Ängstlichkeit sind deutlich in der Komposition verankert. Aber generell ist die Figur für mich zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Gestalt aus dem 18. Jahrhundert.
Hast du dich mit den historischen Quellen der Geschichte beschäftigt und die Novelle Die Letzte am Schafott von Gertrud von Le Fort, die die Basis für das Schauspiel von Georges Bernanos und der Oper von Poulenc war, gelesen?
Ja. Und ich habe nachgeforscht, wer diese Karmeliterinnen sind. Dieser Orden existiert heute ja noch immer. Ich habe mir diesbezüglich einige Dokumentarfilme angesehen: Der Karmeliterorden ist ein sehr verschlossener Orden, dem man sich kaum nähern kann. In den Interviews dieser BBC-Dokumentation ist mir aufgefallen, dass die Nonnen wie Blanche sprechen: geradezu wolkig und voller Ekstase und Verklärung. Sie benutzen grosse Begriffe wie «Opfer» oder «Leid» – aber ehrlich gesagt: Ich verstehe nicht, was sie damit meinen.
Hast du dennoch einige Seiten in Blanche entdeckt, die etwas mit dir zu tun haben?
Das Einzige, was ich bei Blanche nachvollziehen kann und das ja jeder kennt, ist das Gefühl der Angst. Doch auch da sind Blanches Ängste wiederum so umfassend: Sie hat Angst vor dem Tod, Angst vor dem Leben, Angst vor der Gesellschaft ... Ich persönlich habe vor allem Angst vor der Zukunft. Angst vor dem Tod – nein, das habe ich nicht.
Darf ich dich fragen: Bist du selbst religiös?
Ja, sehr. Ich bin in einer traditionellen, religiös-orthodoxen Familie aufgewachsen, aber in den letzten zwei Jahren habe ich mich eher der protestantischen Kirche zugewandt. All diese katholischen Traditionen, diese Rituale, diese Ergebenheit und Hingabe, die sind eigentlich sehr weit weg von mir.
Wir führen unser Gespräch via Zoom, denn du bist wegen einer Covid-Infektion noch in Isolation. Hat diese Isolation etwas mit dir und deiner Sicht auf Blanche gemacht?
Ich glaube nicht. Ich bin sowieso eine introvertierte Person und mag es eigentlich sehr, isoliert zu sein. Ich brauche es nicht, mich mit vielen Menschen zu umgeben. Ich kann sehr gut lange alleine sein und leide dabei auch nicht.
Blanche ist ja auch eine sehr isolierte Figur...
Blanche hat Angst vor Menschen. Sie versucht, in ihrem richtigen Leben vor ihren Ängsten zu flüchten, und geht in den Karmeliterorden. Aber natürlich findet sie auch da nicht das, wonach sie wirklich sucht. Alles ist problematisch in ihrem Leben, ihre Familie, die Gesellschaft, sogar der Orden. Egal, wo man bei ihr auch gräbt, es öffnen sich immer Abgründe. Am Ende der Oper bringt sie es dann auf den Punkt: Sie sagt, sie sei in die Angst hineingeboren, sie habe darin gelebt und lebe noch immer darin. Einen wichtigen Teil ihres Wesens macht sicher ihr Glaube aus. Sie verändert sich am Ende der Oper nicht aufgrund ihrer inneren Verfassung, ihrer Instinkte, aufgrund der Umstände oder wegen ihrer Beziehung zu den Nonnen, sondern weil ihr Glaube wächst.
Wenn Blanche in den Tod geht, ist das für dich etwas Positives, im Sinne einer Erlösung, oder doch etwas Negatives?
Für Blanche ist es sicher eine Erlösung und ein sichtbares Zeichen ihres Glaubens. Viele Gläubige finden darin ihren Frieden. Sie betrachten das Leben ja nur als einen Korridor, einen Übergang zum nächsten Leben, das viel besser ist. Alle Nonnen im Stück wissen das und warten auf diese Erlösung. Natürlich haben sie auch Angst davor zu sterben, zumal auf diese schreckliche Art. Andererseits aber scheinen sie zu wissen, dass ein anderes, viel besseres Leben auf sie wartet. Ich persönlich finde diese Idee des Martyriums natürlich schwierig.
Blanche ist ohne Mutter aufgewachsen. Sucht sie vielleicht auch das mütterliche Element im Kloster, in der Verkörperung der Schwestern?
Vielleicht sucht sie im Konvent tatsächlich eine Art Mutterwärme und Zärtlichkeit. Aber sie bekommt sie nicht. Mir fällt auf, dass Blanche in all den Begegnungen und den Gesprächen mit den Schwestern im Kloster immer eine Opferposition einnimmt. Man kennt das ja von Menschen, die zuhause missbraucht oder geschlagen wurden. Anders verhält sie sich hingegen in Bezug auf Constance: Mit ihr ist sie sehr hart, manchmal fast übergriffig.
Dann gibt es diese merkwürdige, beinahe inzestuöse Beziehung zu ihrem Bruder. Er nennt sie zum Beispiel «mein Häschen»...
Im letzten Dialog mit ihrem Bruder sagt sie einen merkwürdigen Satz: Sein Mitleid und seine Zärtlichkeit würden sie zerreissen, sie aber verlange nichts weiter als Respekt. Auch ihre Familie hatte immer dieses Mitleid mit ihr. Sie aber möchte als Person ernstgenommen werden, nicht als Objekt. Ihr familiärer Hintergrund ist von grosser Bedeutung. Ihre Mutter starb, als sie geboren wurde. Vermutlich fühlt sie für diesen Tod auch eine gewisse Schuld.
Hast du dich vorab mit Poulenc beschäftigt? Kanntest du seine Musik schon?
Ich habe ein paar seiner Lieder gesungen und ich habe einige Artikel von ihm gelesen. Er hat eine Art Anleitung geschrieben, wie seine Lieder zu singen seien. Poulenc sagt, dass das Wichtigste der Text sei, dass man den Text analysieren und die bedeutsamsten Wörter herausfinden müsse. In Bezug auf die Partie der Blanche ist das aber gar nicht so einfach. Manchmal sind die musikalischen Höhepunkte an Stellen, an denen die Worte gerade unbedeutend zu sein scheinen, manchmal ist es umgekehrt. Text und Musik streben in ihrer Bedeutung oft auseinander. Und das macht es schwer, sich die Partie zu merken. Poulenc macht stellenweise auch völlig überraschende Dinge. Er unterbricht eine Melodie inmitten eines Satzes und führt sie dann auf eine völlig andere Weise weiter.
Als Francis Poulenc die Rolle der Blanche schrieb, hatte er eine ganz bestimmte Sängerin im Kopf: Denise Duval, mit der er oft zusammengearbeitet hat. Sie hat dann auch die Pariser Erstaufführung des Werks gesungen. Was ist das Spezifische am Gesang der Blanche?
Die Rolle ist wirklich ganz anders als alles, was ich bis jetzt gesungen habe. Die Partie ist eher ein Sprechen mit Melodie als ein wirklicher Gesang, eine Art Sprechgesang. Der Gesang wirkt auf mich typisch französisch und sollte auch so interpretiert werden. Wenn man französische Sängerinnen französische Werke des 20. Jahrhunderts singen hört, singen sie in der Mittellage oft gar nicht so laut und mit wenig Vibrato. Sie lassen der Stimme insgesamt wenig Raum. Für mich wird es eine Herausforderung sein, so zu singen. Ich muss hier sehr an meinem Stil arbeiten. Man sollte wie eine Liedsängerin singen, aber das Orchester ist gross besetzt und laut. Wie bringt man das miteinander in Einklang? Wir werden das in den Proben ausprobieren.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hintergrund

Stille und Zwiegespräche mit Gott
Die Oper «Dialogues des Carmélites» von Francis Poulenc die am 13. Februar Premiere hat, spielt in einem Kloster. Wir haben eine Gemeinschaft der Karmeliterinnen im Greyerzerland besucht, um zu erfahren, wie Nonnen leben. Ein Gespräch mit der Priorin Schwester Anne-Elisabeth über Berufung, Alltag und Prüfungen der Karmeliterinnen von Le Pâquier.
Sie sind die Priorin des Klosters. In der Oper Dialogues des Carmélites von Francis Poulenc müsste ich jetzt «hochehrwürdige Mutter» zu Ihnen sagen. Wie spreche ich Sie richtig an?
Ich bin Schwester Anne-Elisabeth. Bei uns gibt es keine Titel, denn das gehört nicht zu unserer Spiritualität. Die Zeiten, als man noch «Mère» sagte, sind vorbei. Wir sind Schwestern, eine einzige Familie. Unsere Ordensgründerin, Teresa von Avila, wollte kleine Gemeinschaften von 13 Schwestern, damit noch der Geist einer Familie spürbar ist. Später hat sie diese Gemeinschaften dann aus praktischen Gründen auf 20 bis 21 Schwestern erhöht.
Also herrschen bei Ihnen grundsätzlich flache Hierarchien?
Als Priorin trage ich natürlich die Hauptverantwortung, denn immer wieder müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Aber wir sind sehr demokratisch organisiert. Wenn es zum Beispiel um die Renovation im Kloster geht, wie unlängst beim Einbau der Heizung in unserem Gästehaus, dann diskutieren wir die einzelnen Punkte gemeinsam. Eine Priorin allein hat nicht alle Gaben und Fähigkeiten. Jede Schwester bringt sich mit ihren eigenen Stärken ein. Schwestern, die grosse Erfahrungen haben oder junge mit neuen Ideen – das alles fliesst in unsere Entscheidungsfindung mit ein. Auf diese Art wird jede einzelne Schwester respektiert und in ihrem Wesen wahrgenommen.
Dann sind Sie, modern gesprochen, die Managerin des Klosters.
Das könnte man so sagen.
Anne-Elisabeth ist vermutlich nicht Ihr ziviler Name. Wie sind Sie zu diesem Namen gekommen?
Elisabeth ist mein Taufname. Im Kloster gab es aber bereits eine Schwester Elisabeth, daher nenne ich mich Anne-Elisabeth. Es ist jedoch ein Name, der bereits vorher in mir war. Voilà. Jedes Wort hat eine Bedeutung: Anne zum Beispiel heisst Gnade und Geschenk. Mit ganzem Namen heisse ich Anne-Elisabeth de la Miséricorde. Jede Schwester hat eine solche Bezeichnung. Sie zeigt, was uns wichtig ist und was uns anspricht.
Haben Sie in Ihrem zivilen Leben einen Beruf ausgeübt, bevor Sie ins Kloster eingetreten sind?
Natürlich. Das ist bei uns sehr wichtig. Wir verlangen beim Eintritt ins Kloster eine vollständige Berufsausbildung. Man muss bereits in seinem Beruf gearbeitet und selbständig gelebt haben, denn das zeigt, dass bereits eine Persönlichkeit da ist. Ich selbst habe die kaufmännische Berufsschule gemacht, habe in einer Luzerner Papeterie und später als Hilfskrankenschwester in einem Spital in Vevey gearbeitet. Gleichzeitig spürte ich aber diesen Ruf in mir, Christus nachzufolgen. Als ich jemanden traf, der Beziehungen zum Karmel in Le Pâquier hatte und mich einmal dorthin mitnahm, wusste ich, dass dieser Orden zu mir passte. Ich fühlte mich immer wohl in der Stille, im Alleinsein, im Zwiegespräch mit Gott – im Karmel ist das zentral, besonders das stille Gebet. Doch auch das Gemeinschaftsleben ist hier wichtig. Teresa von Avila, die den Orden im 16. Jahrhundert reformierte und eine sehr praktisch veranlagte Frau war, lag die Balance zwischen dem Leben in Gemeinschaft und dem Leben in Einsamkeit sehr am Herzen.
Ist der Eintritt in ein Kloster anfangs vielleicht auch eine Flucht? Bei der Hauptfigur Blanche in unserer Oper Dialogues des Carmélites ist das zum Beispiel der Fall.
Im Normalfall leben Karmeliterinnen das ganze Leben im gleichen Kloster. Wir haben eine Klausur und sind 24 Stunden im gleichen Haus zusammen. Diese Lebensform funktioniert nicht, wenn jemand anwesend ist, der vor seinen Problemen geflüchtet ist. Das würde man spüren, und es würden Schwierigkeiten entstehen. Ich habe diese Erfahrung ja selbst gemacht, als ich nach meiner Berufsausbildung und vor meinem Eintritt in den Karmel zunächst bei den Dominikanerinnen von Bethanien gelandet war, was aber nicht mein Ort war. Dort bin ich nach drei Jahren ausgetreten. Rückblickend war dieser erste Eintritt eine Flucht vor meiner Familie, in der ich mich unfrei fühlte. Ich habe das jedoch erst viel später verstanden. Eine Blume verwelkt, wenn sie nicht in dem Terrain lebt, die ihrem Grundwesen entspricht. Jede, die nicht diese Berufung in sich hat, empfindet später eine gewisse Traurigkeit, wenn die Lebensform nicht mit ihrem Innersten übereinstimmt. Ein ganzes Leben hier zu verbringen, nur um Zuflucht zu suchen oder vor seinen Problemen zu fliehen, ist unmöglich. Die Probleme würden sofort ans Licht kommen.
Gibt es bei Ihnen deshalb diesen langen Aufnahmeprozess von acht Jahren?
Seit einigen Jahren sind es jetzt sogar mindestens neun Jahre. Vorher gab es nach dem definitiven Engagement viele Austritte, deshalb hat man das verlängert. Heute sind die Gesellschaft und die Familienstrukturen ganz anders, viele kommen aus zersplitterten Familien, alles ist fluider. Es ist eine ganz andere Welt. So eine Aufnahme braucht Zeit, und diese Zeit muss man geben, um sich gegenseitig kennenzulernen, um zu wachsen und diese Berufung zu vertiefen, denn alle Dimensionen unseres Wesens sind betroffen und zur Einheit berufen.
Haben Sie es schon oft erlebt, dass jemand an diesem Prozess gescheitert ist?
Selbstverständlich. Eben wenn wir merken: Es ist eine Flucht. Oder jemand ist zu alt und kann sich nicht mehr integrieren. Mit 40, 50 Jahren hat man schon einiges erlebt, hat vielleicht seine Macken. Nicht, dass man genauso wie die Gemeinschaft werden müsste – aber ein solcher Weg kann in diesem Alter doch sehr schwierig werden.
Gibt es denn Nachwuchs?
Momentan haben wir eine Frau in Ausbildung, die den weissen Schleier trägt. Im vergangenen Dezember wurde sie Novizin. Weitere drei werden die Probezeit absolvieren. Das Interesse ist da, aber was daraus wird, wissen wir natürlich noch nicht.
Hatten Sie bei Ihrem Eintritt in den Karmel das Gefühl, die Welt hinter sich zu lassen oder vielmehr in sie hineinzutreten?
Ich wusste einfach, dass ich hier eintreten musste. Diesem starken Ruf musste ich gehorchen, ohne richtig sagen zu können, warum. Heute ist mir klar: Ich möchte für die Gemeinschaft da sein, mich mit meiner Persönlichkeit einbringen und für die Menschheit beten. Zurückgelassen habe ich nichts. In meinem vorherigen Leben habe ich diese Fülle nicht gefunden.
Haben Sie schon von Poulencs Oper gehört?
Ich wusste davon, hatte sie mir aber noch nie angehört. Als Ihre Anfrage kam, habe ich mich dann selbstverständlich darüber informiert, mir Auszüge der Musik angehört und einzelne Produktionen auf YouTube angeschaut.
Die 16 Karmeliterinnen von Compiègne, die während dem Französischen Terrorregime 1794 für ihren Glauben in den Tod gingen, wurden 1906 durch den Papst selig gesprochen. Haben sie noch eine Bedeutung für den Karmel?
Uns hier in der Schweiz sagt das eigentlich nichts mehr. Aber es gibt den Karmel in Joncquières. Sie sind die Nachfolgerinnen der Karmelitinnen von Compiègne, die deren Erbe weitertragen. Sie sind ganz davon erfüllt.
Könnten Sie sich vorstellen, für Ihren Glauben zu sterben?
Man kann auf so eine Frage nie antworten, wenn man nicht in dieser Situation ist. Doch grundsätzlich würde ich sagen: Ja. Aber ich hätte sicher Angst. Die Schwestern haben damals ja auch unterschiedlich reagiert. Früher gab es die gewaltsame und aktive Verfolgung der Christen, heute verschwindet der Glaube mehr und mehr. Es kann natürlich sein, dass dieses Desinteresse plötzlich wieder in Gewalt umschlägt und eine ganze Gemeinschaft trifft. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, für meinen Glauben zu sterben. Unser Leben für den Glauben, für Jesus Christus hinzugeben, das leben wir ja schon heute täglich. Alles, was wir machen, ist für ihn: «Pour toi, par amour». Auch wenn wir unsere Gelübde leben – den Gehorsam beispielsweise, was nicht immer so einfach ist –, sind diese Gelübde auch ein Weg, aus Liebe das eigene Leben hinzugeben. Das ist nicht für uns selbst, sondern für die Menschheit. Wir beten für andere.
Das zentrale Thema der Oper von Poulenc ist die Angst. Ist Angst ein Thema für den Karmel? Das Überwinden von Angst? Kann Religion eine Strategie gegen Angst sein?
Angst ist durchaus ein Thema für uns. Ganz konkret haben wir das vor zwei Jahren erlebt, als wir alle in der ersten Welle von Corona erkrankt waren. Das war ganz am Anfang, als man noch nicht viel über die Krankheit wusste, auch nicht, wie man sich schützt, und es noch keine Impfung gab. Zwei Schwestern und ich mussten ins Krankenhaus. Einige unter uns haben Todeserfahrungen gemacht. Mich als Verantwortliche hat es zusätzlich belastet, zu wissen, dass es den anderen nicht gut geht und ich nichts machen kann. Man will niemanden verlieren. Damals habe ich sehr viel Angst erlebt, und zwar in so einer konzentrierten und gewaltsamen Art, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Ich habe die Erfahrung des Schreiens gemacht. Ich wollte noch nicht sterben, denn ich war noch nicht bereit dazu, sondern habe noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich hatte sehr viele schreckliche Bilder in mir. Aber die Hilfe kam mir in der Gestalt des heiligen Joseph, den ich sehr gerne habe. Er fragte mich: Was willst du? Ich sagte zu ihm: «Beschütze meine Schwestern, …und auch mich». Zum Glück ist wirklich niemand gestorben. Ich hatte danach fast 15 Monate lang Long Covid, heute bin ich geheilt. Aber es war hart. Die Erfahrung der Angst war extrem. Auch die Erfahrung, wie man wirklich reagiert, wenn man dem Tode so nah ist, und nicht nur schön darüber redet. Die andere Schwester, die ebenfalls schwer erkrankt war, hat das hingegen ganz anders erlebt und hat sogar eine positive Erfahrung gemacht. Ich weiss nicht, warum ich das negativ empfunden habe. Ich hatte deswegen fast Schuldgefühle. Heute sehe ich das anders und kann nachempfinden, dass so viele Menschen Todesängste haben. Unsere Gemeinschaft hält sehr stark zusammen, und durch die Schwäche ist das noch stärker geworden. Wir haben damals auch sehr viel Wohlwollen und Hilfe von anderen erfahren. Das war beeindruckend.
Sie sprechen die Aussenwelt an. Sie scheinen ein erstaunlich offenes Verhältnis zur ausserklösterlichen Welt zu haben. Sie haben eine Homepage, sind auf Facebook vertreten und haben ein Gästehaus, in welchem ich ganz unkompliziert übernachten konnte.
Wenn jemand nicht bekannt ist, existiert er nicht. Das gilt auch für das Kloster. Wir hatten hier immer Priorinnen, die sehr offen und aufmerksam gegenüber der Welt waren. Als Anfragen von aussen kamen, ob man auch bei uns übernachten könnte, haben wir sofort überlegt, was wir machen können. Wir haben uns dann für dieses Gästehaus entschieden und es wurde so gebaut, dass der Geist des Karmel auch dort gelebt werden kann, ohne dass wir zu sehr darin integriert wären. In der benediktinischen Tradition ist so etwas sehr wichtig, da gibt es auch gemeinsame Mittagessen für die Gäste. Aber das ist eine immense Arbeit, die wir nicht leisten können. Ein alter Pater sagte zu uns einmal: Alles, was gegessen wird, muss gekauft werden. Da unsere Schwestern Feinschmeckerinnen sind, haben wir uns dann gefragt, warum wir nicht Guetzli backen sollen. 2008 ist unsere Guetzli-Bäckerei entstanden. Wir haben klein angefangen, in unserer Küche. Jetzt haben wir eine Guetzli-Bäckerei nach neuesten hygienischen Standards. Wir haben unsere Guetzli am Anfang bei einer grossen Lebensmittel-Ausstellung in Bulle verkauft. Das war revolutionär: Der Karmel, der in Klausur sein müsste, geht in die Welt! Aber wir mussten uns bekannt machen. Wir leben nicht nur von Brot und Wasser und Liebe, und niemand bezahlt uns. Dann brauchte es eine Internetseite für unseren Verkauf, und so kam eines zum anderen. Es ist wichtig, ein offenes Fenster für die Welt zu haben, denn wir sind kein Museum und wollen auch keines sein.
In Dialogues des Carmélites wird aufgrund einer Notsituation viel diskutiert. Doch eigentlich ist im Karmel das Schweigen oberstes Gebot, auch wenn ich jetzt gelernt habe, dass Sie die Auseinandersetzung, die Diskussion und den lebendigen Austausch untereinander genauso fördern. Was hat es mit dem klösterlichen Schweigegebot auf sich?
Für uns alle ist das Schweigen die Möglichkeit, bei Gott zu bleiben und mit ihm in Kontakt zu treten. Teresa von Avila hat die Erfahrung gemacht, dass Gott in einem drin lebt. Das ist wie eine Liebesbeziehung: Jemand ist da. Wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richten möchte, kann das nur in der Stille geschehen. Wäre ich ständig mit der äusseren Welt beschäftigt, mit meinen Schwestern, kann ich nicht mehr bei mir und nicht bei ihm sein. Schweigen ist der Raum, der es ermöglicht, dass man miteinander verbunden ist, und das Gebet ist der Ausdruck davon. In der Welt gibt es so viel Leid – «le monde est en feu» sagte Teresa von Avila, das gilt noch immer. Im eigenen Schweigen höre ich diese Resonanz und bete dafür. Im Lärm kann das alles nicht passieren.
Stimmt es, dass Sie eine kleine Einsiedelei im Kloster haben?
Ja, das ist ganz wichtig im Karmel. Jede Schwester kann sich während des Jahres in der Einsiedelei im Dachstock des Hauses für zwei Wochen in die Stille zurückziehen, auch, um geistig wieder aufzutanken, denn das Gemeinschaftsleben und die Arbeit fordern doch sehr. In unserem Garten haben wir auch kleine Einsiedeleien, Rückzugsorte für tagsüber.
Hat Sie die Einsamkeit auch schon zur Verzweiflung gebracht?
Wir bleiben Menschen, und da kann uns alles passieren. Auch wir erleben, dass die Stille schwer werden kann: Entweder aufgrund unserer eigenen aktuellen psychischen Verfassung, oder wir tragen irgendetwas in der Welt mit. Wir glauben, dass Christus für uns den Kreuzweg aus Liebe gegangen ist, um uns zu erlösen. Wir sind da, um diesen gleichen Weg zu gehen, in welcher Form auch immer.
Ich habe einmal gelesen, dass die Karmeliterinnen ihre Hände nie zeigen.
Ich zeige meine Hände häufig. Sie sind ja dafür da, um etwas zu tun. Nur im Gebet, da bleiben die Hände oft unter dem Skapulier. Der Körper hilft mit, um zu sich selbst zu kommen.
Mittwochs ist bei Ihnen «Wüstentag für die Gemeinschaft». Was bedeutet das?
Durch die Guetzli-Bäckerei sind wir jetzt viel mehr zusammen, als eigentlich in einem Karmel vorgesehen ist. Früher hat jede für sich in ihrer Zelle gearbeitet, hat genäht, gestickt oder Fahnen hergestellt. Aber das ist nicht mehr zeitgemäss. In unserer Bäckerei arbeiten sechs bis acht Schwestern zusammen, je nachdem, wie schnell es mit dem Teig gehen muss. Das kann auch sehr ermüdend sein, auch wenn wir im Schweigen sind. Um das auszugleichen, haben wir am Mittwoch diesen Wüstentag. Die Gemeinschaft ist dann in zwei Gruppen aufgeteilt: Die eine ist völlig frei in ihrem Tun, hat mehr Zeit zum Gebet, Studium oder geistiger Lesung, die andere macht die wesentlichen Arbeiten wie Pforte, Küche und so weiter.
Kommt es manchmal zu Konflikten?
Dass es Spannungen gibt, ist klar, denn jede Schwester hat ihr eigenes Temperament. Es gibt Schwestern, die wie ein Feuer sind und ein Feuer bleiben. Das darf durchaus seinen Platz haben. Doch wir müssen uns weiterentwickeln. Wir arbeiten daher bereits seit 20 Jahren eng mit einer Psychologin zusammen. Hier geht es darum, wie wir am besten miteinander kommunizieren, wie man sich richtig ausspricht und wie Konflikte vermieden werden können. Letztendlich geht es um gegenseitigen Respekt.
Welche Bedeutung hat die Musik, der Gesang in Ihrem Kloster?
Musik ist für uns etwas sehr Wichtiges, und gerade das Singen ist gut für den Zusammenhalt. Wir singen täglich das Chorgebet, die Psalmen, die Laudes, das Mittagsgebet, die Vesper und die Office des Lectures. Auch hier arbeiten wir mit einer Frau, die uns in Gesang unterrichtet.
Eine letzte Frage: Könnten Sie sich vorstellen, die Oper von Poulenc in Zürich anzuschauen?
Lust hätte ich schon, das ist klar. Aber die Frage ist: Ist das wichtig für uns? Wir müssten das diskutieren. Nach draussen gehen wir grundsätzlich nur für Arztbesuche, für Kommissionen oder um uns zu bewegen, denn man muss ja auch auf seinen Körper achtgeben – diesen Ausgleich braucht es. Wenn der Opernbesuch eine Art Fortbildung wäre, wer weiss...
Das Gespräch führte Kathrin Brunner
Schwester Anne-Elisabeth ist die Priorin des Klosters in Le Pâquier im Greyerzerland.
Die Geschichte des Karmeliterordens geht bis ins 12. Jahrhundert zurück, als sich Einsiedler am Fusse des Karmel in Palästina niederliessen und sich einem streng eremitischen Leben hingaben. Um 1240 zogen sie wegen der Gefahr durch die Sarazenen nach Europa. Im 16. Jahrhundert reformierte Teresa von Avila den Orden und gründete zahlreiche neue Klöster. Die Karmeliterinnen in Le Pâquier stehen in ihrer Nachfolge.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Auf der Couch
Zu den eindrucksvollsten Bildwerken Roms gehört die Verzückung der heiligen Teresa von Avila über dem Altar der Kirche Santa Maria della Vittoria, eine Arbeit Lorenzo Berninis. Der Bildhauer gestaltet eine Szene aus der Autobiografie der grossen Mystikerin: «In der Hand des Engels sah ich einen langen goldenen Pfeil mit Feuer an der Spitze. Es schien mir, als stiesse er ihn mehrmals in mein Herz, ich fühlte, wie das Eisen mein Innerstes durchdrang, und als er ihn herauszog, war mir, als nähme er mein Herz mit, und ich blieb erfüllt von flammender Liebe zu Gott. Der Schmerz war so stark, dass ich klagend aufschrie. Doch zugleich empfand ich eine so unendliche Süsse, dass ich dem Schmerz ewige Dauer wünschte.»
Teresa muss eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein, meines Wissens die einzige Frau, die das eiserne Gesetz des katholischen Männerprivilegs durchbrach, indem sie nicht nur den eigenen Orden der barfüssigen Karmeliterinnen reformierte, sondern einen männlichen Zweig dieser Reformation auf den Weg brachte. Teresa war die Enkelin eines sephardischen Juden, der sich taufen liess und einen spanischen Adelstitel kaufte. Ihr Vater wollte nichts von ihrer spirituellen Begeisterung wissen. Teresa wuchs in einem Elternhaus auf, in dem die Erinnerung an eine Bekehrung unter Zwang noch lebendig war. Hat sie gerade deshalb ihre Gottesliebe übersteigert?
Wer in einen Orden eintritt, den inspiriert die Gestalt der Gründerin. Teresa wollte ein in erstarrten Riten praktiziertes Klosterleben erneuern, den Glauben zu einer ganz persönlichen, intimen Überzeugung formen. Blanche de la Force, die Hauptfigur in Poulencs Oper Dialogues des Carmélites, sucht nach einer traumatischen Erfahrung mit einem aggressiven Mob Zuflucht in einem Kloster der Karmelitinnen von Compiègne. Sie tritt uns als ein Mädchen entgegen, das mit Schuldgefühlen ringt, weil seine Mutter nach der Geburt starb. Blanche ist ohne Mutter aufgewachsen und auf der Suche nach Halt.
Wie wir heute wissen, brauchen kleine Kinder ein einfühlendes Gegenüber, das sie darin unterstützt, ihre Emotionen zu akzeptieren und sich an ihnen zu orientieren. Ältere Kinder brauchen eine Spielgruppe, die ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu erproben und Selbstvertrauen zu gewinnen. Die Möglichkeiten dazu waren im 18. Jahrhundert für Frauen allgemein nicht sonderlich gut, für eine mutterlos aufgewachsene Tochter aus adeliger Familie in wirren Zeiten jedenfalls denkbar schlecht.
Den Karmeliterinnen von Compiègne hatten die Revolutionäre verordnet, Gelübde und Gemeinschaft zu verlassen. Widerstand gegen diese Anordnung galt als Hochverrat. Es stand den frommen Frauen frei, das Leben normaler Bürgerinnen zu führen. Sie aber wurden von ihrer Novizenmeisterin bedrängt, ihr Leben in der Gemeinschaft fortzusetzen und die Hinrichtung in Kauf zu nehmen.
Die Geschichte gehorcht nicht dem Bonmot von Marx, dass sie als Tragödie beginnt und sich als Farce wiederholt. Die Wiederholung kann durchaus tragischer werden. Was geschieht mit Menschen, die nicht in die Glaubenswelt einer neuen Macht passen? Der Vater der heiligen Teresa von Avila überlebte, weil er sich, als Jude geboren, taufen liess. So hätten auch die Karmeliterinnen von Compiègne davonkommen können.
Die Dichter und Komponisten, die den Stoff im 20. Jahrhundert neu belebten, mussten sich mit einer Gnadenlosigkeit auseinandersetzen, die jede Überheblichkeit hinsichtlich eines moralischen Fortschritts der Menschheit verbietet. In der rassistischen Ideologie Hitlers wurde die Wahl, Überzeugungen zu opfern, den Verfolgten nicht mehr angeboten.
Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor
Illustration: Anita Allemann
Dialogues des Carmélites
Synopsis
Dialogues des Carmélites
Erster Akt
1. Bild
Der Chevalier de la Force ist besorgt um seine Schwester Blanche. Soeben hat er vernommen, dass ihre Kutsche von Revolutionären angehalten wurde. Dies ruft in seinem Vater ein altes Trauma hervor: Bei einem Feuerwerksunfall musste seine hochschwangere Frau vor dem rasenden Mob fliehen. Sie erlitt eine Frühgeburt und starb, ihre Tochter, Blanche, überlebte.
Blanche erzählt von ihrer Panik auf der Strasse. Der Schatten eines Dieners an der Wand erschreckt sie derart, dass sie erneut mit ihrer Angst konfrontiert wird. Sie eröffnet ihrem Vater, dass sie ihr Leben in einem Karmeliterinnenkloster verbringen will. Nur dort glaubt sie Ruhe zu finden.
2. Bild
Blanche bittet Madame de Croissy, die alte und schwerkranke Priorin des Karmel, sie zum Noviziat zuzulassen. Die Priorin warnt Blanche, dass sie einen steinigen Weg vor sich haben werde und der Orden keine simple Zufluchtsstätte sei. Doch die Strenge der Ordensregeln bestärkt Blanche in ihrem Wunsch. Als sie der Priorin eröffnet, sich Blanche von Christi Todesangst nennen zu wollen, erteilt ihr die erschütterte Priorin den Segen.
3. Bild
Blanche und Constance, die ebenfalls Novizin des Karmel ist, sind mit Alltagsarbeiten beschäftigt. Sie reagiert unwirsch auf Constances unermüdliche Fröhlichkeit, und das ganz besonders angesichts der todkranken Priorin. Als Constance Blanche von ihrer Vision erzählt, dass sie beide eines Tages gemeinsam sterben werden, unterbricht sie Blanche empört.
4. Bild
Der Tod der alten Priorin naht. Trotz ihres Glaubens wird sie von Angst und Schmerzen überwältigt. Über ihre gottlosen Reden ist die anwesende Mère Marie de l’Incarnation entsetzt. Die Priorin befiehlt Mère Marie, Blanche in ihre Obhut zu nehmen. Sie lässt Blanche zu sich kommen, ihre Worte gleichen einem Vermächtnis. In einer Vision sieht die Priorin die Verwüstung des Klosters voraus. Blanche wird Zeugin ihres qualvollen Todes.
Zweiter Akt
5. Bild
Blanche und Constance halten die Totenwache für die Priorin. Blanche gerät plötzlich in Panik und will aus der Kapelle fliehen. Mère Marie tritt hinzu und weist sie streng zurecht. Sie rät ihr jedoch, ihre Verfehlung nicht allzu schwer zu nehmen.
Zwischenspiel: Während sie den Blumenschmuck für die verstorbene Priorin vorbereiten, unterhalten sich Blanche und Constance über deren Nachfolge. Constance hofft, dass Mère Marie die neue Priorin wird. Der schwere Tod der alten Priorin beschäftigt Constance. Sie überlegt, ob sie möglicherweise den Tod einer anderen gestorben sei.
6. Bild
Zur neuen Priorin wurde nicht die aus dem Hochadel stammende Mère Marie gewählt, sondern die bescheidene Madame Lidoine. In ihrer ersten Ansprache an die Schwestern fordert sie von ihnen, ihr Seelenheil auch in politisch unsicheren Zeiten im Gebet und nicht im Martyrium zu suchen.
Zwischenspiel: In die bisherige Klosterruhe dringt immer mehr die Unruhe der Revolution. Der Chevalier de la Force möchte seine Schwester Blanche sprechen. Die Priorin besteht darauf, dass Mère Marie dem Gespräch beiwohnt.
7. Bild
Der Chevalier will Frankreich angesichts der gefährlichen politischen Situation verlassen. Er bittet Blanche, zu ihrem Vater zurückzukehren. Doch Blanche verteidigt ihre neue Lebensweise als Karmeliterin. Sie behauptet, nicht aus Angst, sondern aus Pflichtgefühl im Kloster bleiben zu wollen.
8. Bild
Der Beichtvater des Klosters hat seine letzte Messe mit den Nonnen gefeiert. Er wurde soeben seines Amtes als Priester enthoben und will fortan im Geheimen seinen Glauben leben. Von draussen dringt der Lärm des Pöbels ins Kloster. Ein Volksbeauftragter verkündet, dass gemäss einer neuen Bestimmung sämtliche Klöster geräumt werden müssen.
Mère Jeanne überreicht Blanche den Petit Roi. Als erneut Lärm von draussen ertönt, lässt Blanche die kleine Statue erschrocken fallen.
Dritter Akt
9. Bild
In Abwesenheit der Priorin schlägt Mère Marie ihren Mitschwestern vor, das Gelübde zum Martyrium abzulegen. Eine geheime Abstimmung findet statt. Es gibt eine Gegenstimme. Constance bekennt sich dazu, schliesst sich dann jedoch den anderen an.
Zwischenspiel: Die Stimme eines Beamten verkündet das Ende der Ordensgemeinschaft und erklärt die Nonnen zu Bürgerinnen. Die zurückgekehrte Priorin muss feststellen, dass die Nonnen gegen ihren Willen das Martyriumsgelübde abgelegt haben.
10. Bild
Blanche ist aus dem Kloster in ihr ehemaliges Vaterhaus geflohen und lebt dort als niedere Dienstmagd. Ihr Vater wurde von den Revolutionären umgebracht. Mère Marie sucht sie auf und bittet sie eindringlich, sich zu verstecken. Blanche bleibt.
11. Bild
Die Nonnen sind – mit Ausnahme von Mère Marie – wegen angeblicher konterrevolutionärer Aktivitäten verhaftet worden. Die Priorin spricht ihren Mitschwestern Trost zu und übernimmt die volle Verantwortung für das Martyriumsgelübde, obwohl sie es selbst nicht abgelegt hat. Sie erinnert die Schwestern an die Todesangst Christi im Garten Gethsemane.
Die Nonnen werden zum Tod verurteilt.
Zwischenspiel: Der Beichtvater berichtet Mère Marie von der bevorstehenden Hinrichtung der Karmeliterinnen. Er will sie davon abhalten, sich ihren Schwestern anzuschliessen. Mère Marie – innerlich zerrissen – stimmt ihm zu und flieht.
12. Bild
Das Salve regina singend, werden die Karmeliterinnen nacheinander durch die Guillotine exekutiert. Constances Vision, gemeinsam mit Blanche zu sterben, wird wahr: Blanche erscheint und folgt ihren Schwestern vollkommen ruhig in den Tod.