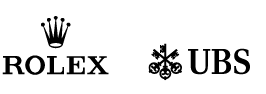La verità in cimento
Dramma per musica in drei Akten von Antonio Vivaldi (1678-1741)
Libretto von Giovanni Palazzi
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 20 Min. inkl. Pause nach dem 1. Akt nach ca. 1 Std. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Gespräch

Herr Gloger, beginnen wir gleich mit der kompliziertesten Frage: Worum geht es in La verità in cimento?
Gloger: Die Handlung spielt in einem orientalischen Serail und dreht sich um die Nöte eines reichen Sultans, der seinen Thron und seine Königreiche vererben will. Der Potentat hat zwei gleichalte Söhne. Den einen hat er mit seiner Ehefrau gezeugt, den anderen mit einer Nebenfrau. Diese beiden Söhne hat er nach der Geburt heimlich vertauscht. Sie sind also jeweils mit der falschen Mutter, in falschen Verhältnissen aufgewachsen, denn der Sultan hatte seiner Nebenfrau versprochen, ihren Sohn als offiziellen Thronfolger aufwachsen zu lassen, wenn sie seine Ehe nicht stört und sich im Hintergrund hält. Die Opernhandlung setzt in dem Augenblick ein, in dem er beschliesst, mit dieser Lebenslüge Schluss zu machen, die Wahrheit auf den Tisch zu bringen und das Erbe neu zu verteilen. Es brechen Machtkämpfe und Identitätskrisen aus. Die Wahrheit kommt auf den Prüfstand. Das ist ja auch der Titel der Oper: La verità in cimento.
Was hat Sie an diesem auf den ersten Blick sehr konstruiert wirkenden Stoff interessiert?
Zum Beispiel das Thema, das durch den Titel benannt wird: Die Frage nach der Wahrheit. Ist es immer gut, die Wahrheit zu sagen? Welche Folgen hat es für das soziale Gleichgewicht in einer Familie, wenn man eine Lüge rückgängig machen will und auf der Wahrheit beharrt?
Und welche Folgen der Wahrheit führt die Oper vor?
Mamud, der Herrscher, ruiniert sich und seine Familie. Mit seinem Versuch, die Wahrheit offen zu legen, stösst er auf viele Widerstände. Alle Beteiligten sind so tief in den falschen Verhältnissen verankert oder haben sich bewusst in der Doppelbödigkeit eingerichtet, dass sie gar nicht mehr zurück wollen. Die Versuchsanordnung der vertauschten Kinder birgt Brisanz. Man erlebt, wie es junge Männer plötzlich innerlich zerreisst, wenn sie erfahren, dass ihre Eltern gar nicht die leiblichen Eltern sind. Umgekehrt müssen die Mütter damit klar kommen, dass sie Stiefsöhne aufgezogen haben. Solche Krisen kennen wir ja im Zeitalter der Patchwork-Familien sehr gut. Das Ganze wird noch perfider, wenn es nicht nur um Zuwendung und Liebe geht, sondern auch noch um Reichtum und Erbansprüche. Die Geschichte aus dem scheinbar so fernen Serail weist mehr Parallelen zu unserer Gegenwart auf, als man zunächst ahnt. Ich musste gleich an den Kinofilm Das Fest von Thomas Vinterberg denken, in dem bei einer Familienfeier plötzlich die dunkle Wahrheit von Kindesmissbrauch und Suizid auf den Tisch kommt, mit ruinösen Folgen. Auch die Dramen von Ibsen erzählen davon, wie Familienkonstellationen auseinander brechen und welche destruktive Energien ihnen innewohnen.
Ein barockes Opernlibretto offenbart aber nicht die psychologischen Abgründe, die sich in den Dramen des 19. und 20. Jahrhunderts auftun.
Das stimmt. Aber die Barockoper thematisiert mit ihrer Affektdramatik etwas, das ich in diesem Zusammenhang sehr spannend finde – das Darstellen und Ausstellen von Emotionen. Soziale Konstruktionen funktionieren immer über bestimmte Rollen, die wir spielen und auf die wir uns verlassen. In La verità in cimento steht die Wahrheit auch deshalb auf dem Prüfstand, weil es in diesem Stück immer wieder um das Vorspielen von Rollen geht, die durch die Wahrheit nicht gedeckt sind. Das beste Beispiel dafür ist Damira, die zur Seite geschobene Ex-Geliebte von Mamud. Sie spielt nicht nur das ahnungslose Dienstmädchen. Sie spielt ihrem Stiefsohn auch über drei Akte hinweg die Farce einer liebenden Mutter vor, obwohl sie genau weiss, dass er nicht ihr leibliches Kind ist und ihr Interesse in Wirklichkeit nur dem als Thronfolger aufwachsenden wahren Sohn gilt. Damira performt Gefühle. In ihrer letzten Arie versucht sie ihrer Konkurrentin, Mamuds Gattin Rustena, beizubringen, wie man als Frau Tränen und Verzweiflungsanfälle strategisch einsetzt. Sie berauscht sich in dieser Arie regelrecht an ihrer eigenen Verschlagenheit, obwohl diese als Strategie längst gescheitert ist. In unserer Inszenierung schlägt ihr Vorspielen, wie man künstlich weint, dann in echtes Weinen um. Wenn wir anfangen, mit unseren Gefühlen strategisch umzugehen, können wir uns irgendwann nicht mehr sicher sein, ob wir überhaupt noch echt fühlen. Diese Verschränkung von Empfindung und Performance in der Barockoper ist im Grunde ungeheuer modern. Denn wir leben doch in einer Welt, in der die Performance auch im Sinne von Leistungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, guter Laune, Anteilnahme und was auch immer eine riesige Rolle spielt. Die Darstellbarkeit von Emotionen und Befähigung ist heute von grosser Bedeutung. Und genau damit spielt die Oper im 18. Jahrhundert.
Die von manchen als sehr künstlich empfundene BarockDramatik hat für Sie also eine Entsprechung in der Moderne?
In gewisser Weise schon. Weil der Affekt unmittelbar hervorbricht und nicht den Umweg über die psychologische Begründung nimmt. Das ist ja das Faszinierende an einem Komponisten wie Vivaldi: Dass die Gefühle wie aus der Pistole geschossen kommen. La verità setzt in ihrer Dramaturgie auf extreme Kontraste und Brüche. Da spüre ich manchmal eine grössere Nähe zur Wirklichkeit von heute als in vielen Stoffen des 19. Jahrhunderts. In der Barockoper ist der Emotion ihre Behauptung eingeschrieben. Es gibt Untersuchungen darüber, ob bei weinenden Menschen zuerst die Träne kommt und dann das Gefühl oder zuerst das Gefühl und dann die Träne. Das heisst: Ein Gefühl beinhaltet immer auch einen Willen zu einem Gefühl. Kinder zum Beispiel sehen sich gerne vor dem Spiegel weinen. Und in La verità blendet Vivaldi strategisch eingesetzte und echte Emotionen bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander, bei Rosane zum Beispiel. Sie ist die hochattraktive junge Frau, die von beiden Söhnen geliebt und umworben wird. Das Begehren ist in ihrem Charakter ein wichtiger Antrieb. Es bezieht sich aber nicht nur auf Männer, sondern auch auf den Appeal von Macht und Reichtum. Rosane folgt ihrem Herzen und hat gleichzeitig einen knallharten Aufstiegswillen. Sie nimmt sehr genau wahr, welchen Zickzackkurs die Thronfolge-Regelung nimmt und folgt dieser Spur, zugleich ist sie eine grosse Liebende. Das ist hochwidersprüchlich, aber in dieser Widersprüchlichkeit sehr real. Die grosse, nicht zweckgebundene Liebe und die Zweckmässigkeit der Liebe können sich eben bis zur Ununterscheidbarkeit verschränken. Das kennt wohl jeder aus Beispielen des realen Lebens. Diese Rosane ist eine schillernde, moderne Figur, die in unserer Produktion bei Julie Fuchs fantastisch aufgehoben ist.
Wo spielt die orientalische Verità-Handlung in unserer Zürcher Produktion?
Sie in einem fernen, märchenhaften Serail anzusiedeln, hat uns nicht interessiert. Gemeinsam mit dem Bühnenbildner Ben Baur und der Kostümbildnerin Karin Jud haben wir beschlossen, die Geschichte zeitlich in die Gegenwart zu holen. Sie spielt in einer Villa von heute, die theoretisch in dieser Stadt, etwa auf dem Züriberg, stehen könnte, aber natürlich auch jedem anderen westlich modernen Wohlstandsmilieu entstammen könnte. Im grossen Esszimmer dieser Villa hat sich die Familie am Abend vor der Hochzeit des einzigen Sohns eingefunden. Mamud ist ein erfolgreicher Unternehmer im gesetzten Alter. Ein Kunstsammler, der mit seinem Familienunternehmen wirklich etwas zu vererben hat. Es braucht ein gesellschaftliches Oben und ein Unten, ein steiles Gefälle zwischen dem Familienoberhaupt und der Hausangestellten, die den Ehrgeiz hat, nach oben zu kommen oder zumindest ihren Sohn oben zu sehen, sonst funktioniert die Geschichte nicht.
Wo liegen die Chancen, wo liegen die Gefahren einer solchen konkreten theatralischen Behauptung?
Die Gefahren spürt man sofort: Wenn man sich auf diese Form von Realismus einlässt, muss er auch schlüssig sein und funktionieren. Wir haben eine Stückfassung erstellt, die dem, was wir erzählen wollen, entgegen kommt. Um einen nachvollziehbaren dramaturgischen Bogen spannen zu können, haben wir Rezitative gekürzt und auch mal eine Arie umgestellt. Wir wissen alle, dass Realismus auf der Opernbühne stinklangweilig sein kann, aber hier trifft er auf einen Stoff, der überhaupt nicht realistisch angelegt ist. Wir haben es mit einem Libretto aus vorpsychologischer Zeit zu tun. Es passieren verrückte und nahezu unerklärbare Dinge. In dieser Kombination finde ich Realismus spannend. Das ist eine Erfahrung, die ich auch im Schauspiel gemacht habe. Wenn ein Text von Elfriede Jelinek, der jedem Realismus spottet, auf konkrete theatralische Situationen trifft, entsteht eine produktive Reibung.
Wie sehr sperrt sich die Verità-Handlung in ihrer Unwahrscheinlichkeit einer realistischen Erzählweise?
Wenn man erst einmal eine theatralische Setzung vor Augen hat, wird es leichter und es öffnen sich Türen. Was uns enorm geholfen hat, ist Vivaldis griffige musikalische Charakterisierung der Figuren. Sie sind so ange- legt, dass man tatsächlich moderne Figuren herausarbeiten kann. Rosane habe ich ja bereits erwähnt. Das gilt aber beispielsweise auch für Rustena, Mamuds Ehefrau. Sie singt etwa im dritten Akt eine tief melancholische, von Blockflöten umspielte Arie, in der sie sich danach sehnt, im Wald, fernab vom Schmerz ihrer unglücklichen Ehe, geboren zu sein. Das passt nicht schlecht zum Typus einer älter werdenden Unternehmergattin, die sich mit zunehmend bedrückender Eherealität in andere Welten träumt, der Vergangenheit einer heilen Familie nachhängt und sich mit Spiritualität und Esoterik zu therapieren versucht.
Ist Vivaldis Blick auf seine Figuren mitunter zynisch?
Das kann ich nicht erkennen. Es ist doch viel eher der Versuch, menschliches Verhalten genau zu durchdringen. Dann wäre auch Mozart ein Zyniker, aber das war er nicht. Er hat nur sehr genau hingeschaut und viel vom Menschsein verstanden, wie wir gerade aus seinen Opern Le nozze di Figaro und Così fan tutte erfahren. Er weiss um die gefährliche Nähe von Sein und Schein, von hehren und weniger hehren Gefühlen. Menschen werden eben dadurch zu ganzen Menschen, dass sie sich in Widersprüchen verstricken. Auch Vivaldi ist wohl eher von der Genauigkeit der Menschenbeobachtung getrieben als von Verachtung und Parodie. Selbst Damira, die eigentlich die klassische Furie ist, die Böse, die eindimensional erscheint, weil sie an ihrem Konzept von Intrige und Heuchelei festhält, offenbart in der Musik Momente der echten Verzweiflung und des Nicht-mehr-weiter-wissens.
Ist der Wechsel von Rezitativ und Arie, der gerade bei Vivaldi etwas schematisch ausfällt, ein Problem für die Regie?
Aus unserem heutigen Blickwinkel ist das natürlich eine hochartifizielle Form, eine Geschichte zu erzählen. Aber gerade die Künstlichkeit empfinde ich als theatralische Chance. In den Arien singt eine Figur über sieben Minuten hinweg nur zwei Sätze, das ist doch spannend. Es ist wie ein grosses leeres Blatt Papier, das es mit Ideen zu füllen gilt. Im ersten Moment kann das Angst machen, aber Vivaldi gibt einem mit der Musik ja auch den vollen Farbeimer in die Hand. Man kann mit Situationen spielen, mit jeder Arie eine eigene kleine Geschichte erzählen, die Zeit anhalten und sie einfach nur singen lassen. Ben Baurs Bühnenbild macht in unserer Produktion Parallelhandlungen möglich. Man sieht, was in dem einen Zimmer passiert, während in dem anderen gesungen wird. Eine Dacapo-Arie szenisch zu füllen, ist natürlich auch für die Sänger eine Herausforderung, man sitzt gewissermassen im gleichen Boot und entwickelt die Situationen gemeinsam. Man wird gemeinsam erfinderisch und manchmal verzweifelt man auch gemeinsam. Die Ausgrabung einer Barockoper wie La verità in cimento ist ein offenes Feld und in vieler Hinsicht spannender als eine Oper aus dem Kernrepertoire auf die Bühne zu bringen, die jeder schon in zwanzig verschiedenen Umsetzungen gesehen oder selbst gesungen hat. Ich empfinde es als ein grosses Glück, dass alle sechs Sängersolisten in dieser Produktion starke Persönlichkeiten sind. Sie wollen wirklich Charaktere entwickeln und werden zu Anwälten ihrer Figuren. Der Satz: «Das würde meine Figur nie tun», hört man von Schauspielern oft, manchmal zu oft, von Sängern hört man ihn seltener, aber gerne. Und was besonders Spass macht: Zwei Französinnen und ein Franzose, eine Deutsche, eine Russin und ein Amerikaner reden mit einem italienischen Dirigenten und einem deutschen Regisseur während der Proben auf Englisch ganz viel über Rhetorik und Diktion. Und alle sind sich einig, dass Vivaldis Theater zuallerst über die Lebendigkeit der Sprache funktioniert.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 29, Mai 2015
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Gespräch

Der Star, den alle liebten
Antonio Vivaldi war einer der erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit. Was hat die Menschen an seiner Musik so hingerissen? Und wie kann man die Begeisterung heute neu entfachen? Claus Spahn führte vor der Premiere 2015 ein Gespräch mit Ottavio Dantone, dem Dirigenten unserer Vivaldi-Produktion.
Der Mann wusste, wie er für die Ewigkeit festgehalten werden wollte: Mit offenem weissen Unter(!)-Hemd und aufreizend nackter Männerbrust liess er sich in Öl porträtieren. Das war sehr gewagt, wenn nicht skandalös, für eine Epoche, in der die Herrenmode eigentlich hochgeschlossen war. Ausserdem hatte der Mann die Priesterweihe, alle Welt nannte ihn den «prete rosso», den roten Priester. Da hätte man eigentlich mehr Keuschheit und Demut in der Aussendarstellung erwarten dürfen. Das Ölgemälde ist das einzige, das von Antonio Vivaldi überliefert ist. Ein exzentrischer Aussenseiter war der venezianische Komponist trotzdem nicht. Im Gegenteil: Er war der Star, den alle liebten. Als Violinvirtuose hatte er den Ruf eines Hexenmeisters, wie später Niccolò Paganini. Als Produzent von Solokonzerten und Kammerkonzerten war er europaweit gefragt. Und in seiner Heimatstadt Venedig lieferte er als Opernkomponist und Impresario in Personalunion über Jahre hinweg die angesagtesten Shows für den grossen Karnevalstrubel. 97 Opern hat er im Verlaufe seiner Karriere auf die Bühne gebracht. Antonio Vivaldi war, wie der Biograf Siegbert Rampe schreibt, «einer der reichsten Venezianer und ganz gewiss der bestverdienende Musiker seiner Epoche».
Herr Dantone, wie lange brauchen Sie, um ein Musikstück von Antonio Vivaldi zu erkennen?
(Ottavio Dantone setzt sich ans Klavier und spielt) Hören Sie das? Klingt wie Vivaldi, nicht wahr? Ist aber von mir, improvisiert im Stil von Vivaldi. Sie sehen: Vivaldis Stil ist unverwechselbar, die Eigenheiten seiner Musik sind auf Anhieb zu erkennen.
Worin liegt das Unverwechselbare seiner Musik?
Es gibt viele Eigenheiten, zum Beispiel die ribattuta, ein typisch venezianischer Rhythmus, oder ein bestimmter harmonischer Umgang mit Septimakkorden. Man muss unterscheiden zwischen dem venezianischen Stil allgemein und Vivaldi im Besonderen. Vivaldi ist tief verankert in der venezianischen Art zu komponieren. Er arbeitet im Stil seiner Zeit und seines kulturellen Umfelds. Aber seine Musik ist eigenständiger, sie unterscheidet sich von Marcello, Albinoni und all den anderen. Vivaldi hatte mehr drauf.
An seinem Stil fällt eine packende, durchschlagende Einfachheit auf.
Vivaldi war eben kein Komponist, der musica riservata für den kleinen höfischen Kreis schrieb. Als Venezianer komponierte er für das ganz grosse Publikum. Venedig war zu Vivaldis Zeit eine touristische Metropole und reich an Opernhäusern. Aus ganz Europa reisten die Gäste an, um sich bei Musik und Theater zu vergnügen. Die Werke mussten so konzipiert sein, dass sie beim Publikum ankamen. Vivaldi war zwar durchaus in der Lage, elaborierte und tiefgründige Musik für Kenner zu schreiben, aber als Erfolgskomponist musste er vor allem den Publikumsgeschmack seiner Zeit bedienen. Und er wusste ganz genau, wie man mitten ins Herz der Musikbegeisterten trifft.
Zu seinen Stärken gehört, dass er Situationen auf den Punkt zu bringen versteht.
Ja genau. Auf den ersten Blick mag seine Musik ein bisschen banal klingen, aber bei genauerem Hinsehen merkt man, dass alles messerscharf kalkuliert ist. Mit geradezu wissenschaftlicher Präzision konstruiert Vivaldi emotionale Verläufe, genau wissend, wann der Moment ist, die Aufmerksamkeit zu bündeln, Höhepunkte zu setzen, das Publikum zum Staunen oder zum Weinen zu bringen. Es ist ein grosses Vergnügen, dieses Raffinement in den Partituren zu studieren.
Würde Vivaldi heute leben, wäre er womöglich ein ausgebuffter Action-Movie-Regisseur, der seine Konkurrenz, was Innovation und Präzision angeht, weit übertrifft.
Die Barockmusik lebt in all ihrem Reichtum von der Strategie, mehr wegzulassen als zu viel hineinzupacken, damit das Wesentliche klar hervortritt. So funktionieren auch die guten Hollywoodfilme. Vivaldi war ein Meister darin.
Zu seinen Markenzeichen gehören die extremen Kontraste, in der Dynamik, in den Farbwechseln.
Interessant ist, dass man in Vivaldis Noten gar nicht viele Dynamikbezeichnungen findet. Die Kontraste sind in der Rhetorik der Musik angelegt. Sie ergeben sich selbstverständlich aus dem musiksprachlichen Fluss. Diese Rhetorik zu verstehen, ist die Aufgabe der Musiker. Wie kontrastreich Vivaldi erklingt, hängt also vor allem von den Ausführenden ab, von ihrer Metierkenntnis und ihrer Fantasie, von ihrer Mischung aus Fachkenntnis und musikalischer Freiheit.
Barockmusik ist also immer nur so gut wie die Ausführenden?
Zu Vivaldis Zeit war das überhaupt kein Thema, weil für alle Beteiligten – Komponisten, Sänger, Musiker und Publikum – das Beherrschen der Musiksprache eine Selbstverständlichkeit war. Man spielte die Musik, wie sie gemeint war, auch wenn das meiste nicht explizit in den Noten stand. Heute sind wir in einer anderen Situation. Wir haben die Partituren als Überlieferung und müssen uns die Kontexte erschliessen. Tun wir das als Musiker nicht, riskieren wir Missverständnisse. Wenn wir die Noten nur lesen, wie sie überliefert sind, existiert die Musik noch nicht. Wir müssen etwas daraus machen, Artikulation, Phrasierung und Dynamik kreieren, Verzierungen einführen usw. Wir müssen philologisch arbeiten und die Musiksprache von innen heraus verstehen. Philologie heisst für mich nicht, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob eine VivaldiOper mit acht oder zehn Violinen aufgeführt wurde. Das ist völlig unerheblich und hing von den Aufführungsbedingungen ab. Ich würde gerne noch vor meinem Tod erleben, dass alle Musiker verstanden haben, dass Philologie sich einzig auf das Verständnis der Sprache konzentrieren muss. Aus der Musiksprache leitet sich alles ab! Man muss sie selbstverständlich beherrschen. Das ist viel wichtiger als nur buchstabentreues Notenstudium.
Hat Vivaldis Musik Schwächen?
An seinen Opern wird kritisiert, dass die Dramaturgie in der Abfolge von Rezitativ und Arie sehr schematisch sei. Da ist auch etwas dran. Vivaldi hat nur selten AccompagnatoRezitative geschrieben, und die Rezitative selbst sind harmonisch oft nicht so interessant. Die Komponisten hatten zu der damaligen Zeit Assistenten und Schüler, die ihnen bei der Ausarbeitung der Rezitative halfen. Die Arien waren eben viel wichtiger. Ich habe kürzlich Vivaldis Oper L’incoronazione di Dario für eine CDProduktion aufgenommen, und ich gehe davon aus, dass er darin die Rezitative selbst geschrieben hat. Man hört es sofort, es ist viel spannender. Aber auch in La verità in cimento gibt es harmonisch interessante Passagen. Man muss dabei immer die Rezeptionshaltung des damaligen Publikums bedenken. Die Leute hörten nur in den Arien wirklich zu und interessierten sich dabei meist nur für die allerbesten. Heute konzentrieren wir uns auf alle Bestandteile eines Werkes, wenn wir in die Oper gehen. Wir wollen die Handlung, die ja in den Rezitativen vorangetrieben wird, genau verstehen. Das stand damals nicht so im Vordergrund. Die Atmosphäre in den Theatern war eine ganz andere.
Man montierte zum Beispiel Commedia dell’arte-Zwischenspiele in die Opern, die mit dem Handlungsverlauf des Hauptwerks gar nichts zu tun hatten.
Wir haben das vor einiger Zeit bei einer Aufführung in Jesi, dem Geburtstort Pergolesis, auch einmal probiert. Man muss wissen: Das Publikum kannte damals die Geschichten, die da eingeschoben wurden. Und für die Oper gilt: Nicht die Handlung als Ganzes war das Spannende, sondern die einzelnen Momente. Man stieg bei den Emotionen umstandslos ein, ging dann aber richtig mit. Ich glaube, das Publikum war damals viel wilder. Wir gehen heute womöglich besser vorbereitet in die Oper, haben aber mehr Probleme, uns auf die Emotionen der Musik einzulassen, als Musiker wie als Publikum. Aber darum geht es: Aus theatralischen Situationen die Funken maximaler emotionaler Expression zu schlagen.
Vivaldi war ein Vielschreiber und hat wahnsinnig schnell komponiert. Ist das sein Problem?
Das war normal. Üblicherweise brauchten die Komponisten höchstens einen Monat für eine Oper, und das war schon viel! Komponieren war ein Handwerk und hatte nicht den KunstStellenwert, den es heute einnimmt.
Vivaldis Musikproduktion lief extrem hochtourig. Er war ein überaus gefragter Mann, nicht nur als Opernkomponist, sondern auch als Geigenvirtuose. An welchem Punkt seiner Karriere stand er, als er La verità in cimento auf die Bühne brachte?
Die Uraufführung fand 1720 in Venedig statt, Vivaldi war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Es war für ihn die goldene Zeit seines Erfolgs und seines Schaffens, aber auch eine goldene Zeit für die venezianische Musik insgesamt. Die Leute kamen von überall, um in Venedig Opern zu hören. Es gab einen grossen Hunger nach Musik, und die Nachfrage musste befriedigt werden. Das war eine sehr kreative und fruchtbare Zeit. Für Zürich habe ich mich zum ersten Mal mit La verità befasst, ich kannte die Oper vorher nicht wirklich. Aber was die Qualität angeht, hat sie mich nicht enttäuscht: Es ist eine sehr schöne Oper.
Eine Barockoper auf die Bühne zu bringen, heisst, eine Spielfassung zu erstellen, und da taucht natürlich die Frage auf, was erlaubt ist und was nicht. Dass die Rezitative nicht zum Allerheiligsten des Komponisten gehören, haben wir bereits erwähnt. Gegen kräftige Rezitativstriche ist also nichts einzuwenden, oder?
Das war gängige Praxis der Zeit. Das Werk wurde den Notwendigkeiten der jeweiligen Aufführung angepasst. Vivaldi selbst hat von Aufführung zu Aufführung massive Striche und Veränderungen in seinen Opern vorgenommen. Von L’incoronazione di Dario etwa existiert eine erste Version, die fünf Stunden dauerte, Vivaldi hat dann in einer zweiten Version so viel gestrichen, dass man der Handlung kaum noch folgen kann. Er hat pragmatisch auf Sängerwünsche und die Aufführungssituation reagiert.
Die Aufführung war also das Werk und nicht die Partitur.
In den Noten ist ja vieles gar nicht festgehalten. Die Musik muss in gewisser Weise für jede Aufführung durch die Sänger und Musiker neu erfunden werden.
Wir haben in unserer Zürcher Fassung am Schluss eine Arie aus einer anderen Oper eingefügt. Ist das eine Schandtat?
Auch das war üblich. Ich gebe Ihnen ein besonders krasses Beispiel: Caffarelli, einer der berühmtesten Kastraten der damaligen Zeit, mit dem Vivaldi allerdings selbst nicht zusammenarbeitete, liess sich in seinem Vertrag zusichern, dass er gleich nach der Ouvertüre und einem Rezitativ eine Bravourarie singen darf, die mit der Handlung gar nichts zu tun hat. Er liess vertraglich festschreiben, dass er diese sogenannte Kofferarie, die die Stars immer im Gepäck hatten, auf einem echten Pferd mit Helm und grossem Federbusch singen darf. So war das damals.
Lassen Sie uns über die Konvention des lieto fine sprechen, des Happyends als Pflichtschluss am Ende jeder Barockoper. In La verità in cimento wirkt dieses lieto fine unglaubwürdig und angeklebt, wie so oft. Alle Figuren treiben über drei Akte hinweg in die totale emotionale Zerrüttung, und im allerletzten Rezitativ setzt plötzlich das grosse Verzeihen ein, und es vollzieht sich die wundersame Lösung aller Konflikte.
Das lieto fine war damals Pflicht. Die Leute hätten das Theater auseinandergenommen, wenn sich am Ende einer Oper nicht alles zum Guten gewendet hätte. Manchmal wurde das lieto fine bis zum letzten Satz im allerletzten Rezitativ hinausgezögert. Aber es musste sein.
Damit man sich in den Stunden zuvor umso hemmungsloser den sündigen Themen hingeben konnte, der Untreue, der Machtgier, der Heuchelei, der Niedertracht und der erotischen Zügellosigkeit.
Das waren die eigentlich interessanten Themen! Das Finale ist, gemessen daran, der unwichtigste Moment in einer Barockoper. Auch wenn das mancher strenge Philologe kritisieren wird: Ich habe kein Problem damit, das lieto fine zu streichen.
Wir lassen in Zürich den kurzen Finalchor weg, der übrigens auch im Faksimile der Verità-Partitur fehlt.
Er fehlt, aber das heisst nicht, dass Vivaldi die Oper ohne einen Schlusschor aufgeführt hat. Man nahm dann einen Schlusschor aus einer anderen Oper oder gar von einem anderen Komponisten. Ich finde grundsätzlich, dass man alle musikalischen Entscheidungen in Abhängigkeit von der Szene treffen muss, in Bezug auf das, was man erzählen möchte. Weil dann erst die Emotionalität zünden kann, auf die es ankommt.
Es gehört zum Stil der Barockopern, dass die Dacapo-Wiederholungen der Arien mit Verzierungen versehen werden. Woher stammen die in unserer Produktion?
Normalerweise schreibe ich diese variazioni für die Sänger. Ich höre mir die jeweiligen Stimmen genau an und versuche mir vorzustellen, was für den Stimmumfang und den Charakter gut passen könnte. Aber es sind nur Anregungen. Die variazioni sind etwas Kreatives.
Könnte man sie auch jeweils aus dem Moment der Aufführung heraus improvisieren?
Schon, aber man muss dennoch etwas festlegen in der Stimmführung wie im Orchester. Oft ist die Idee, die einem spontan als Erstes einfällt, nicht die beste. Wenn man aber erreichen will, dass das Publikum an einer bestimmten Stelle zu Tränen gerührt wird, muss alles gezielt daraufhin angelegt sein. Die Möglichkeit kleiner Varianten bleibt natürlich trotzdem. Das ist wirklich eine Kunst.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren immer wieder mit Vivaldi. Langweilen Sie sich nie mit dieser Musik?
Nein, weil ich immer, wenn ich an eine neue VivaldiPartitur gehe, gespannt darauf bin, was in der Musik versteckt ist. Das will ich unbedingt herausfinden.
Und da gibt es immer etwas zu entdecken?
Immer. Was direkt in den Noten steht, ist ja nur wenig. Man muss sich mit Fantasie in die Musik hineindenken. Dann findet man immer Spannendes. Meine Meinung ist, dass es keine schlechte Musik aus dem Barock gibt. Es gibt nur schlecht gespielte Musik. Man kann als Musiker aus Mist etwas Grossartiges machen, und umgekehrt aus einem Meisterwerk Mist. Es kommt ganz auf die Musiker und die Sänger an.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 29, Mai 2015
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
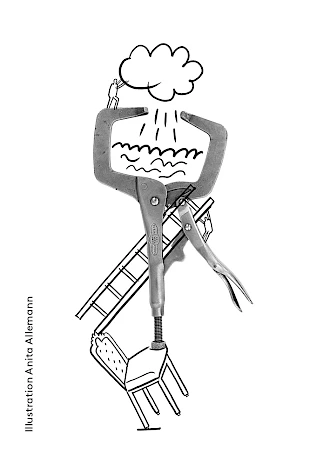
Ben Baur und Jan Philipp Gloger haben sich bei der Dekoration unserer Produktion La verità in cimento für authentische Räume einer Villa entschieden: Es gibt eine Garage (inkl. Auto), einen Flur, ein Arbeitszimmer, ein Esszimmer und ein Schlafzimmer. Diese Räume sollen total realistisch gestaltet sein: teilweise mit Holzvertäfelung, teilweise mit Marmor, teilweise verputzt, verziert mit Messingleisten, Spiegeln, Waschtischen, Terrassentüren, Gardinen, Wandleuchten…
Der Aufwand, den die Werkstätten für eine glaubhafte Authentizität leisten müssen, ist riesig. Jede und jeder im Zuschauerraum kennt die «echten» Materialien und weiss, wie diese aussehen – aber die echten Materialien können aufgrund des Gewichts und der Zerbrechlichkeit meistens nicht verwendet werden.
Riesiger Aufwand? Für die Marmorwände müssen zum Beispiel zunächst bis zu zwei Meter grosse Muster erstellt werden, bei denen die Marmorierung in Grösse und Farbe im Malsaal gemalt und dann vom Bühnenbildner für gut befunden werden muss. Das ist ein Vorgang, der sich über mehrere Arbeitstage hinzieht, in denen immer neue Entwürfe gemacht werden, bis man sich auf ein Muster geeinigt hat. Dann kommt die Herstellung: Es wird eine riesige Marmorplatte auf Stoff gemalt, die dann in Stücke geschnitten und auf Holzrahmen aufgeklebt wird. Diese Holzrahmen sehen nun aus wie zwei Zentimeter starke Marmorplatten. Diese werden mit einer vom Bühnenbildner angegebenen Fuge auf einen grossen Holzrahmen geschraubt – natürlich werden dabei die Schrauben von hinten in die «Marmorplatte» getrieben, so dass man keine Schraubköpfe in der Marmorplatte sieht. Das ist schnell beschrieben, der Herstellungsprozess zieht sich aber über Wochen hin.
Jede einzelne Marmorplatte ist letztendlich ein Gemälde, ein Kunstwerk unserer Theatermaler. Der Betrachter hält sie im Idealfall für echten Marmor. Das Kunstwerk als solches wird nur dann wahrgenommen, wenn es sein Ziel, Marmor vorzutäuschen, verfehlt, also misslungen ist. Gleiches gilt für die Holzvertäfelung, für Ziegelsteine, für Balken… Eigentlich gilt für das komplette Bühnenbild: Je besser es gebaut und gemalt ist, desto weniger wird die unglaubliche Arbeit, die dahinter steckt, wahrgenommen. Wenn man also tatsächlich die «Wahrheit» im Sinne der Echtheit und Authentizität auf den Prüfstand stellt, so komme ich zum Schluss: Im Dekorationsbau ist die Wahrheit undankbar.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 29, Mai 2015
Das MAG können Sie hier abonnieren.
La verità in cimento
Synopsis
La verità in cimento
Vorgeschichte
Mamud, Unternehmer und Oberhaupt einer wohlhabenden Familie, hat zur gleichen Zeit zwei Söhne gezeugt, den einen mit seiner Ehefrau Rustena, den anderen mit seiner Geliebten, dem Dienstmädchen Damira. Um Damira ruhigzustellen, die seiner Ehe nicht im Weg stehen soll, verspricht er ihr, den gemeinsamen Sohn in seine Familie zu holen und ihn als Erbe aufwachsen zu lassen. Das Versprechen löst er mit einer folgenschweren Tat ein: Er vertauscht die Säuglinge seiner beiden Frauen, sodass sie mit der jeweils falschen Mutter in den falschen Verhältnissen aufwachsen: Der melancholische Zelim wird vom Dienstmädchen aufgezogen, obwohl er der Spross aus Mamuds rechtmässiger Ehe ist; der aufbrausende Melindo wächst als Sohn aus reichem Hause auf, obwohl er das uneheliche Kind einer Affäre ist. 25 Jahre nach dem fatalen Kindertausch, von dem nur Mamud und Damira wissen, holt Mamud sein schlechtes Gewissen ein. Er will – koste es, was es wolle – mit dieser Lebenslüge Schluss machen.
Erster Akt
Melindos Hochzeit steht unmittelbar bevor. Er wird Rosane heiraten, die, bevor sie sich in Melindo verliebt hat, mit dessen Halbbruder Zelim zusammen war. Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen erklärt Mamud Damira, dass er die Lüge nicht länger aushält und den Kindertausch richtig stellen will. Damira ist empört und kündigt an, alles daran zu setzen, die Aufdeckung zu hintertreiben.
Zelim erscheint und klagt seiner «Mutter» Damira, wie unglücklich er darüber ist, mitansehen zu müssen, dass seine Ex-Freundin Rosane nun Melindo heiratet. Damira (die sich insgeheim nichts sehnlicher wünscht als diese Hochzeit) spielt Zelim Mitgefühl und besorgte Mutterliebe vor. Mamuds Ehefrau Rustena wiederum ist überglücklich darüber, dass Melindo heiratet. Rosane erzählt allen, wie sehr sie in Melindo verliebt ist, und stellt gegenüber Zelim klar, dass ihre frühere Liebe aussichtslos war, weil er ihr nichts bieten konnte.
Rustena erfreut sich an den Zärtlichkeiten, die das junge Paar austauscht und fordert den eifersüchtigen Zelim auf, sich doch mit seiner Ex-Freundin Rosane mitzufreuen. Zelim beklagt sein Unglück. Melindo hält Zelims Gejammer für Verstellung. In Wirklichkeit warte Zelim nur darauf, wie eine Schlange aus seinem Versteck hervorzustossen, um einen tödlichen Biss anzubringen.
Damira sucht noch einmal das Gespräch mit Mamud, um ihn davon abzubringen, den Kindertausch rückgängig zu machen. Sie erinnert ihn daran, wie er sie einst geliebt und ihr Versprechungen gemacht hat. Sie versucht, ihn zu verführen, aber er will davon nichts mehr wissen. Es kommt zum Streit.
Damira erzählt Rustena, dass Mamud einst eine Liebesaffäre mit ihr, Damira, hatte. Weil er sich noch immer schlecht fühle, dass er sie damals habe sitzen lassen, wolle er ihr nun Gutes tun und ihrem Sohn seinen Reichtum vererben. Dazu habe er sich die Lügengeschichte eines Kindertauschs ausgedacht, die Rustena auf keinen Fall glauben solle. Rustena vertraut den Worten Damiras.
Alleine schreit sich Damira ihren Frust von der Seele: Sie hasst ihre Zurücksetzung gegenüber der hohen Familie, den unseligen Kindertausch, das Leben insgesamt. Rustena wiederum ist verbittert über die Lieblosigkeit und die Untreue ihres Ehemanns. Nie habe ihr das Schicksal Freude ohne Bitternis bereitet.
In einem nächtlich traumwandlerischen Moment kommen die drei jungen Menschen Rosane, Melindo und Zelim zusammen. Rosane und Melindo spüren ihr Glück, Zelim spürt sein Unglück. Zelim erinnert Rosane daran, wie sehr sie ihn einst geliebt hat und wie nahe sie sich gekommen sind. Rosane tut das als Vergangenheit ab. Nun wird Melindo gegenüber Rosane misstrauisch: Er zweifelt sehr grundsätzlich an ihrer Fähigkeit, treu zu sein. Rosane erklärt Melindo, dass sie ihn zwar liebe, ihm aber «Addio» sage, falls er ihr mit seinen Treueforderungen die Freiheit und den Lebensspass zu nehmen gedenke.
Zweiter Akt
Mamud hat Rosane in einem vertrauensvollen Gespräch über die wahre Identität von Zelim und Melindo aufgeklärt und ihr zu verstehen gegeben, dass er Zelim als seinen Erbe einsetzen wird. Rosane ist verwirrt. Mamud rät ihr, sich an Zelim zu halten und sich von Melindo abzuwenden. Es sei keine gute Idee, zu lieben, was einem Nachteile bringe.
Rosane macht Schluss mit Melindo, der inzwischen von seinem Vater, wie Zelim auch, die Neuigkeiten seiner wahren Herkunft erfahren hat. Sie liebe Melindo zwar immer noch, aber eine Liebe ohne Aussicht auf ein angenehmes Leben sei nichts für sie. Melindo wird wütend. Zelim beginnt sich mit seiner Identität als wahrer Sohn der wohlhabenden Familie anzufreunden.
Mamud bestellt die Familie ein und verkündet offiziell, dass Melindo der Sohn von Damira ist und Zelim der Sohn von Rustena. Er erklärt Zelim zum Erben und Nachfolger in seinem Unternehmen. Der Streit unter den Familienmitgliedern eskaliert und mündet in tieftraurige Gefühlsverwirrung: Keiner weiss mehr, wer zu wem gehört. Niemand ist sich seiner Empfindungen mehr sicher.
Dritter Akt
Melindo erscheint mit einer Waffe und läuft Amok. Er fühlt sich um seine Braut, sein Erbe und seine Familie betrogen. Er hält die Ungerechtigkeit nicht aus.
Damira startet einen allerletzten Intrigenversuch: Rustena soll sich ihrem Ehemann eine theatralische Szene machen, Tränen und Wahnsinnsanfälle simulieren. Aber sie erkennt die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens.
Mamud erkennt die Katastrophe, die er mit seiner öffentlich gemachten Wahrheit ausgelöst hat, bleibt aber dabei, dass es zu Tugend und Vernunft keine Alternative gibt.
Rustena wünscht sich, in den Wäldern geboren zu sein, weit weg von allem Unglück und ihrem Schmerz.
Rosane versucht noch einmal mit einer Liebesbeschwörung an Melindo, zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
Zelim bleibt zurück. Desillusioniert. Hoffnungslos. Hochmütig.
(Die Handlung folgt der Fassung des Opernhauses Zürich und der Inszenierung von Jan Philipp Gloger.)