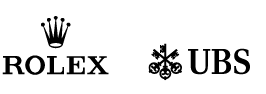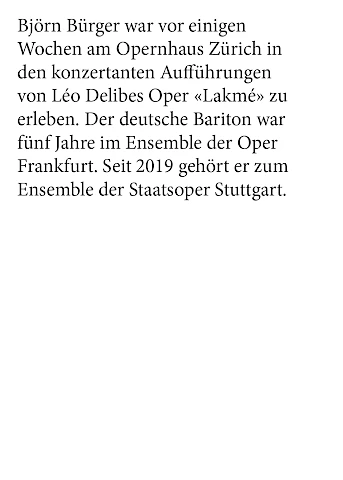Lessons in Love and Violence
George Benjamin (*1960)
Oper in zwei Teilen, Text von Martin Crimp
Schweizer Erstaufführung
In englischer Sprache. Dauer ca. 1 Std. 30 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Die Einführungsmatinee findet am 7. Mai 2023 statt.
Unterstützt von 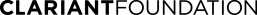
Mit freundlicher Unterstützung der René und Susanne Braginsky Stiftung
Gut zu wissen
Lessons in Love and Violence
Kurzgefasst
Lessons in Love and Violence
Der 63-jährige Engländer Sir George Benjamin gehört zu den führenden Komponisten der Gegenwart und fand vor allem für seine beiden jüngsten Opern Written on Skin und Lessons in Love and Violence weltweite Anerkennung. Benjamins Arbeiten für das Musiktheater, bei denen der englische Autor Martin Crimp sein ständiger Partner ist, stehen für einen psychologisch präzisen, klassischen Zugriff auf literarisch-dramatische Stoffe, konturenscharf entworfene Charakterstudien und eine ausdrucksintensiv plastische Orchesterbehandlung. Am Opernhaus Zürich präsentieren wir Benjamins 2018 in London uraufgeführte Oper Lessons in Love and Violence als Schweizer Erstaufführung. Der Stoff geht auf den Shakespeare-Zeitgenossen Christopher Marlowe und dessen Schauspiel Edward II. zurück, das Crimp adaptiert hat. Im Zentrum des düsteren Dramas steht der machtmüde König Edward, der die Regierungsgeschäfte und sein Volk zugunsten einer pervertierten Kunstliebe und der homoerotischen Beziehung zu seinem Günstling Gaveston vernachlässigt. Zu seinem Feind wird der ehrgeizig zur Krone strebende Heerführer Mortimer, der der Geliebte von Edwards Gattin Königin Isabella ist, Gaveston hinrichten und den König grausam töten lässt. Die Spirale der Gewalt greift schliesslich auch auf die nächste Generation, auf die Kinder von Isabella und Edward, über, die ihre Lektionen in Liebe und Gewalt gelernt haben. Lessons in Love and Violence ist eine Geschichte über die Amoral der Herrschenden, über kalte Machtgier und die Hitze des Begehrens und das Private als der wahre Kampfplatz politischer Grausamkeiten. Die Produktion bringt neben dem Komponisten weitere neue Künstler ans Opernhaus Zürich: Der feuerköpfige russische Schauspiel- und Opernregisseur Evgeny Titov, der in den vergangenen Jahren von den Salzburger Festspielen bis zur Komischen Oper Berlin für Furore gesorgt hat, gibt sein Debüt. Der israelische Dirigent Ilan Volkov, ein Experte für zeitgenössische Partituren, steht am Dirigentenpult, und die hochgehandelte, aus Trinidad stammende Sopranistin Jeanine De Bique tritt als Isabel ebenfalls zum ersten Mal am Opernhaus Zürich auf.
Pressestimmen
«… unmittelbar fesselnde, sehr theaterwirksame Bilder, frei vom üblichen abstrakten Denkfieber, wie man es oft in Inszenierungen von zeitgenössischem Musiktheater erlebt.»
NZZ, 23.05.23«Titov schafft ein Gesamtkunstwerk, in dem die Figuren stets in der richtigen Szene das passende Kostüm anhaben – oder sich passend zur Musik entblössen.»
Tages-Anzeiger, 23.05.23«Eine sehr gelungene Produktion.»
Deutschlandfunk, 22.05.23«Der israelische Dirigent Ilan Volkov hat das Geschehen jederzeit souverän im Griff, mit viel Sinn für die schillernden Klangflächen und orchestralen Farben, die Benjamin erfunden hat.»
Musik&Theater, 22.05.23«Musikalisch ist das Werk ein eindeutiger Triumph…»
Bachtrack, 22.05.23
Interview
Ringen um Lust und Macht
Die Oper «Lessons in Love and Violence» ist ein Königsdrama von shakespearehafter Wucht. Sie erzählt die Geschichte eines Königs, der sich in der Liebe zu einem Mann verliert und auf grausame Weise zu Fall kommt. Ein Gespräch mit dem Regisseur Evgeny Titov und dem Dirigenten Ilan Volkov über die zerstörerischen Energien obsessiver Liebe
In welchen Kosmos führt uns die Oper Lessons in Love and Violence?
Evgeny Titov: Der Stoff ist ein Königsdrama, dessen literarische Vorlage auf den englischen Shakespeare-Zeitgenossen Christopher Marlowe zurückgeht. Marlowe hat ein Schauspiel über Edward II. geschrieben, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts über England herrschte. Ihm wurde die Liebe zu seinem Günstling Piers Gaveston zum Verhängnis. Edward II. vernachlässigte seine Regierungsgeschäfte, wurde abgesetzt und grausam ermordet. George Benjamin und sein Textautor Martin Crimp haben nun aus diesem Stoff eine Oper gemacht, die sich auf die vier Hauptfiguren konzentriert und deren innere Dramen offenlegt.
Wer sind die Hauptfiguren?
Titov: Das sind natürlich der König, der in der Oper nur als «King» vorkommt, also namenlos bleibt, und sein Geliebter Gaveston, mit dem er sich in eine Welt der Musik und der schönen Künste zurückgezogen hat, während das Volk hungert. Gegenspieler ist Mortimer, ein ehrgeiziger Politiker, der mit allen Mitteln an die Macht will, alles Schöngeistige verachtet und Gaveston und den König grausam zu Fall bringt. Und es gibt die Königin Isabel, die mit Edward II. zwei Kinder hat, die ebenfalls in der Oper auftauchen. Sie ist ihrem Gatten emotional zugetan trotz dessen Affäre, will den Nebenbuhler aber weghaben und schlägt sich auf die Seite Mortimers. Die vier Figuren sind geprägt von obsessiver Liebe, Machtgier, Triebhaftigkeit und Gewaltbereitschaft und treffen in ständig veränderten Konfliktkonstellationen aufeinander. Sie verbeissen sich regelrecht ineinander wie Tiere.
Der Stoff ist blutig. Gaveston wird ermordet, der König zu Tode gefoltert, am Ende ereilt auch Mortimer ein grausames Schicksal. Gleichzeitig hat der Komponist George Benjamin eine ungemein feinsinnige Art, Musik zu schreiben. Wie passt das zusammen?
Ilan Volkov: Christopher Marlowes Dramenvorlage ist ein Theaterspektakel, bei dem man sich gut vorstellen kann, welche grosse Wirkung es auf einer Bühne der Shakespeare-Zeit entfacht hat. Benjamin und Crimp aber haben alles äusserlich Spektakuläre der Vorlage eliminiert. Sie interessieren sich für die inneren Abgründe der Hauptfiguren, die wechselnden Energien von Anziehung und Abstossung, Liebe, Hass und Vernichtungswille. Die Oper besteht aus sieben Szenen, die wie fragmentarische Ausschnitte eines Ganzen erscheinen, das man als Zuschauer nicht wirklich überblickt. Es geht in der Oper nicht darum, dass eine spannende Handlung von Anfang bis Ende erzählt wird. Man hat den Eindruck, das Drama hat bereits begonnen, bevor sich der Vorhang hebt, und man wird vom ersten Moment an unmittelbar hineingeworfen in das Geschehen. Die Gewalttaten selbst stehen entweder unmittelbar bevor oder sind gerade geschehen. Es gibt Vorahnungen und Ängste über schreckliche Dinge, die sich ereignen werden oder bohrendes Nachsinnen über Furchtbares, das passiert ist. Aber die Musik stellt die Grausamkeit des Stoffes nicht aus. George Benjamin lässt kein Blut im Orchestergraben spritzen. Das interessiert ihn nicht, obwohl es durchaus zwei, drei kolossale Orchesterausbrüche gibt, in denen die Türen des Orchesterklangs weit aufgerissen und alle Register gezogen werden.
Ist Lessons in Love and Violence eine Oper über die Zerstörung einer schwulen Liebe?
Titov: Es gibt keine schwule Liebe. Es gibt nur Liebe. Die Liebe ist eine so starke, offene, existenzielle Energie, dass es uninteressant ist, ob sie schwul, heterosexuell oder sonstwie ist.
Ich habe die Frage gestellt, weil es für die Entstehungszeit des Marlowe-Dramas im 16. Jahrhundert sehr aussergewöhnlich ist, dass eine Liebe zwischen zwei Männern thematisiert wird.
Titov: Ich finde, in George Benjamins Oper steht das nicht im Vordergrund. Es geht um die Macht und die Gefährlichkeit von Liebe generell. Wie weit kann sie gehen? Welche zerstörerischen Ausmasse kann sie annehmen? Die Oper blickt in die dunklen Abgründe entfesselter Liebe.
Wie tut sie das musikalisch?
Volkov: Benjamins Art zu schreiben entwickelt einen eminenten Sog, weil in der Musik alles sehr dicht miteinander verwoben ist. Aus einem motivischen Nukleus von zwei, drei Noten erwachsen ganze Szenen. Charakteristische Rhythmen sind, wenn sie sich einmal in Gang gesetzt haben, nicht mehr zu stoppen. Immerzu spinnt die Musik auf obsessive Weise Ideen fort und wendet sie um und um. Die Harmonik ist superraffiniert, variantenreich und farbig, und die Singstimmen sind organisch in sie eingebunden. Alles ist präzise auf den Punkt geschrieben, und alles hängt mit allem zusammen. Zwischen den Szenen erklingen Orchesterzwischenspiele, in denen das Geschehene musikalisch nachhallt und kommentiert wird. Die Partitur ist in ihrer Konsequenz wie sinfonische Musik gebaut. Sie erinnert mich in dieser Hinsicht an Alban Bergs Wozzeck, in dem ja auch jede Szene und jeder Akt in eine sinfonische Form gekleidet ist.
Ich erkenne in der Fähigkeit, Unaussprechliches in Töne zu fassen, auch eine gewisse Nähe zu Claude Debussys Pelléas et Mélisande.
Volkov: Das nehme ich auch so wahr. Obwohl Benjamins Personalstil unverwechselbar ist, glaubt man immer wieder Referenzen zu hören, beispielsweise auch zu englischer Musik des 17. Jahrhunderts. Wie er Gesangsensembles schichtet und dabei alle Singenden in ihrer jeweils eigenen Gefühlswelt eingesponnen sind, hat wiederum etwas von Giuseppe Verdi. Er hat das eben alles sehr genau studiert und reflektiert.
Aus George Benjamins Musik spricht also ein Bekenntnis zur Tradition. Das ist für Gegenwartskomponisten lange Zeit nicht selbstverständlich gewesen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es in der zeitgenössischen Musik verpönt, sich auf die Tradition zu berufen. Da musste das Neue auch durch neues kompositorisches Material bezeugt werden.
Volkov: Benjamin macht nichts Neues im Hinblick auf Kompositionstechniken und das kompositorische Material wie etwa Helmut Lachenmann, der Geräusche in sein Komponieren integriert hat. In dieser Hinsicht schreibt er traditionell, wenn man das so bezeichnen will. Aber er findet trotzdem zu einem musikalischen Ton, wie man ihn noch nie gehört hat. Er entwickelt Modernität von innen heraus und schafft dadurch Neues. Seine Harmonik etwa arbeitet mit zwölf Tönen, verwendet also keine Mikrotonalität oder Ähnliches, und ist trotzdem abenteuerlich und voll von neuen überraschenden Verbindungen. Gerade die Harmonik trägt stark zur dramatischen Qualität in den Opern bei.
Titov: Ich finde toll an der Musik, wie sie die emotionalen Ausnahmezustände der Figuren offenlegt. Sie ist eben nicht nur feinsinnig. Sie ist auch krass, verrückt, sinnlich, voll von «love and violence». Denn die Ausnahmezustände der Figuren sind wirklich extrem. Der König etwa ist völlig vereinnahmt von seiner Liebe zu Gaveston, muss aber regieren und Entscheidungen zum Wohl seines Volkes treffen, was er nicht tut. Gleichzeitig ist diese Liebe nur ein Teil seiner inneren Disposition. Mir kommt er so übersensibel, empfindsam und verletzlich vor, dass er zu einem normalen Königsleben gar nicht fähig wäre. Er hat keine Schutzhaut gegenüber der Welt. Er gibt sich der Poesie, der Musik und der Kunst hin, lebt in der völligen Überfeinerung aller Sinne und geniesst das Schöne bis zur Übersättigung. Das alles schwingt mit in dieser Figur. Hier wird nicht die Geschichte eines Herrschers erzählt, der sich in einen Mann verliebt hat und Probleme mit seiner eifersüchtigen, vernachlässigten Ehefrau kriegt. Die Figur ist viel, viel grösser. Diese Sehnsucht des Königs nach einem Immermehr an sinnlichen Erfahrungen ist wie eine Wunde, die sich nie schliesst.
Was für ein Typ ist auf der anderen Seite Mortimer, der Gegenspieler des Königs, der nach der Macht greift?
Titov: Er ist der rationale Politiker, der Ordnung schaffen will, weil er sieht, dass die Welt im Chaos versinkt. In seinem allerersten Satz im Stück sagt er, dass nicht die Liebe zu einem Mann das Problem sei, sondern die Liebe an sich, sie sei das Gift. Sie stiftet das Unheil durch unkontrollierbare Gefühle. In meiner Vorstellung ist Mortimer einer, der das Dekadente radikal ausmerzen und letztlich eine neue Menschheit schaffen will. Das macht ihn so gefährlich und gewalttätig.
Die Oper spielt mit einem polemischen Gegensatz zwischen der luxuriösen Welt der Schönen Künste auf der einen Seite, in der sich die Königsfamilie bewegt, und der harten Wirklichkeit des Lebens auf der anderen Seite, in der das Volk unter der Tyrannei der Herrschenden leidet, und als deren Anwalt der Rationalist Mortimer erscheint. Sympathisieren Benjamin und Crimp mit einer der beiden Seiten?
Titov: Natürlich nicht. Das Stück urteilt nicht. Beide Konzepte scheitern. Beide sind zerstörerisch, pervertiert und führen in den Untergang.
Volkov: Die gegensätzlichen Welten, die du benennst, sind zwar musikalisch durchaus angelegt, aber die Partitur ist viel zu raffiniert für Eindeutigkeiten. In ihr durchdringen und konterkarieren sich die Ebenen und Gefühlssphären ständig. Es gibt ja beispielsweise auch die Situation des Theaters auf dem Theater im Stück wie in Shakespeares Hamlet, im Königshaus werden sogenannte «Entertainments», also Abendunterhaltungen, zur Aufführung gebracht. Das sind unheilvolle Allegorien.
Aber der Titel der Oper lautet Lessons in Love and Violence. Welche Lektionen erteilt denn die Oper?
Titov: So einfach ist das nicht mit «Lektionen». Diese Oper will niemanden belehren. Das Theater ist kein Ort, der uns Antworten auf Fragen gibt. Wir erfahren nicht, wie wir uns zu verhalten haben. Was lehrt uns das Drama von Medea, die ihre eigenen Kinder umgebracht hat? Die eigenen Kinder umbringen!? Gibt es etwas Grausameres? Und trotzdem kann es sein, dass wir auf der Seite dieser antiken Heldin stehen. Im Theater machen wir Erfahrungen. Theater lässt uns in die Abgründe des Menschen schauen. Es führt uns an die dunklen Orte der Triebe, des Irrationalen und des Unbewussten. Das spüre ich auch stark in dieser Oper. Sie hat eine antikische Wucht. Mir ist bei der Vorbereitung auch aufgefallen, dass sich die sieben Szenen der Oper auch auf die sieben biblischen Todsünden der Menschen beziehen lassen, auf Wollust, Neid, Völlerei, Hochmut usw. Ich weiss nicht, ob das von Crimp und Benjamin intendiert ist, aber mir steht dieser Zusammenhang ganz klar vor Augen.
Die Szenen der Oper haben in ihrer Grundkonstellation ein ums andere Mal demonstrativen Charakter. Mortimer wird vom König in der ersten Szene alles genommen, sein Rang, sein Besitz, sogar sein Name, er wird zum toten Mann erklärt. Später ist es umgekehrt: Mortimer zwingt den König dazu, ihm die Krone zu geben. In der fünften Szene wiederum wollen Mortimer und Isabel den Königssohn dazu nötigen, Macht auszuüben. Er soll einen Wahnsinnigen töten, der behauptet, er sei der König. Die Figuren sind es, die brutale Lektionen lernen müssen.
Titov: Ja, aber das Stück ist nicht ordentlich nach Lektionen aufgebaut. Opfer-Täter-Beziehungen kehren sich andauernd um. Gerade hat einer auf Knien gefleht, im nächsten Moment fletscht er die Zähne. Zärtlichkeit und Zuneigung schlagen unvermittelt um in Gewalt und Sadismus. Auch in den erotischen Beziehungen geht es ständig um das Demütigen und Gedemütigtwerden und Schmerzlust. Das ist theatralisch natürlich ein Geschenk für die Regie.
Volkov: Auch die Musik lebt davon: Welche der verschiedenen Schichten, die in der Partitur angelegt sind, dominiert? Was ist oben, was unten? Da greift ständig eins ins andere. Und die musikalischen Motivebenen bleiben im Verlauf der Szenen immer präsent. Nichts verschwindet aus dem Stück. Auch auf der Ebene der Figuren: Der zwischen der dritten und vierten Szene getötete Gaveston beispielsweise kehrt in der sechsten Szene als Todesfigur des «Strangers», des Fremden, wieder zurück.
Titov: Ich weiss nicht, ob es viele Stoffe gibt, die so dicht und dynamisch sind im plötzlichen Wechsel extremer Emotionen. Zuschlagen. Lieben. Zuschlagen. Ohne Erklärungen. Wenn es eine Lektion gibt, die wir aus dieser Oper lernen, dann ist es die, dass die Liebe die grausamste aller Energien ist, dass sie noch gewalttätiger als die Gewalt selbst ist.
In welchem Bühnenraum spielt man dieses Stück?
Titov: Die Materie, die behandelt wird, ist tief und existenziell. Ich möchte, dass sich das auch im Raum spiegelt. Er sollte die Offenheit haben, Unerklärliches und Nichtfassbares zu beherbergen. Und er muss die richtige Temperatur haben.
Was ist die richtige Temperatur?
Titov: Glühend heiss und frostig kalt.
Es gibt bisher nur eine szenische Realisierung von Lessons in Love and Violence, das war die Uraufführung vor fünf Jahren in London durch die Regisseurin Katie Mitchell. Bei ihr spielte das Stück in einem modern eingerichteten, realistischen Bühnenbild mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und edlen Vitrinen.
Titov: Katie Mitchell und ihre Bühnenbildnerin Vicki Mortimer haben bei der Uraufführung einen möglichen Weg aufgezeigt. Wir aber wollten hier in Zürich bei der zweiten szenischen Realisierung in eine andere Richtung gehen. Wir haben nach einer Bühne gesucht, die das Surreale der Situationen zum Ausdruck bringt, dem Wahnsinn, der dem Stück innewohnt, Raum gibt und Platz lässt für Einsamkeitsabgründe der Figuren.
Hat der Bühnenbildner Rufus Didwiszus den Raum gebaut, den du dir vorgestellt hast?
Titov: Ja.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 102, Mai 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hintergrund

Ich liebe das Sonnenlicht und Klarheit in der Musik
Am Opernhaus Zürich wird mit «Lessons in Love and Violence» erstmals eine Oper von George Benjamin aufgeführt. Der 63-jährige Engländer gehört zu den bedeutendsten Komponisten der Gegenwart und wird in diesem Jahr mit dem Ernst-von-Siemens-Preis ausgezeichnet, der als Nobelpreis der Musik gilt. Thomas Meyer stellt den Künstler vor, dessen Markenzeichen eine messerscharfe Genauigkeit im Ausdruck ist
Sechzehn Jahre alt war er, ein Teenager, allerdings hochbegabt, manchen galt er als musikalisches Wunderkind. «Mein Unterricht ist nicht mehr gut genug für dich», teilte ihm damals sein Lehrer mit – und deshalb flog er 1976 mit ihm nach Paris zum berühmten Kollegen Olivier Messiaen. Von da an reiste der junge Mann ein-, zweimal pro Monat von London über den Ärmelkanal. Bei Messiaen besuchte er die Kompositionsklasse am Conservatoire, bei dessen Frau Yvonne Loriod studierte er Klavier. Zwei Jahre später beendete er seine Pariser Studienzeit mit einer virtuosen Klaviersonate, die er natürlich selber uraufführte: George Benjamin.
Bei Messiaen haben zahlreiche der bedeutenden Komponistinnen und Komponisten studiert: Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen, Betsy Jolas, Pierre Henry und Iannis Xenakis. Auch für Benjamin wurde er prägend: «Der Unterricht fand bei Messiaen zuhause statt. Die Zeit verging jeweils wie im Flug. Es war nichts Mystisches an ihm, sondern einfach eine unendliche Neugier und Liebe für die Musik. Er hat mein Hören verändert», erzählte Benjamin im Gespräch. Gemeinsam war den beiden die Liebe zur Farbe der Harmonien. Er selber war der Harmonik schon zugetan, bevor er zu Messiaen kam, aber das sei amateurhaft gewesen. «Messiaen erweiterte die Möglichkeiten und vermittelte mir zudem ein Wertgefüge: Jede Note muss genau ausgehört sein und muss sich verantworten lassen.» Man erkennt in der Klaviersonate durchaus, was er bei Messiaen gelernt hat, aber es klingt dennoch nicht nach Messiaen. Jeder Ton ist eigenständig durchhört. Messiaen bezeichnete ihn später als seinen Lieblingsschüler. Das wäre ein Ausweis, mit dem man stracks in eine Bilderbuchkarriere starten könnte. Und tatsächlich feierte Benjamin mit der Doppelbegabung als Komponist und Interpret, die bald durch das Dirigieren ergänzt wurde, früh Erfolge. Aber er war und ist auch ein Skeptiker, er misstraut den vorschnellen Lösungen. Zunächst studierte er in Cambridge bei Alexander Goehr weiter, der ihm die deutsche Tradition näherbrachte. Und langsam erst entstand ein Stück nach dem anderen, manchmal nur eines pro Jahr. Die Werkliste George Benjamins ist nicht lang, aber jedes Stück leuchtet darin wie ein geschliffener Solitär.
Zwei Regeln nämlich seien ihm wichtig, sagt er, und er gebe sie heute auch seinen Studenten weiter: Erstens, sich nicht zu wiederholen und zweitens: «clarity» – äusserste Klarheit. Diese Klarheit sei nicht kopflastig oder abgehoben, er wolle einfach, dass in seiner Musik, auch wenn sie zuweilen sehr dunkel klinge, die Strukturen hörbar blieben. «Diese Klarheit ist meine Obsession. Ich hasse graue, unartikulierte Texturen, und ich liebe das Sonnenlicht und die Klarheit in der Welt, ja es gibt sogar eine grausame Klarheit.» Seine Musik klingt komplex und doch völlig transparent – und durch Lichtmetaphern lässt sich so manches darin beschreiben. Manche Klänge wirken wie Sonnenstrahlen auf einem Klangmeer. Seine frühe Ensemblekomposition At First Light von 1982 ist denn auch von einem lichtdurchfluteten Gemälde William Turners inspiriert. Ein anderes Beispiel für diesen klaren Stil ist sein Klavierkonzert, das er schlicht als Duet for piano and orchestra bezeichnet. Schlicht ist auch die klangliche Disposition, bei der er sich nicht an der romantischen Tradition orientiert, sondern an Mozart. Die Orchesterbegleitung ist sparsam, der Klaviersatz geradezu linear. Wie ein Mozart-Konzert spricht die Musik ganz selbstverständlich zu uns. Benjamin staffelt den Klang im Raum. Alexander Goehr, der musikalische Sachverhalte einfach und präzis ausdrücken konnte, habe es auf fast naive Weise formuliert: «Mit der Musik sei es wie mit dem Zugfahren: Vorne bewegen sich die Dinge schneller als weiter weg und noch weiter weg, und dahinter scheint die unbewegliche Sonne.» Man kann die Entwicklungen, die zuweilen auf vielschichtige Weise vor sich gehen, genau verfolgen. So entsteht eine imaginative Musik, die nichts Intellektuelles an sich hat. «Selbst wenn ich komplex denke und wie im Ensemblestück Palimpsests acht, neun Schichten übereinanderlege, will ich keine Bouillabaisse. Die Klarheit verleiht der Musik Energie; die Harmonien und Polyphonien werden so deutlich. Das sei mein Job als Komponist.»
Diese Akribie aber bedeutet, dass er Musik nicht am Fliessband produzieren kann, sondern jedes Mal um neue Lösungen ringt. «Neu» nicht im Sinn eines Fortschritts. Vielmehr ist jedes Stück für ihn ein «Neuanfang» – und das sei manchmal ziemlich hart. Nach At First Light geriet er in eine Krise, wie sie vielleicht für einen jungen und früh schon erfolgreichen Komponisten typisch ist. Eine wichtige Erfahrung, denn am Ende dieser ersten Schaffensperiode suchte er nach einer Neuorientierung, studierte nochmals am Pariser IRCAM, dem Forschungsinstitut für elektronische Musik, beschäftigte sich mit Computermusik, dirigierte viel, komponierte wenig, bis er anfangs der neunziger Jahre auf seinen weiteren Weg fand.
In diesen Jahren erwarb sich Benjamin eine eiserne Arbeitsdisziplin. Häufig ist er als Interpret unterwegs, vor allem als Dirigent und weiss deshalb um die Verführungskraft dieses Jobs. «Komponieren Sie!» war der lapidare Ratschlag, den ihm Pierre Boulez einst gab. Der Franzose wusste, wovon er sprach. Es ist so einfach, sich als Dirigent zu zerstreuen (was Boulez gerne tat). Benjamin griff den Rat auf. Mittlerweile hat er gelernt, sein Temperament zu lenken. So bereitet sich Benjamin oft lange auf eine Komposition vor, macht Tausende von Skizzen und schottet sich dann für längere Zeit fast völlig ab. Ohne diese Disziplin würde er wohl immer noch wie früher tagelang brütend und auf Inspiration wartend vor dem leeren Blatt Papier sitzen. Für grosse Werke zieht er sich monate-, ja jahrelang zurück, sagt alle Dirigate und weiteren Auftritte ab. Er lässt sich Zeit, ist ungemein selbstkritisch: es falle ihm nicht leicht zu komponieren. Mit Plan geht er vor, wahrt sich aber seine Freiheit. Gerade das ist eine seiner grossen Qualitäten: die Verbindung von Temperament und Konsequenz. Er geht sehr rational vor, im Vertrauen, dass sich das Irrationale von selber einstellt; denn seine Musik soll spontan bleiben. Sein Œuvre ist relativ schmal, an seiner Musik ist kein Gramm Fett. Wo andere Komponisten mit Klängen wuchern, reduziert Benjamin sie und schleift sie zu unerbittlicher Schärfe. Was nicht bedeutet, dass sich die Klänge nicht entfalten dürften. Mit zwei Bratschen etwa kann er ein ganzes Orchester imaginieren und eine Art «Superviola» schaffen. Die Palette an Farben ist ungemein reich. Wildes Drauflosbramarbasieren aber ist nicht seine Sache, der billige theatrale Effekt erst recht nicht.
Von da her erwartete man von ihm damals um die Jahrtausendwende nicht gerade, dass er einmal Opern schreiben würde, in denen ja alles etwas effektvoller und vielleicht auch gröber gestrickt wird als in reiner Instrumentalmusik. Eine Fehleinschätzung. George Benjamin war von klein auf begeistert vom Musiktheater. Wenn er als Kind die griechischen Sagen las, habe er sie sich in Opernszenen vorgestellt. In der Schule sammelte er erste Erfahrungen, indem er Musik zu Schauspielen schrieb und sie dirigierte. Die Texte stammten mal von Shakespeare, mal von Klassenkameraden. «Das Theater liegt mir im Blut, und in gewisser Weise kehre ich mit der Opernkomposition zu meinen Wurzeln zurück», sagte er. Diese Rückkehr war nicht so leicht, denn Benjamin strebte einen eigenen Zugang zu diesem Genre an, eine Unabhängigkeit von vergangenen ebenso wie gegenwärtigen Modellen.
«Ich traf zwar etliche Regisseure, Schriftsteller, Filmemacher und Dichter, aber es kam nie über ein paar Sitzungen hinaus.» Über zwanzig Jahre suchte Benjamin nach einem geeigneten Text, bis er dem englischen Dramatiker Martin Crimp begegnete. Mit ihm zusammen konnte er der Gattung nochmals auf den Grund gehen. Das erste Stück Into the Little Hill, uraufgeführt im Dezember 2006 in Paris, markiert einen wichtigen Schritt. Es verfolgt ein neuartiges Konzept und kehrt gleichzeitig zu den Anfängen des Musiktheaters zurück, zur «Rappresentazione» der Florentiner Camerata um 1600 beziehungsweise zur Favola in Musica Claudio Monteverdis. Denn in dieser lyrischen Erzählung wird zuallererst eine Geschichte behandelt, die berühmte Sage des Rattenfängers von Hameln. «Der Pied Piper», der die Stadt zunächst von den Ratten befreit, nimmt, nachdem man ihm den Lohn verweigert, die Kinder mit. Das Stück erzählt von der Verführungskraft der Musik und formt die Sage auf berührende und eindringliche Weise um. Das geschieht mit einer Gradlinigkeit, die alle theoretischen Spekulationen über ein nicht-narratives, postdramatisches Theater beiseiteschiebt. Wir wissen zwar kaum, ob wir uns im Mittelalter oder in der Jetztzeit bewegen, aber die Handlung ist völlig klar. Nur zwei Sängerinnen, Sopran und Alt, treten auf und erzählen die Geschichte, sie singen alle Rollen, die männlichen und die weiblichen und gemeinsam auch die Menschenmenge, sie spielen sie aber nur andeutungsweise. So entsteht keine eigentliche Aktionsoper, sondern eher ein oratorisches oder episches Theater. Das war ein Neubeginn.
Im folgenden hat Benjamin diese Methode zusammen mit Martin Crimp weiter- und schliesslich vom epischen Theater weggeführt. Schon mit seiner nächsten Oper nämlich, die er wieder mit Martin Crimp entwarf, folgte er seiner Grundregel, sich nicht zu wiederholen. Hier handelt es sich um eine altprovenzalische Liebesgeschichte: Der Troubadour Guillem de Cabestany verliebt sich in die Frau seines Auftragsgebers und wird von diesem ermordet. Der Ehemann gibt seiner Frau das Herz ihres Geliebten zu essen; sie kostet es und findet, sie habe noch nie so etwas Gutes gegessen. Kurz darauf wird sie sich aus dem Fenster stürzen, während drei Engel sie mitleidlos betrachten. So grausam und kalt endet die Oper Written on Skin. Tatsächlich ist diese Musik auf die Haut geschrieben, ja in die Haut geritzt, in einer knapp und hart formulierten Tonsprache, die immer wieder die alltägliche Gewalt aufblitzen lässt. Zentral dabei: Nicht nur jeder dramatische Moment ist genau gesetzt, sondern jede Note passt auf das Wort.
Eine Erneuerung folgte auch in der bislang jüngsten dritten Oper, die nun in Zürich gezeigt wird: Lessons in Love and Violence. Vergleichbar ist die historische Verortung im Mittelalter sowie die schneidende Nüchternheit der Darstellung. Es geht um den englischen König Edward II, der von 1284 bis 1327 lebte, sich in seinen Günstling Gaveston verliebte und ihm fast uneingeschränkte Macht gewährte. Gaveston wurde hingerichtet. Edward blieb im Amt, wurde erst später nach politischen Misserfolgen abgesetzt und im Kerker auf bestialische Weise ermordet, wie die Legenden spekulieren. Crimp und Benjamin rücken nicht die Homosexualität ins Zentrum, sondern die Frage nach Liebe, Macht und Grausamkeit. Liebe und Gewalt gehörten von je her zu den zentralen Motiven im Musiktheater. Hier wirken sie von Beginn weg ineinander, auf ungewöhnliche, intime, ja auch unangenehme Weise. Wo endet bedingungslose Liebe, wo beginnt Gewalt? Diese Lessons in Love and Violence sind von grosser Eindringlichkeit. Das liegt zum einen an der Stringenz der Handlung, die auf ungemein flexible und direkte Weise erzählt wird; zum anderen an der präzisen Zeichnung der Personen. Hinzu kommt die Musik Benjamins, die wiederum äusserst sparsam und klar gesetzt ist. In dieser Konzisheit trumpft das Orchester in den Zwischenspielen mit grosser Klangschönheit auf. Die Musik erzählt mit Wendigkeit und folgt den Emotionen. Sie ist spannungsgeladen wie ein Krimi. Und sie ist singbar. Er legt Wert darauf, dass sich die Sänger ohne Forcieren und vor allem ohne das ihm verhasste Vibrato gegen den Orchesterapparat durchsetzen können und dass dabei die Details hervortreten. «Für mich ist die melodische Erfindung essenziell», sagte Benjamin. Der Melodie wohne ein geradezu ethischer Impuls inne. «Die Stimme ist die Wurzel der Musik. In einer einzelnen Linie ist, auch wenn sie nicht gross ausholt, eine unendliche Vielfalt enthalten. Die Stimme steckt voller Geheimnisse.» Dabei vermeidet er die «Zickzackmelodien» so vieler zeitgenössischer Opern – wie er überhaupt den stilistischen Klischees der Neuen Musik aus dem Weg geht. Dieser Stil sei vorbei. «Mir geht es um die Integration von Stimme und Orchester, ohne etwas zu verdoppeln.» Er habe sich, wie so viele Komponisten, mit den Möglichkeiten der Stimme anfangs zu wenig ausgekannt: Mit der Formung der Vokale, dem Finden der Töne, den Akzenten und dem Atem, ja der ganzen sängerischen Psychologie.
Demnächst steht in Aix-en-Provence eine neue Oper an: Picture a Day Like This. Es erzählt von einem schrecklichen Ereignis an einem ganz normalen Tag: Ein Säugling stirbt, und die Mutter macht sich auf die Suche nach einem Wunder, das ihm das Leben zurückgeben könnte. Dafür muss sie ein wirklich glückliches menschliches Wesen finden. Jede noch so vielversprechende Begegnung endet in einer Enttäuschung – bis sie auf die geheimnisvolle Zabelle trifft. Auch da geht es wieder um eine tiefe existenzielle Erfahrung, um Letztes.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 102, Mai 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft...

Jeanine De Bique
Jeanine De Bique ist seit einigen Jahren unterwegs zur ganz grossen internationalen Opern-Karriere. Sie singt an renommierten Bühnen von Paris bis Wien und bei den Festspielen in Salzburg und Aix-en-Provence. Am Opernhaus Zürich gibt die Sopranistin aus Trinidad und Tobago nun ihr Hausdebüt: Sie ist die Königin Isabel in George Benjamins zeitgenössischer Oper «Lessons in Love and Violence»
«Können Sie mich verstehen?» Jeanine De Bique sitzt im Tram, auf dem Weg zur Probebühne. Es wird diesmal ein road movie, per Zoom und per WhatsApp, improvisiert und in geweiteter Perspektive, vom spätmittelalterlichen England des Edward II. bis in die Karibik, die Insel Trinidad, auf der Jeanine gross wurde und sich wohl allerlei träumen liess, aber nicht, dass sie mal in einem Zürcher Tram in ein Smartphone blicken und über Isabel reden würde, die Gattin des schwulen Königs Edward, in deren Rolle sie sich für Lessons in Love and Violence gerade hineinarbeitet. «Ich weiss nicht, wie es ist, eine Königin zu sein,» meint sie, während Hausfassaden hinter der Scheibe vorbeiziehen, «ich weiss auch nicht, wie es ist, reich zu sein. Aber ich weiss, wie es ist, an etwas festzuhalten, woran ich sehr hart gearbeitet habe. Isabel hat viel zu verlieren, das ist für mich ein guter Ausgangspunkt, um in die Rolle einzutauchen.»
Und damit ist Jeanine eigentlich schon bei sich selbst, denn sie hat sehr viel erkämpft und gewonnen, seit sie und andere ihre Stimme entdeckten, auf jener Insel im karibischen Meer vor Venezuela, die nicht gerade zu den gängigen Startorten für Opernkarrieren zählt. Längst wird die Sopranistin hoch gehandelt, sie sang bei den Londoner Proms und in der New Yorker Carnegie Hall, wurde bei den Salzburger Festspielen als Annio in Mozarts Titus gefeiert und als Händels Alcina in der Pariser Oper, an die sie kürzlich als Susanna in Mozarts Le nozze di Figaro zurückkehrte. Das werden die Fahrgäste in der Tram kaum vermuten – sie sehen eine lässig gekleidete junge Frau, die so unbekümmert plaudert, als sässe sie mit mir in der Opernkantine, und mit gewissen Vorurteilen gegenüber der Karibik aufräumt, ehe sie überhaupt zum Vorschein kommen können. Zum Beispiel sei es nicht so, dass man dort nur dem Calypso fröne, dem synkopischen, tanzbaren Gesang, den sie natürlich auch beherrscht.
Sie ist, wie nicht wenige im Zweiinselstaat Trinidad und Tobago, als Christin mit dem anglikanischen Gesangbuch aufgewachsen, das die Briten, Kolonialherrscher bis 1958, mitbrachten, und in dem wiederum finden sich etliche Choräle von J.S.Bach. «Anfang dieses Monats sang ich meine erste Matthäuspassion, in Rotterdam, und fand da so viele Melodien, die ich schon als Baby kannte», sagt sie lachend, «nur mit anderem Text. In meinem Land gibt es so viel Musik, alles dreht sich darum, auch Chorvereine sind eine grosse Sache.» Dazu kam, dass ihre alleinerziehende Mutter, eine Botanikerin, Gitarre und Klavier spielte. «Wenn man so von Musik umgeben ist, müssten eigentlich alle Musiker werden, aber die eine meiner Schwestern wurde Ärztin, die andere Physiotherapeutin». Inzwischen ist sie dem Tram entstiegen, macht sich singend mit ein paar improvisierten Calypsotakten Luft, lacht und gesteht, dass sie als Jugendliche keineswegs Opernarien hörte (ohnehin hielt sich der karibische Sender, der auch Klassik spielte, nicht lange), sondern am liebsten die Kassette mit Barbara Streisands Broadway Album von 1985, «ich wusste gar nicht, was Broadway ist, kannte aber alle Lieder und Texte.» Und sie lernte Klavierspielen, das war auch eine ihrer Berufsoptionen neben Psychologin und Rechtsanwältin.
«Ich wusste nicht, was ich wollte – nur, dass ich die Pflicht hatte, sehr gut zu sein, wenigstens so gut wie möglich.» Derweil fiel beim Chorsingen ihre Stimme auf, sie sang auch solistisch, «vieles fiel mir leicht. Als ich sechzehn war, fragte mich die Gesangslehrerin an der Secondary School, ob ich nicht Privatstunden nehmen wollte, um an einem regionalen Wettbewerb teilzunehmen.» Sie hatte Erfolg. Was Oper ist, wusste sie da immer noch nicht richtig, aber Gesang sollte es sein, und für ein professionelles Studium musste sie die Insel verlassen – gen Norden, zur Manhattan School of Music. Für den Flug, für die Unterkunft musste erstmal Geld gesammelt werden, und sie brauchte ein Visum, es war eine völlig neue Welt, in die sie da geriet.
«Und es war anfangs keineswegs glanzvoll. Ich war mit 20 Jahren zwei Jahre älter als meine Kommilitonen, und ich hatte einen Akzent – natürlich bin ich mit Englisch aufgewachsen, aber wir benutzen andere Worte, und in New York klingt es wie ein Dialekt.» Hilda Harris wurde ihre Gesangslehrerin, eine afrikanisch-amerikanische Mezzosopranistin, und es war der Klavierbegleiter und Korrepetitor Warren Jones, der ihr zu ihrem ersten schulinternen Bühnenauftritt verhalf – eine Nebenrolle in Bernsteins Einakter Trouble in Tahiti – und ihre Liebe zu den Liedern Hugo Wolfs entflammte. Und Renée Fleming war es, der sie ihr allererstes Live-Opernerlebnis verdankte, mit 21 Jahren: Fleming gab 2007 ihr Rollendebüt als Violetta in La traviata an der MET.
Nun hat Jeanine die Probebühne in Zürich erreicht, meine Zoomverbindung bricht zusammen, macht nichts, wir wechseln zu WhatsApp, jetzt wird ihr Akku knapp, macht auch nichts. «This is hooorrible», singt sie fröhlich, dann höre ich sie zu einem Kollegen sagen: «Hast du ein Ladegerät?» Das passt alles ganz gut zu ihrem Leben im Transit, voller Übergänge und Ungewissheiten, aber auch voller Fäden, die nicht verloren werden, sondern neu verknüpft. Renée Fleming zum Beispiel hat später ihre junge Kollegin beraten, als die sich auf ihre Pariser Alcina vorbereitete. Aber an solche Engagements dachte Jeanine De Bique noch gar nicht, als sie 2008 einen ersten Preis bei den Young Concert Artists International Auditions errang und sich auf eine Karriere als Konzertsängerin einstellte. Bis das Theater Basel, auf Talentsuche in New York, sie nach einem Vorsingen einlud, für ein Jahr an der Nachwuchsförderung in Basel teilzunehmen. Mit Auftritten natürlich – zum Beispiel in Christoph Marthalers morbider Inszenierung der Grossherzogin von Gerolstein im Jahr 2010.
Es folgte ein Jahr Wien, und es folgte immer mehr. Kopenhagen, Montpellier… So schön das ist, kann es einen nicht auch aus der Kurve tragen? Überwältigen? Sie denkt nach. «Seit Basel hatte ich einen Agenten, mit dem ich planen konnte, der mein Guide wurde… War es überwältigend? Es war auch aufregend, und es konnte auch extrem einsam sein. Aber wirklich einsam ist man nie, es gibt so viel zu entdecken. In New York habe ich gelernt, mit allem Unvertrauten klarzukommen. Ich weiss aber noch, wie ich mich in Basel gefreut habe, ein Starbucks zu finden, das war vertraut. Und dann konnte ich mir die hot chocolate dort nicht leisten! Das war zum Weinen. Aber seitdem ist mein Leben epically different geworden», sie lacht wieder. «Als ich in Wien war, im Young Artist Program, hatte ich ein vision board, so eine Liste mit Zielen. Darauf stand: ‹Ich werde in der Oper Zürich auftreten›. Da bin ich nun. Das ist ein Wunder. Aber ob ich angekommen bin? I’m a solo female black traveller…»
Die Probe geht los, in der Pause meldet sie sich wieder. Ich möchte wissen, ob es sich in verschiedenen Ländern unterschiedlich anfühlt, ein solo female black traveller zu sein. «Ich würde sagen, man muss überall die ganze Zeit aware and alert sein, bewusst und wachsam. Es gibt noch viel Arbeit zu tun in der Gesellschaft, auch wenn Fortschritte da sind. Leontine Price ist eine, die ich bewundere. Sie und andere African American stars wurden gross in einer Epoche, die sehr schwierig war. Sie haben für uns den Weg gebahnt als schwarze Sänger. Und ich wiederum erreiche über die social networks Leute, die nicht die Möglichkeit haben, in die Oper zu gehen, die gar keine Ahnung von Oper haben, aber die berührt sind von dem, was ich mache.» Ihr folgen auf Instagram fast 30’000 Fans. «Sie können sich identifizieren mit einer, die aussieht wie ich. Das ist mir wichtiger als das grösste Opernhaus.»
Von welcher Rolle träumt sie? Aus dem Pausentrubel hat sich Jeanine in ein schattiges Zimmer zurückgezogen, auf dem Bildschirm kann ich ihr Gesicht fast nur noch in Umrissen sehen, als sie mit gedämpfter Stimme sagt: «Desdemona.» Die traditionellerweise weisse Frau, die der traditionellerweise schwarze Otello aus Eifersucht erwürgt. Bei Jeanine De Bique könnte es sein, dass das mal ganz anders endet. «Ich will positive Änderungen bewirken mit allem, was ich tue.»
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 102, Mai 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fotogalerie
Ich sage es mal so
Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Björn Bürger, der in der Oper «Lessons in Love and Violence» den Gaveston singt.Ich sage es mal so ist eine neue Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben
Fragebogen

Lauri Vasar
Lauri Vasar singt den König in George Benjamins Oper «Lessons in Love and Violence». Der perfekt deutsch sprechende Bariton war in Linz, Hannover und an der Staatsoper in Hamburg im Festengagement und tritt in den grossen Partien seines Fachs von Wagner über Richard Strauss bis zu Aribert Reimanns «Lear» an den ersten Opernhäusern in Europa auf.
Aus welcher Welt kommst du gerade?
Ich habe im April bei den Festtagen der Berliner Staatsoper als Donner und Gunther in Richard Wagners Ring des Nibelungen auf der Bühne gestanden.
Du bist König Edward II. in der Oper Lessons in Love and Violence. Was heisst es, die Hauptrolle in einer zeitgenössischen Oper zu übernehmen?
Arbeit, Arbeit und noch mal Arbeit! Ich habe mich zuhause in einer Zelle eingesperrt und Wochen darin verbracht. Raus durfte ich nur, um auf die Toilette zu gehen oder wenn der Hunger zu gross wurde.
Du kannst den Komponisten der Oper, George Benjamin, treffen. Was sagst du ihm?
Ich würde mich bei ihm für das unglaublich tolle Werk bedanken. Die Partitur ist einfach genial! Aber ein paar Fragen zu meiner Figur habe ich auch.
Welche Erinnerungen verbindest du mit Zürich?
Vor 12 Jahren habe ich am Opernhaus Zürich mit der Hauptrolle von Dmitri Schostakowitschs Die Nase debütiert. Eine legendäre Inszenierung von Peter Stein. Das war eine wunderschöne und sehr intensive Zeit! Die Zusammenarbeit mit dem Altmeister werde ich nie vergessen!
Woran merkt man, dass du in Estland geboren bist?
Wahrscheinlich an meinem charmanten estnisch-österreichischen Akzent auf britisch.
Welches Bildungserlebnis hat dich besonders geprägt?
Ehrlich gesagt, hat meine Bildung schon mit meiner Geburt begonnen, denn ich bin in einer Theater- und Musikerfamilie zur Welt gekommen. Ich habe meine ganze Kindheit an der estnischen Nationaloper verbracht, hab Geige studiert, getanzt, Kinderlieder aufgenommen, Filme gedreht und bin schon mit sechs Jahren auf der Bühne gestanden. Das alles hat mich sehr geprägt und war quasi wie eine kontinuierliche Vorbereitung für meinen späteren Weg als Opernsänger.
Welchen überflüssigen Gegenstand in deiner Wohnung liebst du am meisten?
Bei mir findet man keine überflüssigen Gegenstände. Ich bin Sternzeichen Waage mit Aszendent Jungfrau.
Welches künstlerische Projekt, das dir viel bedeutet, bereitest du gerade vor?
Die nächste Rolle, an der ich gerade arbeite: Es ist der Jochanaan in Salome von Richard Strauss.
Welches Buch würdest du niemals aus der Hand geben?
Ganz eindeutig mag ich mich da nicht festlegen. Zurzeit bin ich total von Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens gefesselt.
Was muss passieren, damit die Welt in hundert Jahren noch existiert?
Die Menschen müssen endlich aufhören so egozentrisch zu sein. Und sie müssen alle an einem Strang ziehen. Nur so können wir unseren wunderschönen Planeten retten!
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 102, Mai 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Lessons in Love and Violence
Synopsis
Lessons in Love and Violence
Szene 1
Der Militärberater Mortimer kritisiert den König dafür, dass er sich ausschliesslich der Beziehung zu seinem intimen Freund Gaveston hingibt, die Regierungsgeschäfte vernachlässigt und ein verschwenderisches Leben für Musik und Poesie führt, während das Volk hungert. Der König weist die Vorwürfe zurück und unterstellt Mortimer, nach der Krone zu gieren, seinen Platz einnehmen und seine Ehefrau Isabel besitzen zu wollen. Gaveston verlangt, Mortimer zu bestrafen und ihm alles zu nehmen, was er besitzt. Der König degradiert und enteignet Mortimer und erklärt ihn zu einem Niemand.
Szene 2
Mortimer kehrt an den Königshof zurück und konfrontiert die Königin und ihre beiden Kinder mit Menschen aus dem Volk, die er «Zeugen» nennt. Sie berichten von Brandschatzungen, Mord und schreiender Ungerechtigkeit im Land und machen Gaveston dafür verantwortlich. Sie beklagen, dass eine musikalische Nacht am Hof mehr koste als ein ganzes Jahr ihrer Arbeit. Königin Isabel erklärt, es gebe keinen Zusammenhang zwischen der Arbeit des Volkes und der Musik am Hof. Sie lässt sich einen Becher mit Essig reichen und löst darin demonstrativ eine der unermesslich wertvollen Perlen auf, die sie trägt. Sie rechnet den Zeugen vor, dass sich gerade der Wert von 14 Zimmern und der ganze Wintervorrat an Holz für einen Menschen aus dem Volk in Nichts aufgelöst habe. Die Schönheit der Perle aber liege nicht in ihrem Geldwert. Sie lässt die Zeugen hinauswerfen. Isabels Kinder haben die Szene aufmerksam beobachtet. Mortimer und Isabel fassen den Entschluss, Gaveston zu töten.
Szene 3
Im Zuschauerraum warten Gaveston und der König auf den Beginn einer Theatervorstellung. Der König bittet Gaveston, ihm die Zukunft aus der Hand zu lesen. Gaveston sieht Unheil auf den König zukommen und dass das Leben beider untrennbar verbunden ist. Isabel erscheint mit dem Publikum und bittet Gaveston, neben ihr Platz zu nehmen. Die Darbietung beginnt: Das biblische Klagelied Davids auf seinen ermordeten Freund Jonathan wird aufgeführt. Gaveston ist zu Tränen gerührt. Mortimer erscheint, um seinen Besitz zurückzufordern und Gaveston vor aller Augen abzuführen. Der König fordert vergeblich die Verhaftung Mortimers und die Verschonung Gavestons, aber keiner hört auf seinen Befehl.
Szene 4
Der König und die Königin finden keinen Schlaf. Er liest einen Brief, in dem geschildert wird, unter welch brutalen Umständen man seinen Geliebten Gaveston ermordet hat. Isabel sucht die Nähe des Königs. Sie fragt ihn, warum er einen Menschen liebe, den alle Welt hasst. Er antwortet, weil der ihn mehr geliebt habe als die ganze Welt. Der König wirft Isabel vor, sie verberge ihre Gefühle und habe sich von ihm abgewandt. Isabel betont, dass sie nie etwas vor ihm verborgen habe, nicht ihren Körper, nicht ihre Meinung, nicht ihre Liebe. Der König kündigt an, sich an Mortimer für den Tod Gavestons zu rächen, ihn zu vierteilen, jeden Mitwisser zur Strecke zu bringen und ganze Städte in Blut zu baden. Isabel beschliesst, den König zu verlassen und ihren Sohn zu Mortimer zu bringen. Nur der könne ihn schützen. Der König liest weiter in dem Brief.
Szene 5
Mortimer und Isabel fragen den Königssohn, ob er sich einen Hund wünsche, den sie ihm kaufen könnten. Sie erklären ihm, dass der König nicht mehr in der Lage sei, sein Amt auszuüben. Der Sohn soll den Platz des Vaters einnehmen, sie würden ihn dabei beraten. Aber vorher müsse er beweisen, dass er das Volk auch beschützen kann. Ein Verrückter wird hereingebracht, der behauptet, seine Katze habe ihm gesagt, dass er der wahre König sei. Mortimer verlangt vom Königssohn, den Verrückten für diese Anmassung zu bestrafen. Der aber plädiert für Gnade, weil er sieht, dass der Mann verrückt ist. Vor den Augen des Kindes erwürgt Mortimer nun den Verrückten, während Isabel ihren Sohn zwingt, zuzusehen. Nach der Mordtat fragt der Königssohn, ob sein Vater im Gefängnis sitze. Isabel schickt ihn weg und spricht anschliessend mit Mortimer darüber, wie er dem König die Krone abnehmen will.
Szene 6
Mortimer besucht den König im Gefängnis, um ihn vor Zeugen zum Verzicht auf die Krone zu bewegen. Der König halluziniert Trommeln. Er bekennt, ein schlechter Herrscher gewesen zu sein. Er will seinen Sohn sehen. Mortimer besteht auf der Herausgabe der Krone. Der König gibt sie ihm. Mortimer und die Zeugen verlassen das Gefängnis mit der Krone.
Ein Fremder erscheint im Gefängnis. Der König ahnt, dass er gekommen ist, um ihm den Tod zu bringen. Als der Fremde ins Licht tritt, erkennt er in ihm Gaveston. Der Fremde bestreitet das und erklärt, der König wisse, wer er sei und kenne seine Mission. Der König will wissen, auf welche Weise er sterben wird. Der Fremde liest ihm aus der Hand und erklärt: «Der Faden ist gerissen. Du bist bereits tot.»
Szene 7
Isabel ist von ihrem Sohn, der jetzt der neue König ist, zu einer Theateraufführung eingeladen worden. Die Königin will wissen, was gespielt wird. Der junge König antwortet, es gehe um eine Frau und einen Mann, die einen König ermordet und das Kind der Frau auf den Thron gesetzt hätten. Aus der Tiefe der Erde halle aber die Höllenqual des Vaters herauf. Isabel fragt angstvoll, wo Mortimer sei. Der junge König erklärt, dass ihm keine Gnade vergönnt sei. Der Name seines Verbrechens werde ihm in den Körper geritzt und, wenn er den gelesen habe, würden ihm die Augen ausgestochen. Der Vorhang hebt sich.