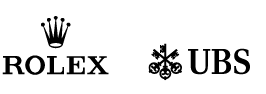oper für alle digital:
Die Csárdásfürstin
Am 25. September haben wir die Premiere von Die Csárdásfürstin live übertragen. Die Aufzeichnung konnten Sie hier noch bis zum 27. September um 24.00 Uhr anschauen.
Der deutsche Regisseur Jan Philipp Gloger will mit seiner Interpretation von Emmerich Kálmáns Csárdásfürstin beweisen, dass die vermeintlich altmodische Operette durchaus ein Genre ist, dem man mit modernen Inszenierungsideen und aktueller Gesellschaftskritik begegnen kann. Glogers Inszenierung spielt auf einer Luxusjacht, auf der eine Clique von Superreichen um den Globus reist und sich die Feierlaune von den Krisen der Welt nicht verderben lassen will. Die Entstehung der Csárdásfürstin fiel zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammen mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Kálmán musste die Vollendung seiner Operette wegen des Kriegs unterbrechen, die Uraufführung fand 1915 in Wien statt. Die Heiterkeit im Angesicht einer heraufziehenden Katastrophe und der Tanz über dem Abgrund sind deshalb ein zentrales Thema des Stücks: «Wo man tanzt und küsst und lacht, pfeif’ ich auf der Welt Misere», singen die Protagonisten zu Beginn, und die Liebe wird zum privaten Rettungsanker vor dem Weltuntergang. In unserer Premiere singt Annette Dasch die aus kleinen Verhältnissen kommende Varietékünstlerin Sylva Varescu, und Pavol Breslik versucht sie in der Partie des Fürstensohns Edwin mit Tenorschmelz und Geld für sich zu gewinnen.
Oper für alle digital wird präsentiert von 
Wir danken unserem Infrastrukturpartner Telecom ![]()
Besetzung
Lorenzo Viotti Musikalische Leitung
Jan Philipp Gloger Inszenierung
Franziska Bornkamm Bühnenbild
Karin Jud Kostüme
Martin Gebhardt Lichtdesign
Tieni Burkhalter Video
Janko Kastelic Choreinstudierung
Melissa King Choreografie
Claus Spahn Dramaturgie
Annette Dasch Sylva Varescu
Pavol Breslik Edwin
Spencer Lang Boni
Rebeca Olvera Stasi
Martin Zysset Feri
Jürgen Appel Kiss/Fürst
Schiffscrew/Tänzer*innen:
Gina Marie Hudson
Eva Zamostny
Maria Lazo
Ulrike Ahrens
Olivia Limina
Stefan Schmitz
Christopher Hemmans
Robert Johansson
Adrian Hochstrasse
Matteo Vigna
Philharmonia Zürich
Chor der Oper Zürich
Chorzuzüger
Statistenverein am Opernhaus Zürich
Die Csárdásfürstin

Weisst du, wie lang noch der Globus sich dreht, …ob es morgen nicht schon zu spät?
Emmerich Kálmáns «Csárdásfürstin» ist mehr als eine leichtfüssige Operette. Entstanden zu Beginn des Ersten Weltkriegs, erzählt sie auch von einer grossen Krise. Ein Gespräch mit dem Regisseur Jan Philipp Gloger kurz vor der Premiere im September 2020 über eine schwierige Inszenierungs-Gratwanderung zwischen Witz und Katastrophe, grossen Gefühlen und Zeitkritik.
Jan Philipp, eigentlich hätte unsere Premiere von Emmerich Kálmáns Csárdásfürstin im April diesen Jahres stattfinden sollen. Dann kam die Corona-Pandemie und hat alle Pläne über den Haufen geworfen. Jetzt wird sie, wenn alles gut geht, am 25. September Premiere haben. Die Entstehungsgeschichte dieser Neuproduktion ist so abenteuerlich wie die Zeit, in der sie erarbeitet wird.
Das kann man so sagen. Wir waren nach drei Probenwochen gerade zum ersten Mal durch das Stück und haben – ohne Witz – an einem Freitag, dem 13. an der letzten Szene und der Textzeile gerarbeitet «Weisst du, wie lang noch der Globus sich dreht, ob es nicht morgen schon zu spät», als der Intendant auf der Probebühne erschien und wegen Corona alle auf der Stelle nach Hause geschickt hat. Die Wirklichkeit war in diesem Moment noch absurder und theatralischer als die Operette selbst. Es war anschliessend in der Phase des strengen Lockdowns fraglich, ob die Produktion überhaupt je zu Ende geprobt werden kann. Aber das Opernhaus hat dann mit den ersten Lockerungen Anfang Juli die Künstler wieder zusammentrommeln und zehn Probentage möglich machen können. In dieser Phase haben wir die Inszenierung szenisch zu Ende gearbeitet und an die Corona Bedingungen angepasst. Die Endproben, in denen alles zusammengefügt wird, werden nun sehr gedrängt im September stattfinden auf einer Spielplanposition, auf der eigentlich die Wiederaufnahme der Csárdásfürstin geplant war, die nun aber zur Premiere wird. Organisatorisch war das alles hochkompliziert, aber wir sind natürlich wahnsinnig froh, dass wir das Stück zeigen können. Gerade weil es so gut in diese Zeit passt.
Was bekommt denn das Publikum in deiner Inszenierung geboten, den vollen Operettenspass oder nur ein Corona-Notprodukt?
Hoffentlich eine Menge Operettenspass. Aber wir mussten die ursprüngliche Inszenierung wegen der Corona-Restriktionen schon verändern. Operette lebt von Opulenz, zieht alle theatralen Register – und Corona steht dem im Weg. So wird etwa der Chor szenisch nicht auf der Bühne anwesend sein. Er ist nur musikalisch präsent in Form der Live-Zuspielungen, für die man sich in Zürich entschieden hat, und die natürlich auch das Orchester betreffen. Allerdings sind unsere acht Tänzerinnen und Tänzer weiterhin dabei, die alle musicalgeschult sind und auch singen können. Sie dürfen ohne Abstand szenisch agieren, weil sie eine sogenannte Infektionsgruppe bilden, die das Schutzkonzept des Opernhauses als Möglichkeit vorsieht. Abgesehen von diesen Infektionsgruppen, zu denen sich auch die beiden Hauptdarstellerpaare freiwillig zusammengetan haben, werden wir auf der Bühne Abstand halten, was bei der Operette, die ja stark von Körperlichkeit und Erotik lebt, nicht ganz leicht fällt. Bei der Bühne, den Kostümen und der konzeptionellen Grundanlage der Inszenierung allerdings können wir alles so realisieren, wie es ursprünglich geplant war, mal abgesehen davon, dass das Opernhaus – weil Ulf Schirmer aus Termingründen absagen musste – ganz kurzfristig einen neuen Dirigenten engagiert hat, nämlich Lorenzo Viotti, der im Juli dazukam und mit viel Lust und Ideen wie ein Wirbelwind in die Produktion eingestiegen ist.
Konkret gefragt: Was geht szenisch in dieser Csárdásfürstin? Geht tanzen?
Ja, das ist möglich, aber nur innerhalb der jeweiligen Infektionsgruppe, bei den Solisten also nur mit dem Partner. Partner ja, Partnertausch nein – das ist doch ein interessantes Corona-Motto für eine Operette.
Anfassen?
Jenseits der Infektionsgruppen nein. Aber wir tricksen manchmal mit desinfizierten Handschuhen.
Küssen?
Verboten.
Empfindest du die Corona-Einschränkungen als Amputation der Kunstform Theater?
Ja, klar. Wir lassen uns zwar auf die Bedingungen ein, um uns über eine schwierige Zeit hinwegzuretten, aber das kann kein Dauerzustand sein. Natürlich müssen Regisseure immer irgendwie mit der Endlichkeit von künstlerischen Ressourcen klarkommen, aber dass die Einschränkungen ausgerechnet in die Körperlichkeit des Theaterspiels eingreifen, ist schwer auszuhalten. Ich komme ja vom Schauspiel, meine Mission ist die grösstmögliche Lebendigkeit des szenischen Spiels! Der steht die Corona-Pandemie so feindlich entgegen wie in keiner anderen Kunstform. Wichtig ist aber auch: Meine szenischen Möglichkeiten mögen eingeschränkt sein, meine Lust, eine pralle Operette auf die Bühne zu bringen, ist es nicht.
Du hast gesagt, das Stück passe sehr gut in unsere Zeit. Worin besteht denn die Relevanz dieser Geschichte für uns heute? Die Handlung spielt in den späten Tagen der österreichisch-ungarischen Monarchie, lebt vom Standesunterschied zwischen einem hochwohlgeborenen Grafen und einer Varieté-Chansonette, beschwört Balkan-Folklore und walzertrunkene Wien-Seligkeit.
Das Stück erzählt von einer Gesellschaft, die notorisch über ihre Verhältnisse lebt. Die Akteure ignorieren die Zeichen einer drohenden Katastrophe und gehen fröhlich feiernd über sie hinweg. Die Csárdásfürstin ist bei aller guten Laune ein Krisenstück. Emmerich Kálmán hat diese Operette unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs zu schreiben begonnen in einem Moment, in der ein ganzer Kontinent optimistisch gestimmt war, sich selbst geradezu überdreht gefeiert hat, um dann blauäugig in die Kriegskatastrophe zu steuern. Diese Situation ist dem Stück tief eingeschrieben.
Kálmán musste die Komposition wegen des Kriegsausbruchs unterbrechen. Die für 1914 vorgesehene Uraufführung wurde abgesagt, weil die Theater vorübergehend geschlossen waren. Er hat das Stück nach Kriegsbeginn zu Ende komponiert und im zweiten und dritten Akt mit den Texten und der Musik auf die aktuelle Stimmungslage reagiert.
Genau. Deshalb tauchen in der Csárdásfürstin Zeilen auf wie «Mag die ganze Welt versinken, hab ich dich» oder «Hurra, man lebt ja nur einmal, und einmal ist keinmal». Das Stück weiss um die nahende Katastrophe, überspielt sie aber und thematisiert gleichzeitig die Verdrängung. Sorglos über die Verhältnisse zu leben, ist für mich ein markantes Kennzeichen unserer Gegenwart. Und die Pandemie lehrt uns jetzt, dass solche Sorglosigkeit völlig unangemessen ist angesichts der globalen Probleme, denen wir uns gegenüber sehen. In der Csárdásfürstin wird alles Krisenhafte vom Tisch gewischt, wenn Graf Boni singt «Ganzes Dasein ist ein Schmarren, Freunderl sei gescheit, heut’ in fünfzig Jahren leben andere Leut’». Das heisst doch nichts anderes als: Lasst uns jetzt leben und nicht an zukünftige Generationen denken. Das ist genau das, was Greta Thunberg und ihre Bewegung den politisch Handelnden vorwerfen. Zur Entstehungszeit der Csárdásfürstin war die Katastrophe der Erste Weltkrieg, heute werden wir von Pandemien heimgesucht, an deren Ausbruch die Zivilisation ja nicht ganz unschuldig ist. Es schmelzen die Polkappen, die Ozeane sind vermüllt, mächtige Männer veranstalten politischen Irrsinn, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, ein entfesselter Finanzkapitalismus entzieht sich der gesellschaftlichen Verantwortung usw. Als wir uns das Inszenierungskonzept ausgedacht haben, gab es Corona natürlich noch nicht.
All diese Themen halten Einzug in deine Inszenierung?
Wir hatten die Idee, die Csárdásfürstin als eine Kreuzfahrt in den Untergang zu erzählen. Unser Schiff ist eine Luxusjacht, auf die sich Superreiche wie auf eine Inselder Seligen zurückgezogen haben. Sie verschliessen die Augen vor den Anzeichen der Katastrophen, von denen sie umgeben sind, und sie überspielen mit Csárdás- und Walzerschwung auch ihre persönlichen Beziehungskatastrophen. Denn natürlich wird die Csárdásfürstin, wie jede Operette, getragen von Liebesgeschichten. Auch im Privaten agieren die Hauptfiguren mit einer Haltung der Verdrängung, die zu konfliktreichen Verstrickungen führt.
Man denkt unweigerlich an die Titanic, die zwei Jahre vor der Entstehung der Csárdásfürstin gesunken ist.
Unser Schiff ist zwar auch dem Untergang geweiht, aber es ist, wie gesagt, eine Luxusjacht, die für enge Räume sorgt, in denen die Konflikte aufeinanderprallen. Es ist ein Rückzugsort vor der Wirklichkeit, der aber von der Katastrophe eingeholt wird. Dem Stück ist vor dem letzten Drittel ein Bruch einkomponiert. Wenn Edwin und Silva ihr schönes Duett singen «Weisst Du es noch? Denkst Du auch manchmal der Stunden? Süss war der Rausch, der uns im Taumel umgab!» ist klar, dass zwischen den beiden, aber auch was die Weltlage angeht, nichts mehr so ist, wie es vorher war.
Das klingt, als ob in deiner Lesart aus der leichten Operette ein bleischweres Problemstück würde.
Man kann auch auf komödiantische Weise Katastrophisches thematisieren, kann im besten Fall das Lachen in den Schrecken kippen lassen und mit den Mitteln der Überzeichnung arbeiten. Von denen lebt ja die Operettenform. Und es wird schon alleine deshalb kein Problemstück, weil Operetten nicht moralisch sind. Wenn sie gut gemacht sind, haben sie im Gegenteil etwas diabolisch Verführerisches: Man hat als Zuschauer Spass an dem moralisch zweifelhaften Rausch, den sie entfachen. Man erwischt sich dabei, wie man sich im Sog der eingängigen Musik selbst erfassen lässt von der Sorglosigkeit und der Verantwortungslosigkeit der Operette.
Ist die Operette noch eine zeitgemässe Form des Musiktheaters?
Sie steht nach wie vor unter dem Vorbehalt, verstaubt zu sein, und ich muss zugeben, dass ich auch zuerst an meinen Grossvater und seine Langspielplatten mit den Operettenmelodien denke. Aber gleichzeitig besitzt die Operette als Mischform des Musiktheaters eine Offenheit, die sie für unsere Gegenwart sehr interessant macht. Im Schauspiel ist es ja auch üblich, Sprechtexte mit Gesang oder Instrumentalmusik zu kombinieren, ähnlich wie es die Operette tut, und da ich als Regisseur viel im Schauspiel arbeite, ist mir eine Form, die mit Versatzstücken spielt, sehr nahe.
Die Csárdásfürstin ist deine erste Operette. Hattest du Respekt vor der Form?
Ich habe mich schon erst einmal schwer damit getan, das Angebot anzunehmen. In der Operette treffen Gesang und anspruchsvolle Musik auf Dialoge, Tanz und Unterhaltung. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach, denn man kann sich um die Anforderungen nicht herumdrücken, man muss das Metier auch bedienen. Die Operette funktioniert nicht ohne Tanzsszenen, Dialogwitz, das Wechselspiel von wahrhaftigem Gefühlsausdruck in den Gesangsnummern und ironischer Leichtigkeit im Spiel. Ich habe mich gefragt, ob ich dem gerecht werden kann, gleichzeitig hat es mich natürlich gereizt, zumal die Csárdásfürstin eine richtig saftige Operette für den Einstieg in das Genre ist, sozusagen ein Klassiker. Wenn schon, dann gleich richtig, habe ich mir schliesslich gedacht – und zugesagt.
Wie muss man Operette machen, damit sie nicht verstaubt wirkt?
Ich finde es wichtig, die Stoffe aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Das heisst aber nicht, dass man sie im Setting ihrer Zeit erzählen muss. Als Theatermuseum funktioniert die Operette nicht. Sie hat immer stark auf ihre Zeit reagiert, und deshalb muss sie auch auf unsere Gegenwart reagieren. Und diese Anknüpfungspunkte gibt es: Eines meiner Lieblingsthemen im Theater ist die Theatralisierung unserer modernen, medial geprägten Wirklichkeit. Überall wird performt und die Grenzen zwischen Wahrheit und Fake, zwischen echten und dargestellten Gefühlen verschwimmen. Das findet in der Operette eine spannende Entsprechung, denn die Operette ist sich ihrer Theatralität immer sehr bewusst.
Wie stark ist das Stück bearbeitet, um der Inszenierung szenische Plausibilität zu verleihen?
An einigen Stellen haben wir schon stark in die Geschichte eingegriffen. Die Dialoge sind sehr ausführlich und mitunter auch ein bisschen banal. Ich sehe darin Gebrauchsdramatik, mit der man eher frei umgehen kann. Wir haben die Dialoge zwar gekürzt und verändert, uns aber so weit wie möglich am Original-Sprechtext orientiert. Ich finde die Reibung zwischen einer veralteten Sprache und modernen Figuren im Theater immer produktiv. Man geht von dem originalen Text aus und probiert, wie man ihn heutig und direkt auf die Bühne bringen könnte. Die Künstlichkeit und die Überzeichnung, die der Operette in den Musiknummern zu eigen ist, darf sich dabei nicht in den Dialogen fortsetzen. Sonst hört man nämlich nicht mehr zu und wartet nur noch auf die nächste Musiknummer. Aber die Figuren darf man durch die Veränderungen natürlich nicht verlieren. Die müssen in ihren Konstellationen, Prägungen und Konflikten erhalten bleiben, genau wie die Musik, die in unserer Inszenierung, abgesehen von wenigen Takten, vollständig erklingt. Wir haben hier und da mal eine Nummer umgestellt, aber sonst alles gelassen, wie es geschrieben ist.
Manche Texte in der Csárdásfürstin sind nicht mehr besonders zeitgemäss. Ist das ein Problem?
Das ist noch sehr vorsichtig formuliert. Man kann ganz offen sagen, dass manche Texte ungeheuer sexistisch sind. Das waren sie damals, und das sind sie heute erst recht. Zeilen wie «Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht» oder das gönnerhafte «Die Mädis, die Mädis vom Chantat, die nehmen die Liebe nicht so tragisch.» sind von Kálmán und seinen beiden männlichen Textdichtern aus einem ganz unbekümmerten patriarchalischen Chauvinismus heraus geschrieben. Man kann diesen Sexismus nicht rausstreichen, also muss man ihn thematisieren. Die Strategie muss sein, ihn in seiner Unappetitlichkeit und seinem herabwürdigenden Gestus blosszustellen. Wir versuchen zu zeigen, welche Spuren der schlechte Herrenwitz hinterlässt, und wie leicht der frivole chauvinistische Ton ins Unangenehme kippt. Der Sexismus ist für mich Teil der gleichen Ignoranz und Verantwortungslosigkeit, mit der die Csárdásfürstin-Figuren auch auf die Probleme der Welt herabblicken.
Im Stück wird auch in einer Nummer der «Zigeuner» besungen, der seine Geige nehmen soll. Ein grosser Lebensmittelkonzern hat gerade den Namen «Zigeunersauce» für nicht mehr zeitgemäss erachtet und sein Produkt umbenannt. Wie gehst du damit um?
Wir haben den Text geändert. Das Wort «Zigeuner» kommt in unserer Version nicht mehr vor, ohne dass grössere Eingriffe nötig waren. Es steht nun mal für die Diskriminierung der Sinti und Roma, und wer es übernimmt, läuft Gefahr, diese Diskriminierung fortzuschreiben. Andererseits finde ich sehr wohl, dass man auf dem Theater diskriminierende Klischees nutzen darf, wenn man sie bewusst thematisiert und sie dadurch der Kritik überantwortet, wie wir es in unserer Inszenierung auch tun. Bei uns gibt es beispielsweise auch eine von Edwin inszenierte Südseehochzeit, in der eine Tänzertruppe den reichen Gästen eine fragwürdig touristische Südseeromantik vorspielt. Wenn wir zeigen wollen, wie eine weisse Oberschicht die Welt ausbeutet, gehört auch dieser unangenehme, falsche Exotismus dazu. Man muss die Klischees eben bis zur Kenntlichkeit entstellen. Dazu fordert die Operettenform immer wieder heraus.
Läuft man dann nicht Gefahr, sich über die Operette lustig zu machen?
Natürlich nicht! Die Operette macht sich ja schon über sich selbst lustig. Sich von etwas ironisch zu distanzieren, das selbst mit Ironie operiert, geht ja gar nicht. Man muss in das Material einsteigen und dazwischen kommen. Das ist das Tolle an der Operettenform, dass die Figuren und Situationen immer von einem starken Bewusstsein für die Theatralität und das Spielerische ihres Daseins getragen sind. Wir haben es in der Csárdásfürstin mit Typen zu tun, die fast schablonenhaft von ihrem sozialen Rollenspiel geprägt sind, Edwin als ewiger Sohn eines reichen, hochgestellten Vaters, Sylva als die Chansonette, die aus einfachen Verhältnissen kommt und bei ihren Auftritten zum Star avanciert, oder der gealterte Bohemien und Playboy Feri Bacsi, der weinselig und vergangenheitstrunken die Welt betrachtet.
Lassen sich denn den altmodischen Liebesbeziehungskonflikten moderne Aspekte abgewinnen?
Ich finde die gar nicht so altmodisch. Eine Mehrklassengesellschaft kennen wir doch heute auch. In den gesellschaftlichen Verhältnissen unserer Tage, in denen die Schere zwischen Arm und Reich immer grösser wird, verlaufen doch auch Liebesgeschichten zwischen einem gesellschaftlichen Oben und Unten. Mich interessieren solche gesellschaftlichen Aspekte von Beziehungen auf dem Theater immer mehr als privatpsychologische, weil man sie viel besser beschreiben und darstellen kann. Stasi, Edwins Verlobte, die in unserer Inszenierung bereits mit ihm verheiratet ist und in einer schweren Ehekrise steckt, antwortet auf die Frage ihres Gatten, ob sie ihn noch lieb habe: «Zum Zusammenbleiben wird es wohl reichen.» Das ist doch ein ungeheuer moderner Satz. Das kennen wir doch aus dem wirklichen Leben: Es wird weggeguckt, man geht die Beziehungsprobleme nicht an und arrangiert sich. Alle Figuren in der Csárdásfürstin sind geprägt von einer gewissen Unbeweglichkeit. Sie haben nicht die Kraft, sich aus ihren Verhältnissen zu befreien.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier abonnieren.
Trailer Die Csárdásfürstin
Operette in drei Akten von Emmerich Kálmán (1882-1953) Libretto von Leo Stein und Belá Jenbach
Volker Hagedorn traf 2020...

Annette Dasch
Annette Dasch hat ein Faible für die Operette, weil sie ihrer schauspielerischen Begabung so entgegen kommt. Wie sehr die an den ersten Häusern singende deutsche Sopranistin ihre stimmlichen Qualitäten mit konturenscharfer Charakterdarstellung zu verbinden weiss, hat sie dem Zürcher Publikum schon 2017 gezeigt, als sie mit grossem Erfolg die Hure Jenny Hill in Brecht/Weills «Aufstieg und Untergang der Stadt Mahagonny» gab.
«Mir ging das Herz auf», sagt Annette Dasch am Telefon über die erste Probe zur Csárdásfürstin, die in Zürich nach drei Monaten Zwangspause stattfand, im Juni. Da habe sie gemerkt, was ihr wirklich fehlte. Nicht das Auftreten und der Applaus, wie viele vermuteten. «Nein, das Miteinander im Probenraum! Einfach zur Arbeit gehen und mit anderen zusammen sein und mich freuen, was die anbieten, was entsteht, an Auseinandersetzungen, an Humor, nach so langen Wochen im Garten mit immer
denselben drei Gesichtern…» Wobei die ihr sehr lieb sind, ihr Mann und ihre Kinder, und es ihr geholfen hat, «von Tätigkeit zu Tätigkeit zu leben: Jetzt muss Frühstück gemacht werden, jetzt lese ich mal wieder Jim Knopf vor.» Doch es kamen auch viele Gedanken.
Dass die Csárdásfürstin das richtige Stück für eine seltsame Zeit sein könnte, zeichnete sich schon an jenem sonnigen Rosenmontag ab, als ich die Sopranistin zum ersten Mal traf, eine hochgewachsene, strahlende Frau mit lockiger Löwenmähne. Regisseur Jan Philipp Gloger hat im Spiegelsaal dem Ensemble sein Konzept für die Operette erläutert, die Emmerich Kálmán vor dem Ersten Weltkrieg zu komponieren begann und im Krieg vollendete. Fünf Megareiche werden per Jacht in die Klimakatastrophe schippern, und Sylva Varescu, die «Csárdásfürstin», als besseres Escort Girl mit an Bord gehen… Einen Tag nach diesem Treffen meldete die Schweiz ihren ersten Covid-19-Fall. Drei Wochen später wurden die Proben abgebrochen, zur Freude von Fanny und Hans, acht und sechs Jahre alt, die ihre Eltern – beide sind Sänger, Annette ist mit dem Bariton Daniel Schmutzhard verheiratet – nun immer bei sich hatten. «Mir kamen in der Zeit viele Gedanken über die Notwendigkeit dessen, was wir tun. Ich habe mir erlaubt, mir vorzustellen, was geschieht, wenn der ganz grosse Rummel aufhört. Ob es nicht an der Zeit ist, die Dinge anders zu machen, als immer wieder die alten Stücke aufzuführen. Jetzt gerade hatte ich mit meinem Mann einen Duettabend, open air, kleines Publikum, Schubert. Diese Details, an denen wir uns abarbeiten, Legato herstellen und die Wortdeutlichkeit bewahren, diese Farbe auf dieser Silbe – ich weiss so viel über diese Musik, aber für wen?»
Interessant, dass gerade Annette Dasch solche Fragen zulässt. Sie kennt ohnehin Zweifel und Brüche, mochte sich nie festlegen lassen, hat als moderierendes Naturtalent ein neues TV-Kultur-Format entwickelt, den «Dasch-Salon», und schon beim Treffen im Februar skeptisch über die «Liebe zum Vertrauten» gesprochen. Beim Opernpublikum gehe sie manchmal so weit, «dass die Traviata so und so sein muss, immer gleich, wie Weihnachten. Dafür ist das Theater nicht da.» Wohl gerade weil sie sich über so etwas Gedanken macht, hat die Fortsetzung der Proben im Juni sie begeistert. «Kurios ist das richtige Wort. Wir standen da, Endzeit in der Antarktis, haben gelacht und gesagt, das kann doch gar nicht sein, derartig passend, das Konzept ist schon lange entworfen!»
Dazu kommt, dass das Genre Operette für Annette Dasch «gar nicht dieses Geigenseligkeitsding ist. Es gibt total unvorhersehbare Momente, in denen die Musik eine Schicht berührt, wohin kein Wagner dringt. Und kein Mozart. Ich habe schon so viele Fledermäuse gemacht, und immer noch passiert es, dass einer singt, ‹Brüderlein und Schwesterlein›, und ich bekomme eine Gänsehaut. Es gibt auch in der Csárdásfürstin so eine Melodie für Sylva und Edwin, wo etwas passiert bei mir – das ist überhaupt nicht kitschig, nur simpel und wahr.»
Musik hat sie wie ihre drei Geschwister von Anfang an gemacht, als Tochter der Berliner Sängerin Renate Dasch. «Ich habe alles mitgenommen, was es am Gymnasium gab. Schulchor, Schulorchester, Klarinette… und mitten in der Pubertät fing ich an, mit einer sehr fraulichen Stimme zu singen. Der mädchenhafte Hauch war völlig weg. Ich konnte Sängerinnen imitieren und habe im Schulchor losgeschmettert mit einer nicht kleinen Stimme. Das war aber gar nicht in Mode, sondern die Alte Musik.» Dass man sie abschätzig eine «Walküre» nannte, traf die Heranwachsende. «Ich dachte, wenn ich mit meinem riesigen Körper jetzt auch noch so singe… dazu konnte ich nicht stehen!»
Also hielt sie sich an Barockstars wie die ätherische Emma Kirkby, unterstützt von ihrer ersten Gesangslehrerin, «alles sehr vordersitzig, leicht, ohne Vibrato. In der Pubertät hat man Angst vor vielen Dingen, und mit fünfzehn, sechzehn wollte ich nur geistliche Musik singen. Oper war für mich oberflächliches Chichi! Dann hat mich ein Freund mitgenommen in eine Generalprobe der Götterdämmerung. Da habe ich erlebt, wie Deborah Polaski sang, diese riesige Frau mit ihrer riesigen Stimme, und kapiert, was das bedeutet, wenn so eine einfach mal ganz aufmacht! Dann habe ich mich langsam, mit vielen inneren Kämpfen, dem Klang genähert, der mir natürlicherweise gegeben ist.» Der Dirigent Fabio Luisi hörte die 24-Jährige bei einem Wettbewerb. «Er hat mir grosse Romantik zugetraut. Bei ihm habe ich gelernt, wie man sich Strauss und Wagner so nähert, dass der überbordende Eindruck entsteht und doch der analytische Blick bleibt, zwei Zentimeter Distanz zwischen dem Stück und mir selbst.» Enorm wichtig war auch Nikolaus Harnoncourt. «Er konnte eine Arie vom Anfang bis zum Ende schon im ersten Ton denken. ‹Ich sehe, dass Sie Takt für Takt singen und nicht schon bei der Apotheose sind.› Da ging mir ein Universum auf. Man muss nicht unbedingt etwas zeigen, aber denken.»
Eine, die mit 34 Jahren als Elsa in Bayreuth debütierte und ein Jahr später als Figaro-Gräfin an der MET – kennt die überhaupt Lampenfieber? «Eher zunehmend! Die Erwartungen werden grösser, und man hat auch mehr Narben. Manchmal kommt das wie durch die Brust ins Auge – warum jetzt, warum heute? Man muss sich deswegen nicht geisseln. Dann geht’s halt mit schlotternden Knien da raus. Abenteuerlust gehört auch dazu.» Und ein Plan B, wenn auch nur als Spiel der Fantasie: Ein zweites Leben als Dachdecker. «Drei Jahre lang das Handwerk lernen und es bis zur Rente ausüben, unter freiem Himmel! Das hat mich mal gereizt. Man hat was geschaffen, und es sieht ja auch toll aus, so ein Dach, wenn die Schindeln genau übereinander gehen…»
Das erzählte sie lachend im Februar. Inzwischen klingt sie keineswegs, als sei das Dachdeckerdasein infolge Lockdown zur ernsthaften Option geworden. Im Gegenteil, gerade ihre Ungewissheiten scheinen in der neuen Produktion bestens aufgehoben zu sein. «Als wir den Schluss probten, wo wir in den Antarktis festsitzen, kam auf einmal Ascheregen vom Bühnenhimmel. Normalerweise werden Sänger auf so etwas vorbereitet, diesmal nicht. Der Dreck flog kübelweise, wir waren total überrascht und haben gelacht, geheult, gehustet gleichzeitig. Es war so eine Endzeitstimmung: Scheissegal, her damit! Lorenzo, unser Dirigent, sah das, und meinte, so müsst ihr das immer spielen! Und so fühlt man sich ja auch die ganze Zeit mit Corona, wie ein begossener Pudel.»
Immer neue Hürden, eine kalte Dusche folgt der andern. Wie geht die Csárdásfürstin mit schrägen Zeiten um? «Sie hat nichts mehr vom glamourösen Star, vor dem die Leute halb in Ohnmacht fallen. Sie ist Entertainerin auf dem Boot. Edwin ist wirklich in sie verliebt, weil sie ein guter Typ ist, impulsiv, schnell und heiter. Wenn die Stimmung kippt, kann sie alle dazu bringen, Party zu machen. Eine Stimmungskanone.» Mit Wärme sagt Annette das am Telefon, während eines ihrer Kinder die Mama bittet, jetzt doch mal fertig zu werden, und es besteht kein Zweifel, dass in dieser Rolle auch einiges von ihr selbst mitschwingt. Dazu gehören, nicht zuletzt, der Zweifel und die Fragen, die man braucht, um Kunst zu einer wahren Antwort werden zu lassen.
Text von Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Die geniale Stelle
Die Operette ist ein Ärgernis, seit es sie gibt. Über kein anderes Genre des Theaters wird so unermüdlich und so energisch gestritten: Aufmüpfig und frech-frivol sei sie – nein, brav und spiessig; subversiv – nein, affirmativ; witzig – nein, blödsinnig; genial – trivial… und immer so weiter, keine Einigung in Sicht, in keinem Punkt.
In keinem? Doch, über einen herrscht Einigkeit: Der dritte Akt!… Der ist ein Problem. Immer. Den haben nämlich so gut wie alle Operetten, aber anscheinend nicht aus dramaturgischen, sondern aus gastronomischen Gründen: Der Betreiber des Foyer-Restaurants verdient bei zwei Pausen einfach mehr als bei einer. Also ziehen die Librettisten am Ende des zweiten Akts irgendein Missverständnis an den Haaren herbei, das die Liebenden wieder entzweit, die schon im Begriff waren, sich überglücklich in die Arme zu sinken. Aber der Umweg zum Happy End ist meist kurz. Wenn das Publikum nach der zweiten Runde Sekt und Lachsbrötchen wieder erwartungsfroh im Saal sitzt, wird der frisch aufgebratene Konflikt in rasantem Tempo konsumiert.
Musikalisch bringt dieser «Problemakt» neben verkürzten Wiederholungen von Musiknummern aus den ersten beiden Akten in der Regel nur ein einziges neues Stück. Dieses und die Kalauer des Dialogs, in denen der holde Blödsinn der Operette Triumphe feiert, müssen den dritten Akt tragen und das Publikum bei der Stange halten. Das gelingt den Autoren mal besser, mal schlechter, selten aber so gut wie im dritten Akt der Csárdásfürstin. Die einzige neue Musiknummer des Akts bringt nämlich einen veritablen Clou, der auf die scheinbar so banale Geschichte von der Liebe der Chansonette Sylva Varescu zum jungen Fürsten Edwin ein überraschendes Licht wirft. Es ist der Tiefpunkt der Handlung: Sylva, deren Traum vom Glück an der Seite ihres Geliebten zusammengebrochen ist, weil dieser sich ihrer «anrüchigen» Herkunft anscheinend schämt, will in ihrer Verzweiflung auch ihre Künstlerlaufbahn aufgeben und einen Mann heiraten, der zu ihr passt «wie ein Elefant zu einem Klavier». Zwei gute alte Freunde versuchen, die Verzweifelte aufzuheitern. Daraus entwickelt sich ein Terzett, dessen mit «ungarischen» Synkopen gewürzte Musik die schmissige Zugnummer zu sein scheint, die man im dritten Akt erwartet. Der Text des Refrains lässt auch genau eine solche erwarten:
Jaj, Mamám, Bruderherz, ich kauf’ mir die Welt!
Jaj, Mamám, was liegt mir am lumpigen Geld!
Weisst du, wie lange noch der Globus sich dreht?
Ob es morgen nicht schon zu spät?
Der Fall scheint klar zu sein: Der Hedonismus derer, die sich alles leisten können,
wird zur Lösung aller Probleme. Aber seltsam: Die Partitur verlangt, dass dieser Refrain, der doch zum schmissigen Auftrumpfen geradezu herauszufordern scheint, langsam und leise, ja zart (dolce), später sogar in «plötzlichem» Pianissimo zu singen ist. Am erstaunlichsten aber ist die letzte Wiederholung. Wer den Klavierauszug zum ersten Mal an dieser Stelle aufschlägt, wird seinen Augen nicht trauen: Nicht nur die Vortragsanweisung «Sehr langsam, gezogen» ist ungewöhnlich, noch verblüffender ist, dass die Singstimmen nun eine Oktave tiefer notiert sind. Die für alle drei Sänger unbequem tiefe Lage bewirkt eine drastische Verdunkelung des Klangs. Langsam, tiefernst, sozusagen Silbe für Silbe wird die eine grosse Frage hingestellt: «Weisst du, wie lange noch der Globus sich dreht?» Dann übernimmt das Orchester allein – in fast verzweifelter Lustigkeit – und bringt das Terzett «furioso» zu Ende.
Emmerich Kálmáns beste Operette entstand 1915…
Text von Werner Hintze.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Sound-Übertragung von nebenan

Bühne hier, Orchester da. So spielen wir.
Unser Orchester und Chor werden derzeit aus einem externen Proberaum live in die Vorstellungen eingespielt. Dank diesem weltweit einzigartigen Spielmodell heisst es trotz Abstandsregeln: Vorhang auf für grosses Musiktheater! Erfahren Sie, wie unsere «Sound-Übertragung von nebenan» funktioniert und wie Sie mit Ihrer Spende in Ihren Musikgenuss investieren können. mehr
For the stream with english subtitles please click here.