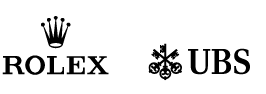Jakob Lenz
Kammeroper von Wolfgang Rihm (1952–2024)
Text von Michael Fröhling frei nach Georg Büchners «Lenz»
In deutscher Sprache. Dauer 1 Std. 10 Min. Keine Pause.
Mit freundlicher Unterstützung der Freunde der Oper Zürich
Vergangene Termine
Mai 2025
Gut zu wissen
Jakob Lenz
Kurzgefasst
Jakob Lenz
In der Kammeroper Jakob Lenz finden die künstlerischen Impulse von drei jungen Talenten auf kongeniale Weise zueinander: Im Zentrum steht Jakob Lenz selbst, ein hochsensibler Aussenseiter der Sturm-und-Drang-Zeit, der im Januar 1778 in angeschlagenem Zustand durchs Elsass wandert und bei Pfarrer Oberlin Zuflucht findet. Basierend auf historischen Aufzeichnungen Oberlins hat der jung verstorbene Georg Büchner seine Novelle Lenz geschrieben. Dieser Text inspirierte wiederum den 25-jährigen Komponisten Wolfgang Rihm 1978 zu einem frühen Erfolgswerk, das inzwischen zu den meistgespielten Kammeropern des 20. Jahrhunderts gehört. Rihm hat dem inneren Zustand von Lenz nachgespürt und vor allem die Stimmen vertont, «die nur Lenz hört». Mit ihrem hoch- expressiven, scharfkantigen, aber auch lyrisch-empfindsamen Ton führt Rihms Musik direkt in die Seele seines Protagonisten. Die Schweizer Regisseurin Mélanie Huber hat die Kammeroper anlässlich von Rihms 70. Geburtstag auf die Bühne gebracht. Ihre bildstarke, stringente und differenzierte Inszenierung ist nun noch einmal in Winterthur zu sehen. In der Hauptrolle ist wiederum der Bariton Yannick Debus zu erleben, der mit seiner Interpretation dieser Partie überregional für Aufsehen gesorgt hat.
Trailer «Jakob Lenz»
Die Vorstellungen von «Jakob Lenz» finden im Kirchgemeindehaus Liebestrasse in Winterthur statt.
Pressestimmen
«Die Macht von Jakob Lenz: zu verstören, an den Nerven zu zerren und zu erschüttern»
bachtrack, 20.11.22«Eine stringente, temporeiche und differenzierte Inszenierung»
Südkurier, 21.11.22
Interview

Der Dichter Jakob Lenz hat einmal über sich selbst geschrieben: «Ich bin ein Fremder, unstet und flüchtig, und habe so viele, die mit mir unzufrieden sind». Mélanie, wer ist diese Figur und was erfahren wir in Wolfgang Rihms Kammeroper über sie?
Der historische Jakob Lenz war ein ungewöhnlich begabter Dichter des 18. Jahrhunderts, der in Strassburg und Weimar vorübergehend zum Kreis um Goethe gehörte. Mit seinen zukunftsweisenden Dichtungen und seinen teils unangepassten Manieren fand er aber keinen richtigen Halt im Establishment. Rihms Kammeroper dreht sich um eine Episode in Lenz’ Leben, in der dieser in wahngetriebenem Zustand durch die Vogesen wandert und in ein elsässisches Dorf gelangt. Das Libretto basiert auf Georg Büchners Novelle Lenz, die wiederum auf einen historischen Bericht des Pfarrers Oberlin zurückgeht, der Jakob Lenz im Winter 1778 bei sich aufgenommen hat.
Das Werk ist ein grosses musikalisches Portrait von Lenz – eine «Zustandsbeschreibung», wie Rihm schreibt. Wie interpretierst du diesen Zustand?
Lenz hadert ganz offensichtlich mit seinem Leben. Er fühlt sich von Ängsten, von Erinnerungen und von seinem Umfeld gequält. Mir ist es aber wichtig, seinen sehr menschlichen Zügen genau nachzuspüren und aufgrund der historischen und literarischen Quellen einen Charakter zu zeigen, den man auch gernhaben kann. Lenz war zur Zeit dieser Wanderung ins Elsass erst Mitte Zwanzig. Ich empfinde ihn als eine kreative, schräge, schwer greifbare und immer wieder sehr traurige Figur. Er verhält sich oft kindlich, kann sich zu grosser Begeisterung aufschwingen – und von dort steil in tiefes Elend oder Selbstmitleid abstürzen.
Rihm begreift Lenz als verstörten Charakter. Nur noch die «nackten Stadien des Scheiterns» seien darstellbar. Was heisst das für deine Inszenierung?
Auf der Ebene des Textes verstehe ich Lenz als eine Figur, die zumindest teilweise in der Lage ist, sich von aussen zu betrachten und seine eigenen Handlungen zu reflektieren. Wenn Lenz in Büchners Novelle etwa die Natur als etwas Belebtes begreift oder physische Gegenstände in falschen Grössenverhältnissen wahrnimmt, verbinde ich das nicht nur mit Wahnsinn, sondern auch mit einer blühenden Fantasie. Wenn sich in Rihms Musik, die den inneren Zuständen der Figur nachspürt, Verstörung und Wahnsinn breit machen, dann möchte ich szenisch eher Raum dafür schaffen, als diese Klänge zusätzlich zu illustrieren. Eine vollständige Verstörung, oder gar eine klinische Schizophrenie lese ich aus den Texten von Oberlin und Büchner nicht heraus. Das würde mich theatralisch auch nicht interessieren.
Pfarrer Oberlin und Kaufmann, ein ehemaliger Freund von Lenz aus der Schweiz, sind neben dem Protagonisten zwei weitere Figuren der Handlung. Zusätzlich schreibt Rihm sechs Stimmen, «die nur Lenz hört»...
Diese Stimmen zeigen, was in ihm vorgeht. Hier überlagern sich Träume, Wahnvorstellungen, Erinnerungen, aber auch Reales. Und diese Bilder versuche ich in der Inszenierung auch für das Publikum nachvollziehbar zu erzählen. Zusammen mit der Bühnen- und Kostümbildnerin Lena Hiebel habe ich entschieden, dass sich diese sechs Stimmen auch in konkrete Figuren aus Lenz’ Leben verwandeln können. Dadurch haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Lenz’ Vater, Goethe oder dessen ehemalige Geliebte Friederike ins Spiel zu bringen, die Lenz jetzt selbst begehrt. Faszinierend finde ich, wie ambivalent diese inneren Stimmen auf Lenz einwirken: Manchmal bedrängen und verängstigen sie ihn, dann trösten sie ihn, geben ihm Halt – und jagen ihn wieder...
Du hast schon angedeutet, dass der Wahnsinn der Fantasie nahesteht. Kann man ihn sogar als eine Art Gegenvernunft bezeichnen? Bei Büchner findet sich schon in Dantons Tod die Aussage, dass die Vernunft «unerträglich langweilig» sei. Sucht auch Lenz nach anderen Möglichkeiten der Erkenntnis?
Ich glaube, bei Lenz sind die Übergänge schleichend: Mal erschrickt er über den Wahnsinn und versucht sich die inneren Stimmen aus dem Kopf zu kratzen, dann grinst er wieder darüber, dass es gerade passiert. Ich glaube nicht, dass der Wahnsinn bei ihm aus dem Nichts auftaucht. Die Freiheiten, die er sich in seinen Dramen herausnimmt, und das Unverständnis, das ihm von seinen Dichterkollegen dafür entgegengebracht wird, zeugen deutlich davon, dass er grundsätzlich anders denken wollte. Jemand, der so gewitzt schreibt wie Lenz, scheint schon ein Universum im Kopf zu haben, das die gewöhnliche Fantasie weit übersteigt...
«Er fühlte in einzelnen Augenblicken tief, wie er sich alles nur zurecht mache», heisst es in Büchners Novelle. Lenz geht bewusst auf Distanz zur Welt. Und zuletzt verabschiedet er sich fast unbemerkt aus ihr: 1792 wird er tot auf einer Strasse in Moskau gefunden. Das erinnert mich ein wenig an den Tod von Bartleby in Herman Melvilles Text, den du bereits inszeniert hast...
...oder an den Schweizer Schriftsteller Robert Walser, der die letzten Jahre seines Lebens in einer Heilanstalt verbracht hat und nach einem winterlichen Spaziergang tot im Schnee gefunden wurde. Das sind alles Figuren, die ihren grösseren oder kleineren Eigenheiten nachgehen und sich nicht vom allzu genormten Lauf der Welt mitreissen lassen. Mich berührt das, weil diese Figuren traurig und abgründigkomisch zugleich sind. Wenn ich mir die Begegnung zwischen Goethe und Lenz vorstelle, dann interessiert mich der erste, der aus gutem Haus stammt, geschliffen schreibt und erfolgreich ist, weit weniger als der kauzige Lenz, der in Livland (heute: Baltikum) in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und in Mitteleuropa merken muss, dass er in der erlauchten Elite nicht willkommen ist. Besonders gut gefällt mir der letzte Satz aus Büchners Novelle, der die Lebensepisode im Elsass beschliesst: «– – So lebte er hin.» Es geht hier nicht um ein heroisches, sondern eben um ein sehr menschliches Leben.
Wolfgang Rihm schreibt: «In Jakob Lenz schlägt das Menschliche oft ins Märchenhafte um.» Inwiefern ist das für deine Inszenierung von Bedeutung?
Das kommt mir sehr entgegen! Ich möchte eher ein grosses Bilderbuch inszenieren als kleinteilige Psychologie. Die kindliche Sichtweise, die ich bei Lenz ausmachen kann, aber auch die einfachen technischen Möglichkeiten, die wir im ZKO-Haus zur Verfügung haben, führen mich zu einem sehr spielerischen Ansatz. Kinder behaupten die Welt, in der sie sich gerade spielend befinden. Analog dazu möchte ich die Welt, wie Lenz sie sich zurechtmacht, als abstrakte, groteske, rätselhafte Welt zwischen Märchen, Traum, Vorstellung und Fantasie auf die Bühne bringen.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 96, Oktober 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

Yannick Debus
Yannick Debus wurde in Hamburg geboren und studierte Gesang in Lübeck und Basel. Von 2020 bis 2022 war er Mitglied im Internationalen Opernstudio am Opernhaus Zürich. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn ausserdem mit René Jacobs, u.a. für die Aufnahme von Webers «Freischütz». Zuletzt war er hier u.a. als Harlekin («Ariadne auf Naxos») und als Lesbo («Agrippina») zu erleben. Zusammen mit Hanna-Elisabeth Müller singt er im Juni das «Italienische Liederbuch» von Hugo Wolf.
Aus welcher Welt kommst du gerade?
Aus der Welt der Superreichen und Intriganten. Ich war gerade Teil der Agrippina-Produktion hier am Opernhaus, in der das antike römische Thronfolgedrama in die Gegenwart verlegt wurde, wo es nun um die Nachfolge in einem grossen Familienunternehmen geht.
Worauf freust du dich in der Oper Jakob Lenz?
Die letzte Vorstellung von Jakob Lenz liegt jetzt knapp zweieinhalb Jahre zurück. In der Zeit habe ich mich darstellerisch und stimmlich weiterentwickelt, und so habe ich es jetzt für mich in der Vorbereitung zur Wiederaufnahme zur Aufgabe gemacht, diese vokal äusserst anspruchsvolle Partie mit meinen neuen Möglichkeiten sozusagen upzudaten.
Wer ist Jakob Lenz?
Jakob Lenz war ein Schriftsteller, ein Zeitgenosse Goethes, ein Avantgardist, und er ist auch die Hauptperson der Oper von Wolfgang Rihm, dessen Grundlage wiederum Georg Büchners Novelle Lenz ist. Lenz verzweifelt an der Welt, zieht sich zurück und findet Zuflucht vor seinen Ängsten beim Pfarrer Oberlin in den Vogesen, wo auch die Handlung der Oper spielt. Lenz ist genial und geht an eben dieser Genialität zugrunde. Er war seiner Zeit vielleicht so weit voraus, dass ihn kaum jemand verstand, und er mehr und mehr vereinsamte.
Wie bereitest du diese anspruchsvolle Partie für die Wiederaufnahme vor?
Mit viel Zeit im stillen Übekämmerlein, aber auch im Unterricht mit meiner Gesangslehrerin. Die Partie ist technisch und stimmlich derart herausfordernd, dass ich auch die szenischen Proben brauche, in denen wir Szenen mehrmals hintereinander durchlaufen lassen, dort kann ich mir dann die nötige Kondition wieder erarbeiten. Abgesehen davon, mache ich aber auch viel Sport als Vorbereitung, wie Joggen, Schwimmen, Pilates und Yoga, um physisch auf der Höhe zu sein, denn Lenz ist körperlich sehr aktiv in unserer Produktion.
Welches Bildungserlebnis hat dich besonders geprägt?
Das war mit grossem Abstand mein Auslandsjahr in Australien. Ich war dort in Perth, in Western Australia, und habe einen Schüleraustausch gemacht, damals war ich 15 Jahre alt. Dort habe ich meine Liebe zur Musik entdeckt und auch meinen ersten Gesangsunterricht erhalten.
Welches Buch würdest du niemals aus der Hand geben?
Das Silmarillion von J. R. R. Tolkien. Mich fasziniert seine Welt immer mehr, je tiefer ich eintauche.
Welche CD hörst du immer wieder?
Ich besitze zwar noch eine Menge CDs, muss aber gestehen, dass meine Lieblingsaufnahme aus dem Internet kommt, ob es die auf CD gibt, weiss ich gar nicht: Es ist der 1. Satz aus Skriabins Zweiter Klaviersonate in einer Live-Aufnahme aus Prag von 1972. Es spielt Swjatoslaw Richter.
Mit welcher Künstlerpersönlichkeit würdest du gern einmal essen gehen?
Das müssten zwei sein, zwischen denen ich mich nicht entscheiden könnte, und leider leben beide nicht mehr: Leonard Bernstein und Nikolaus Harnoncourt.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 121, April 2025.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Jakob Lenz
Synopsis
Jakob Lenz
1. Bild
Ein junger Mann hastet durch das Gebirge. Innere Stimmen begleiten ihn. Er stürzt sich in einen Dorfbrunnen.
2. Bild
Oberlin, der Pfarrer des Dorfes, bittet den Fremden in sein Haus. Dieser gibt sich als der Schriftsteller Jakob Lenz zu erkennen. Er wirkt bedrückt. Oberlin bittet ihn, eine Weile bei ihm zu bleiben.
3. Bild
Lenz versucht zu beten, wird aber an seine unglückliche Liebe zu Friederike erinnert. Er verwünscht die Nacht, muss raus – und stürzt erneut in den Brunnen.
4. Bild
Oberlin führt Lenz in die Natur, in der sich dieser gedanklich verliert. Die Dorfgemeinde kommt dazu. Kinder beäugen Lenz.
5. Bild
Lenz will eine Predigt halten. Er ringt um Ausdruck. Er springt mit den Kindern weg.
6. Bild
Kaufmann, ein früherer Freund, kommt in das Dorf. Er verwickelt Lenz in ein Gespräch über Kunst. Lenz antwortet den engstirnigen, spöttisch vorgetragenen Auffassungen Kaufmanns mit weit ausschweifenden Ausführungen. Neben tiefen Gedanken versteigt er sich auch zu ungereimten und überheblichen Aussagen. Kaufmann will Lenz zu seinem Vater zurückschicken. Lenz weigert sich erbittert.
7. Bild
Im Gebirge findet Lenz einen Moment der Ruhe und der Inspiration, der jedoch in heftige Traurigkeit umschlägt. Die inneren Stimmen beschwören den Verlust Friederikes herauf. Lenz will sie retten. Es entsteht «Eine Art Traumbild».
8. Bild
Lenz weckt Oberlin mitten in der Nacht. Er fragt nach dem Mädchen, um das er leidet. Oberlin kann ihm nicht helfen. Lenz geht.
9. Bild
Im Gebirge ist Lenz wieder von Stimmen umgeben. Eine junge Frau bedrängt ihn und treibt ihn in die Flucht.
10. Bild
Lenz versucht ein totes Mädchen zum Leben zu erwecken. Beim Anblick der kalten Leiche fühlt er sich von Gott verlassen.
11. Bild
In der Morgendämmerung läuft Lenz ziellos durch die Landschaft. Die Stimmen bringen ihn zu der Einsicht, dass er sterben muss. Er versucht, sich umzubringen.
12. Bild
Oberlin sorgt sich um Lenz. Kaufmann glaubt, dass diesem nicht mehr zu helfen ist. Lenz fühlt sich verwirrt, gelangweilt, verloren und getrieben. In einem Gebet wünscht er sich die Nacht.
Letztes Bild
Lenz fantasiert. Oberlin verlässt ihn widerwillig und entfernt sich mit Kaufmann. Lenz bleibt allein.
Biografien

Adrian Kelly, Musikalische Leitung
Adrian Kelly
Adrian Kelly wurde nach seinem Studium an der Universität Cambridge Mitglied des Young Artists Programme am ROH Covent Garden. Danach war er Solorepetitor an der Staatsoper Hamburg. Er arbeitet regelmässig für die Salzburger Festspiele, wo er u.a. Ingo Metzmacher bei Luigi Nonos Al gran sole carico d’amore und Wolfgang Rihms Dionysos assistierte. Darüber hinaus arbeitete er mit Dirigent:innen wie Antonio Pappano, Mark Elder, Peter Schneider, Nicola Luisotti, Philippe Jordan und Simone Young. Seit Sommer 2015 ist er Musikalischer Leiter des Young Singers Project der Salzburger Festspiele. Gastengagements führten ihn ans Teatro Colón in Buenos Aires und in die Vereinigten Staaten, wo er das Barock-Pasticcio The Infernal Comedy mit dem Schauspieler John Malkovich auf Tournee dirigierte. Von 2010 bis 2017 war Adrian Kelly Erster Kapellmeister am Salzburger Landestheater. Er arbeitete dort regelmässig mit dem Mozarteumorchester Salzburg und übernahm die musikalische Leitung u.a. von Les Contes d’Hoffmann, Le nozze di Figaro, Ernst Kreneks Jonny spielt auf, Hänsel und Gretel in der Felsenreitschule, La bohème im Haus für Mozart sowie der österreichischen Erstaufführung von Charles Wuorinens Brokeback Mountain. In der Spielzeit 2018/19 leitete er am Landestheater Manon sowie einen Zyklus der Mozart-Da Ponte-Opern und kehrte in der Saison 2019/20 als erster ständiger Gastdirigent dorthin zurück. Seit Juni 2018 ist er Künstlerischer Leiter des Buxton Festivals, wo er die Neuproduktionen von Eugen Onegin und von La donna del lago dirigierte. Seit der Spielzeit 2020/21 ist er Leiter des Internationalen Opernstudios Zürich und dirigierte hier u.a. Viva la mamma am Theater Winterthur und Jakob Lenz im ZKO-Haus.

Mélanie Huber, Inszenierung
Mélanie Huber
Mélanie Huber studierte Film an der Hochschule der Künste in Zürich. Sie inszenierte u. a. am Opernhaus Zürich, Schauspielhaus Zürich, Schauspielhaus Wien, Theater St. Gallen, Gessnerallee Zürich, Theater Regensburg, TOBS! Theater Orchester Biel Solothurn, Theater Baden-Baden, Theater Winkelwiese. Ihre Arbeiten wurden mehrmals zu internationalen Festivals wie dem Radikal Jung Festival in München, dem Prager Festival der Deutschen Sprache, den Autorentheatertagen des Deutschen Theaters Berlin, den Festspielen Zürich und dem Schweizer Theatertreffen eingeladen. Von der deutschen Fachzeitschrift «Theater heute» wurde sie viermal als Nachwuchsregisseurin des Jahres nominiert: für die Inszenierungen von Bartleby der Schreiber nach Herman Melville, Die Radiofamilie nach Ingeborg Bachmann und Dunkel lockende Welt von Händl Klaus, welche jeweils am Schauspielhaus Zürich entstanden sind, sowie zuletzt für Der Kirschgarten von Anton Tschechow am Theater St. Gallen. Zuletzt inszenierte sie u. a. Donizettis Viva la Mamma und Wolfgang Rihms Jakob Lenz für das Opernhaus Zürich und Maria Stuart am TOBS!. 2025 inszeniert sie den szenischen Spaziergang All das Nichts? von Silvan Rechsteiner (UA) am Theater Winterthur, Das schlaue Füchslein von Leoš Janáček am Oldenburgischen Staatstheater, Carmina Burana in der Tonhalle Zürich sowie die Oper Alice im Wunderland von Pierangelo Valtinoni am Nationaltheater Mannheim. 2016 wurde sie mit dem London Stipendium der Landis & Gyr Stiftung ausgezeichnet.

Lena Hiebel, Ausstattung
Lena Hiebel
Lena Hiebel wurde in Hamburg geboren und studierte zunächst an der dortigen Universität Germanistik und Soziologie. Während des Studiums arbeitete sie für die ModedesignerIn Annette Rufeger und Oliver Kresse. 2004 wechselte sie an die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und studierte dort Kostümdesign bei Dirk von Bodisco, Anna Eiermann und Reinhard von der Thannen. Von 2009 bis 2011 war sie feste Kostümassistentin an den Münchener Kammerspielen. Seit 2011 ist sie als freie Kostüm- und Bühnenbildnerin in Deutschland, der Schweiz und Österreich tätig. Sie arbeitet u. a. mit Mélanie Huber, Grit Lukas, Nina Mattenklotz, Hannes Weiler, Maaike van Langen, Mia Constantin, Schorsch Kamerun, Marc von Henning u. a. am Staatsschauspiel Stuttgart, am Schauspielhaus Zürich, am Opernhaus Zürich, am Theater St. Gallen, an der Winkelwiese in Zürich, am Luzerner Theater, am Theater Solothurn, am Deutschen Nationaltheater Weimar, am Theater Bremen, am Lichthoftheater in Hamburg, am Theater Regensburg, am Theater Konstanz, am Theater Heilbronn, am Theater Magdeburg, am Theater Lübeck und am Oldenburgischen Staatstheater. Sie lebt mit ihrer Familie in Köln.

Dino Strucken, Lichtgestaltung
Dino Strucken
Dino Strucken stammt aus Zürich. Er absolvierte nach seiner Ausbildung zum Elektromonteur den Meister für Veranstaltungstechnik in Hamburg. Seit 2011 arbeitet er als Beleuchtungsmeister am Opernhaus Zürich, wo er bisher Lichtdesigns für u.a. Hexe Hillary geht in die Oper (Regie: Anja Horst), Der geduldige Sokrates und Konrad oder das Kind aus der Konservendose (Regie: Claudia Blersch), Fälle (Regie: Jan Essinger), Der Traum von dir, Die Gänsemagd und Gold (Regie: Nina Russi), Last Call (Regie: Chris Kondek), Das tapfere Schneiderlein (Regie: Kai Anne Schumacher), Il mondo della Luna (Regie: Tomo Sugao) und Jakob Lenz (Regie: Mélanie Huber) kreierte. Ausserdem entwarf er Lichtkonzepte und Designs von Events, beispielsweise für das Kostümfest am Opernhaus Zürich. Mehrere Opernproduktionen aus Zürich betreute er lichttechnisch an den Opernhäusern in Napoli, Madrid, Monte Carlo und Paris.

Fabio Dietsche, Dramaturgie
Fabio Dietsche
Fabio Dietsche studierte Dramaturgie an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Querflöte bei Maria Goldschmidt in Zürich und bei Karl-Heinz Schütz in Wien. Erste Erfahrungen als Dramaturg sammelte er 2012/13 bei Xavier Zuber am Konzert Theater Bern, wo er u.a. Matthias Rebstocks Inszenierung von neither (Beckett/Feldman) in der Berner Reithalle begleitete. Seit 2013 ist er Dramaturg am Opernhaus Zürich, wo er sein Studium mit der Produktionsdramaturgie von Puccinis La bohème abschloss. Hier wirkte er u.a. bei den Uraufführungen von Stefan Wirths Girl with a Pearl Earring und Leonard Evers Odyssee, an der Kammeroper Jakob Lenz von Wolfgang Rihm und an der Schweizerischen Erstaufführung von Manfred Trojahns Orest mit. Er arbeitete u.a. mit Robert Carsen, Tatjana Gürbaca, Rainer Holzapfel, Andreas Homoki, Ted Huffman, Mélanie Huber, Barrie Kosky, Hans Neuenfels und Kai Anne Schuhmacher zusammen. Zurzeit studiert er berufsbegleitend Kulturmanagement an der Universität Zürich.

Yannick Debus, Lenz
Yannick Debus
Yannick Debus studierte Gesang an der Musikhochschule Lübeck, an der Hochschule für Musik Basel und an der Schola Cantorum Basiliensis. Zu seinen ersten Engagements zählen der Vater in Hänsel und Gretel am Schloss Weikersheim, Guglielmo (Così fan tutte) an der Kammeroper Schloss Rheinsberg, der Kaiser in Ullmanns Der Kaiser von Atlantis sowie Figaro in Milhauds La mère coupable am Theater Basel und Emireno in Händels Ottone bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Von 2020 bis 2022 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit René Jacobs, unter dessen Leitung er u. a. als Jesus (Johannes-Passion) im Concertgebouw Amsterdam, als Apollo (Händels Apollo e Dafne), als Kilian und Ottokar (Der Freischütz) u. a. in der Elbphilharmonie Hamburg sowie in Händels Israel in Egypt in der Philharmonie de Paris, dem Konzerthaus Freiburg und der Berliner Philharmonie zu erleben war. 2023/24 sang er die Titelpartie in Monteverdis Orfeo mit dem Freiburger Barockorchester unter René Jacobs u. a. in der Berliner Philharmonie, der Philharmonie de Paris und am Liceu in Barcelona, Guglielmo (Così fan tutte) mit dem Orchestre National de Lyon, sowie Jesus (Matthäus-Passion) mit dem Freiburger Barockorchester unter Francesco Corti auf Tour u. a. in Frankfurt, Madrid, Budapest, Zürich und Seoul. Seit der Spielzeit 2024/25 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich, wo er zuletzt als Harlekin (Ariadne auf Naxos) und Lesbo (Agrippina) zu hören war. Ausserdem singt er in dieser Spielzeit Carmina Burana im Concertgebouw Amsterdam und in der Tonhalle Zürich, sowie die Lieder eines fahrenden Gesellen mit dem Stuttgarter Ballett. In der Spielzeit 2025/26 wird er am Opernhaus Zürich u.a. als Guglielmo (Così fan tutte) und Dr. Falke (Die Fledermaus) zu erleben sein.

Max Bell, Oberlin
Max Bell
Maximilian Bell, Bass, studierte bei Michail Lanskoi und Manfred Equiluz an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Seine Ausbildung ergänzte er durch Meisterkurse bei Angelika Kirchschlager, Adrian Eröd und Gerhard Kahry. Der geborene Österreicher übernahm bereits Rollen wie Spinelloccio (Gianni Schicchi) und Norton (La cambiale di matrimonio) bei den Bregenzer Festspielen, Osmin (Die Entführung aus dem Serail) im Rahmen der Sommerakademie der Wiener Philharmonikern in Wien und Graz, Snug (A Midsummer Night’s Dream) am Theater Akzent in Wien, die Basspartie in Bernsteins Mass im Wiener Musikverein, Rocco (Fidelio) in einer Kinderproduktion im österreichischen Baden, Sarastro (Die Zauberflöte) im Wiener MuTh sowie Bartolo (Le nozze di Figaro) in einer Wandertheaterproduktion. Ab der Spielzeit 2024/25 gehört er zum Internationalen Opernstudio am Opernhaus Zürich.

Maximilian Lawrie, Kaufmann
Maximilian Lawrie
Maximilian Lawrie studierte am Magdalen College der University of Oxford und an der Royal Academy of Music in London. Dort war er als Tanzmeister in Ariadne auf Naxos, Interrogator 2 in Witch, als Rodolfo in La bohème, als Rinuccio in Gianni Schicci, als First Sailor in Dido and Aeneas, als Don Ottavio in Don Giovanni, als Nemorino in L’elisir d’amore, als Lysander in A Midsummer Night’s Dream, in der Titelrolle von Werther und als Faust in Mefistofele zu hören. Zudem sang er Rodolfo an der Rogue Opera sowie Don José in Carmen an der Rogue Opera und der Cambridge University Opera Society. Seit der Spielzeit 2022/23 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich.

Marie Lombard, 6 Stimmen
Marie Lombard
Marie Lombard, Sopran, studierte am Pariser Konservatorium sowie in Rennes bei Stéphanie d’Oustrac und absolvierte Meisterkurse u.a. bei Anne Sofie von Otter, Stéphane Degout, Inva Mula, Sylvie Valayre und Mariella Devia. Sie war Gewinnerin des «Prix Jeune Espoir» beim Ersten Internationalen Wettbewerb für junge Nachwuchssänger*innen der Grand Opéra d’Avignon sowie des Internationalen Gesangswettbewerbs «Corsica lirica» und des Akademiepreises der Internationalen Sächsischen Sängerakademie. Bei der Marmande International Singing Competition erreichte sie den dritten Rang. 2023 war sie Halbfinalistin der Queen Elisabeth Competition in Brüssel. Bisher sang sie Rollen wie Inès (La favorite) an der Opéra National de Bordeaux, Belinda (Dido und Aeneas) an der Opéra de Rennes sowie in Bordeaux, Eurydice (Orfeo ed Euridice) am Théâtre des Étoiles in Paris, Adèle (Die Fledermaus) in einer Produktion des Pariser Konservatoriums und der Philharmonie de Paris, Coraline (Adolphe Adams Le toréador) an der Opéra de Rennes sowie Erste Dame (Die Zauberflöte) an der Opéra d’Angers-Nantes. Die Spielzeit 2024/25 führt sie als Najade/Ninfa (Ariadne auf Naxos) in das Auditorio de Tenerife sowie als Mitglied an Cecilia Bartolis Akademie an der Opéra de Monaco. Sie ist Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich.

Bożena Bujnicka, 6 Stimmen
Bożena Bujnicka
Bożena Bujnicka stammt aus Polen und studierte an der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Warschau. Sie war Mitglied des Young Artists Program des Teatr Wielki in Warschau sowie Erasmusstudentin an der Guildhall School of Music and Drama in London. Sie hat zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen, darunter den 1. Preis beim Nationalen Gesangswettbewerb Złote Głosy in Warschau. 2015 gab sie ihr Operndebüt als Amore in Glucks Orfeo ed Euridice am Teatr Wielki, wo sie seither u.a. als Gräfin Ceprano in Rigoletto und als First Girl in Der feurige Engel zu erleben war. An der Oper in Breslau gastierte sie jüngst als Donna Elvira (Don Giovanni), als Micaëla (Carmen) und als Yemaya (Yemaya, Queen of Seas) sowie an der Kammeroper Warschau als Contessa di Almaviva (Le nozze di Figaro). Neben ihren Auftritten als Sängerin arbeitet Bożena Bujnicka auch als Regisseurin. So gab sie 2017 ihr Regiedebüt mit der Inszenierung von About the Kingdom of Day and Night and Magic Instruments, einer Kurzversion der Zauberflöte am Teatr Wielki und inszenierte zuletzt Händels Aci, Galatea e Polifemo für das Festival Dramma per Musica in Polen. Seit der Spielzeit 2021/22 ist sie Mitglied im Internationalen Opernstudios Zürich und war hier in L’incoronazione di Poppea, Il trovatore, Simon Boccanegra, Le Comte Ory, Macbeth, Rigoletto und Jakob Lenz zu erleben.

Indyana Schneider, 6 Stimmen
Indyana Schneider
Indyana Schneider, Mezzosopran, wuchs in Australien auf und studierte am Magdalen College der University of Oxford und an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Sie war Mitglied der Akademie der Wiener Staatsoper, wo sie in Olga Neuwirths Orlando und im Semichor von Händels Ariodante auftrat. Auf einer Tournee mit der Kent Chamber Opera verkörperte sie die Carmen und am Theater für Niedersachsen die Mercédès (Carmen). 2021 war sie Finalistin beim Joan Sutherland und Richard Bonynge Bel Canto Award und gewann 2022 den 2. Preis beim Walter und Charlotte Hamel Opernwettbewerb in Hannover. In der Spielzeit 2022/23 sang sie die Rolle der Meg Page (Falstaff) in einer Produktion der Hochschule in Hannover, die Rolle des Komponisten (Cover) in der Garsington Opera-Produktion von Ariadne auf Naxos und die Rolle der Zita in Gianni Schicchi mit Sir Bryn Terfel in der Titelrolle und unter der Leitung von Domingo Hindoyan. Jüngst sang sie die 2. Dame in der Zauberflöte am Sydney Opera House. Seit der Spielzeit 2023/24 ist sie Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und sang hier seither in Iphigénie en Tauride, A Midsummer Night’s Dream und im jährlichen Opernstudio-Galakonzert.

Dominika Stefanska, 6 Stimmen
Dominika Stefanska
Dominika Stefańska, Mezzosopran, studierte in Lodz und war Mitglied in der Akademie der Oper Warschau. Sie war Finalistin bei der Ada Sari International Vocal Artistry Competition 2021. An der Oper Łódź war sie als Volpino (Lo speziale) und Frau Reich (Die lustigen Weiber von Windsor) zu hören. An der Oper Poznan sang sie eine Nymphe in Rusalka. Seit der Spielzeit 2023/24 ist sie Mitglied im Internationalen Opernstudio am Opernhaus Zürich und hier u. a. als Hippolyta in A Midsummer Night’s Dream sowie in Jim Knopf und Sweeney Todd zu hören.

Felix Gygli, 6 Stimmen
Felix Gygli
Der Schweizer Bariton Felix Gygli ist Gewinner der Kathleen Ferrier Awards 2023 und des Lied-Preises der Queen Sonja Competition 2024. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich. Er ist Samling Artist und war 2022/23 «Young Artist» im National Opera Studio in London. Seine Ausbildung absolvierte er an der Guildhall School of Music and Drama in London und an der Schola Cantorum Basiliensis. Er war Mitglied der Académie Lyrique des Verbier Festivals 2023, wo er mit dem Prix Thierry Mermod als «Vielversprechendsten Sänger» ausgezeichnet wurde. Im Januar 2024 nahm er am Carnegie Hall SongStudio unter der Schirmherrschaft von Renée Fleming teil. Felix Gygli sang beim Verbier Festival 2023 die Rolle des 2. Handwerksburschen (Wozzeck) und tritt als Starveling in Benjamin Brittens Midsummer Night’s Dream am Opernhaus Zürich auf. Er eröffnete die Saison 2023/24 mit dem Opéra Orchestre National de Montpellier in einem Opern-Gala-Konzert unter der Leitung von Chloé Dufresne. Ausserdem trat er mit dem Theater Orchester Biel Solothurn als Bariton-Solist in Brahms' Deutschem Requiem auf. Er ist leidenschaftlicher Liedsänger und gab mit den Pianisten JongSun Woo und Tomasz Domanski Liederabende in Grossbritannien, Frankreich und der Schweiz. Sein US-Debüt gab er mit einer Aufführung von Schuberts Winterreise mit dem Pianisten Pierre-Nicolas Colombat beim Boston Text and Tone Festival. Zu seinem Oratorienrepertoire gehören Faurés Requiem, Mendelssohns Elias und Bachs Matthäuspassion. 2022 gab er sein Operndebüt als Papageno in Mozarts Die Zauberflöte mit Ouverture Opéra Sion.
Felix Gygli ist neuer Stipendiat der Hildegard Zadek Stiftung. Er erhält das Liselotte Becker und Ursula van Harten Stipendium.

Lobel Barun, 6 Stimmen
Lobel Barun
Lobel Barun, Bass, stammt aus Kroatien. Er studierte bei Alexei Tanovitski an der Musikhochschule seiner Heimatstadt Zagreb. 2023 gewann er beim Internationalen Gesangswettbewerb «Lazar Jovanović» in Belgrad den Spezialpreis «Željko Lučić». Im selben Jahr gab er am Kroatischen Nationaltheater in Zagreb sein Debüt als Bacchus in Boris Papandopulos Amphitryon. Ausserdem trat er mit der Zagreber Philharmonie in der Lisinski-Konzerthalle auf und verkörperte Salieri in Rimski-Korsakows Mozart und Salieri im Opernstudio der Zagreber Hochschule. Weitere Rollen umfassen Le Surintendant des plaisirs (Massenets Cendrillon) an der Musikhochschule in Zagreb, den zahmen Raben Moses (Igor Kuljerićs Animal Farm) in der Lisinski-Konzerthalle, Carceriere (Tosca) am Kroatischen Nationaltheater sowie Tobias Mill (Rossinis La cambiale di matrimonio) im kroatischen Vis. Ab der Spielzeit 2024/25 gehört er zum Internationalen Opernstudio am Opernhaus Zürich.