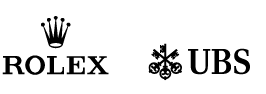Johann Christian Bach
Johann Christian Bach (1735 – 1782)
Sinfonia aus Gioas, re di Giuda W.D1
Rezitativ und Arie Armati di furore
aus Gioas, re di Giuda
Sinfonie g-Moll op. 6/6
Rezitativ und Arie Mon âme aurait trop de peine
aus Amadis de Gaule W.G39
Rezitativ und Arie Se tiranni, o dei
aus L’Endimione W.G15
Pause
Konzert für Cembalo f-Moll W.73
Arie Parto, addio.
aus Zanaida W.G5
Tambourin
aus Amadis de Gaule
Arie ’Midst silent shades
aus A third collection of favourite songs sung at Vaux Hall by Miss Cowper W.H33
Dauer 1 Std. 45 Min. inkl. Pause nach ca. 45 Min.
Gut zu wissen
Johann Christian Bach
Kurzgefasst
Johann Christian Bach
Von den vier Bach-Söhnen, die als Komponisten berühmt geworden sind, war Johann Christian Bach der jüngste. 1735 in Leipzig geboren, führte sein Weg über Italien nach London, wo er mit Karl Friedrich Abel ein erfolgreiches Konzertunternehmen gründete und 1764 dem 8-jährigen Mozart begegnete, dessen Stil er entscheidend beeinflusste. Unter seinen Werken, die der Wiener Klassik den Boden bereiteten, befinden sich zahlreiche Opern und über sechzig Sinfonien. Riccardo Minasi hat daraus ein Konzertprogramm zusammengestellt, das er mit dem Orchestra La Scintilla präsentiert. Die junge Sopranistin Anna El-Khashem, die zuletzt als Susanna unter Gustavo Dudamel in Paris zu hören war, singt ausgewählte Arien.
Volker Hagedorn trifft...

Mahan Esfahani
Mahan Esfahani gehört zu den schillerndsten Figuren der internationalen Cembalisten- Szene. Er versteht sich auf seinem Instrument als Pionier und Archäologe zugleich. Er widmet sich dem traditionellen Cembalo- Repertoire ebenso wie zeitgenössischen Kompositionen und selten gespielten Werken des 20. Jahrhunderts. Mit dem Orchestra La Scintilla verbindet ihn eine enge künstlerische Partnerschaft. Am 7. März ist er gemeinsam mit dem Ensemble als Orgelsolist zu erleben.
Nach allem, was ich über ihn gelesen habe, mag er Kontroversen. Dann fange ich doch mal etwas provokant an, gleich nach der Frage, ob er jetzt in Prag sitzt, beim Zoomen. Ja, das tut er. Demnächst tritt er mit dem Orchestra La Scintilla in Zürich auf, das auf historischen Instrumenten spielt, sogar auf eigens rekonstruierten «alten» Saiten. Wie verträgt sich die Originalklangtreue mit der Offenheit, dem Unorthodoxen, für das er steht, der Cembalist, der seinem Instrument laut The New Yorker «ein fast schon hipstermässiges Profil» verpasst hat, gern Bach mit Steve Reich kombiniert und auf seiner Website optisch irgendwo zwischen Graffiti und Gucci rangiert?
«Ist es etwa nicht offen, mit historischen Instrumenten zu arbeiten?», fragt er zurück. «Das Entscheidende am Revival der frühen Aufführungspraxis ist ja gerade die Offenheit. Wenn wir den Geist des Experimentierens verlieren, ist das nicht länger Musikmachen.» Und gerade jetzt gebe es in der «Alte Musik»-Szene eine Tendenz zur Homogenisierung, zur einheitlichen Spielweise. «Wenn Sie aber Mitglieder dieser Barockorchester fragen, ob sie das, was sie tun, mit historischer Information begründen können, haben die meisten keine Antwort.» Es kann also nicht schaden, sich mal wieder über die Quellen zu beugen, wie Riccardo Minasi, der künstlerische Leiter von La Scintilla, und Mahan Esfahani das tun. «Ich habe kein Problem mit Purismus! Meine Bibliothek hier ist voll mit Traktaten zur Aufführungspraxis, die ich in den Originalsprachen lese.» Aber Authentizität komme allein dadurch nicht zustande. Er zitiert auf Deutsch seine Lehrerin Zuzana Růžičková: «Wenn man überzeugend ist, ist man authentisch.»
Růžičková ist jene tschechische Cembalistin, deren Bach-Aufnahmen in den 1970ern wohl in jedem klassikaffinen Haushalt zu finden waren. Wegen ihr, die einst Auschwitz und Bergen-Belsen überlebte, ist Mahan Esfahani 2011 von London nach Prag gezogen. Da war sie 84 und er 27 Jahre alt. Was lernte er von ihr, die ihre Aufnahmen, der Zeit entsprechend, überwiegend auf stahlbesaiteten Klavierhybriden von Sperrhake und Neupert gemacht hatte, auch wenn sie später historische Instrumente sehr schätzte? «Dass grosse Kunst Fragen stellt», sagt Esfahani. «Ich war mit Mitte Zwanzig zu einem Punkt gekommen, als ich eine Menge Antworten hatte und keine Fragen. Ich dachte, so kann’s nicht bleiben.» In den Klang des Cembalos hatte er sich mit neun Jahren verliebt, den Klang einer alten Aufnahme mit Karl Richter. Als Kind iranischer Eltern, die ihre Heimat verlassen hatten, wuchs Mahan auf in Rockville, im US-Staat Maryland. Mit sechzehn hatte er ein eigenes Instrument, einen Bausatz, studierte in Stanford, aber nicht gleich Musik, sondern begann mit Medizin, Jura, Geschichte, Musikwissenschaft – und nahm Cembalounterricht. «Man versucht, den Sog des Unvermeidlichen zu vermeiden», so fasst er die Anläufe zusammen, «ausserdem fängt kein vernünftiger Mensch mit Cembalo an, wenn er nicht gerade aus einer reichen Familie kommt. Ich musste es immer rechtfertigen, auch vor mir selbst.»
Bestätigt sah Esfahani sich erst mit 30 Jahren, nachdem seine Aufnahme von Rameaus Pièces de Clavecin ihm erstmals die «Gramophone Editor’s Choice» eingebracht hatte. «Da dachte ich, well, so weit sind wir gekommen, dann setze ich das fort.» Zu der Zeit hatte er sich, über Mailand und Oxford nach London geraten, mit einer Menge glücklicher Zufälle, auch als Interpret moderner Cembalomusik einen Namen gemacht, Francis Poulencs Konzert für die BBC aufgenommen und eines vom tschechischen Komponisten Viktor Kalabis. Dessen Witwe hörte es im Radio und gratulierte brieflich: Zuzana Růžičková. Sie rechnete wohl kaum damit, dass ihn das als Schüler zu ihr bringen würde. Als sie, die späte Lehrerin und seine wichtigste, wie er sagt, mit 90 Jahren starb, blieb er in Prag. «Es ist hier ruhiger als in London, persönlicher, es gibt eine besondere Sympathie für Musik. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Programm habe, gibt es jemanden, den ich anrufen kann: Kann ich dir heute Abend zu Hause etwas vorspielen?» Auf London lässt er trotzdem nichts kommen. «Es ist der Ort in Europa, wo ich zum ersten Mal ich selbst sein konnte und nicht daran leiden musste». Da habe die deutschsprachige Welt noch einen langen Weg vor sich, «mit Ausnahme der früheren DDR – im Gegensatz zu dem, was die Leute über sie denken!» Ein Schock, nicht nur für Esfahani, war ein Auftritt in der Kölner Philharmonie. «Reden Sie doch gefälligst Deutsch!», hatte man ihm dort 2017 zugerufen, als er Steve Reichs Piano Phase erklärte. Die anschliessende Aufführung wurde wegen Tumulten im Saal abgebrochen. Mit oder ohne Tumult, für ein «sentimentales Revival der Vergangenheit», wie er es nennt, steht dieser Musiker jedenfalls nicht zur Verfügung, genauso wenig für eine «selbstreferenzielle Welt» der Cembalisten. «Ich bevorzuge es, Pianisten als meine Kollegen zu sehen, die grösste Inspiration für mich als Spieler ist Grigory Sokolov. Cembalo ist nur das Instrument, auf dem ich mich am besten ausdrücken kann. Und seien wir ehrlich: Wir spielen Instrumente, weil wir nicht singen können. Ich kann’s nicht.» Er lacht. «Niemand will mich singen hören!»
Fragt man Esfahani nach grossen Vorbildern, geht er weit zurück. «Wenn wir Wanda Landowska nicht erwähnen, belügen wir uns.» Die 1879 in Warschau geborene Musikerin spielte auf einer Spezialanfertigung mit Eisenrahmen und sieben Pedalen, nicht historisch korrekt, aber bahnbrechend, sie inspirierte Komponisten und Musiker wie Ralph Kirkpatrick, einen weiteren Helden von Esfahani. «Schon früh in seiner Laufbahn hat er neue Musik aufgenommen, das Konzert von Manuel de Falla. Kirkpatrick und Landowska haben die fundamentale Frage gestellt: Gibt es Grenzen für das, was dieses Instrument kann? Es gibt etwas Tieferes in uns, wofür wir das Instrument nutzen. Wir müssen es ohne Limits sehen, sonst sehen wir sie in uns.» Auch die Limits einer quellennahen Aufführungspraxis stehen ihm nicht im Weg, wenn ihn etwas berührt. Mahan Esfahani findet, die remasterten Aufnahmen von Růžičková klingen «wie gestern gespielt, abgesehen vom Instrument natürlich, während einige Pioniere des Cembalospiels, die zu ihrer Zeit Autoritäten der Authentizität waren, jetzt verwelkt klingen. Auch der Beethoven von Claudio Arrau klingt nach seiner Zeit, seinem Platz, obwohl er ein toller Pianist war. Wie geht das zu? Es ist ein Rätsel. Warum nehmen wir auf? Für jetzt, oder damit es in fünfzig Jahren jemand versteht?» Vielleicht ist es wie mit einem Kuss, schlage ich vor. In fünfzig Jahren zählt er nichts, aber im Moment ist es das wichtigste Ereignis, das man sich vorstellen kann. «So hätte ich es nicht gesehen», meint er, «aber es ist ein sehr guter Punkt». Dazu passt, dass er im Lockdown zu Hause viele halb vergessene Stücke gehört hat, Ouvertüren von Sullivan, Oratorien von Gounod, ein Klavierquartett von Amy Beach. «Es machte Spass, und kein Komponist oder Interpret brüllte mir dabei ins Ohr, wie wichtig er ist. Es passt schon, dass Corona im Beethovenjahr ausbrach. Ich liebe Beethoven, aber Gott bewahre uns vor seinen Bewunderern, in deren Augen er die EU unterstützt, die Flüchtlinge, diese Regierung, aber nicht jene. Ich war davon so müde!» Und er setzte sich ans Clavichord, dieses überaus leise und sensible Hausklavierchen, «mein absolutes Lieblingsinstrument», das jeder Cembalist des 18. Jahrhunderts ebenso spielte wie die Orgel. «Lustig, dass ich in Zürich Organist sein werde!»
Inzwischen ist die nächste Komposition für Mahan Esfahani in Arbeit. Im November wird in Köln Standstill von Miroslav Srnka uraufgeführt, mit dem Gürzenich-Orchester. Wie ist es, als Interpret eine neue Partitur zu erkunden? «Ich gestehe Ihnen etwas, nämlich, dass ich die Stücke oft jahrelang nicht verstehe. Es ist ein langer Prozess. Aber mein Job ist nicht, sie komplett zu verstehen, sondern sie zu spielen. Man muss für die Musik den Raum zum Existieren schaffen. Wenn wir jetzt das Wohltemperierte Klavier spielen, verstehen wir dann Bach? Es wird immer ein Geheimnis bleiben. Das heisst nicht: stop working. Wir arbeiten weiter am Verstehen.»
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.