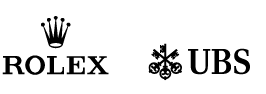La fanciulla del West
Oper in drei Akten von Giacomo Puccini (1858-1924)
Libretto von Guelfo Civinini und Carlo Zangarini
nach David Belascos gleichnamigem Bühnenstück
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 45 Min. inkl. Pause nach dem 1. Akt nach ca. 1 Std. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
La fanciulla del West
Kurzgefasst
La fanciulla del West
Giacomo Puccinis 1910 uraufgeführte Oper wird gerne als Western mit Saloon und rauchenden Colts auf die Bühne gebracht, aber der Regisseur Barrie Kosky erzählt die Geschichte um die Barbesitzerin Minnie, die alleine unter Männern in einem Goldgräbercamp im amerikanischen Westen lebt, in seiner Zürcher Inszenierung als einen Thriller desolat vereinsamter Menschen, die «in der letzten Bar, im allerletzten Dorf, am gottverlassenenen Ende der Welt» verzweifelt um ihre Existenz und ihre Erlösung durch die Liebe kämpfen. Kosky hat sich dabei von den Stilmitteln des grossen amerikanischen Kinos inspirieren lassen, das Puccini mit dem filmischen Spannungsaufbau und seinem kompositorischen Realismus in seiner Partitur vorausahnte. Die heruntergekommene Welt einer verdreckten Bar, Minnies Hütte als enges ärmliches Zimmer und eine verschlammte Hausruine im Gangsterjagd-Finale liefert ihm den äusseren Rahmen für spannungsvolle szenische Konkretion: Kosky bringt einen packenden Puccini-Krimi mit Liebes- und Actionelementen auf die Bühne. Wie schon in der Premiere bilden die charismatische Catherine Naglestad in der Rolle der Minnie und der starke Charakterdarsteller Scott Hendricks als raubeiniger Sheriff Rance dabei ein höchst theaterwirksames Gegenspieler-Paar. Brandon Jovanovich – als Sergej, Florestan oder Tambourmajor in Zürich bestens bekannt – gibt sein Debüt in der Tenor-Glanzrolle des Dick Johnson.
Portrait

Von Kritikern, die auch Regisseure gerne in Schubladen stecken, wird die Arbeit von Barrie Kosky oft mit den Attributen «Glitzer, Glamour, Showbiz» versehen. Wohl tragen die Inszenierungen von Cole Porters Musical Kiss me, Kate oder Paul Abrahams Operette Ball im Savoy, die Kosky 2008 und 2013 an der Komischen Oper Berlin in Szene setzte, derlei Attribute durchaus zu recht. Um die ganze Bandbreite des Australiers, der seit 2012 Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper ist, zu beschreiben, greifen sie indes zu kurz. Denn Arbeiten wie der Doppelabend aus Purcells Dido and Aeneas und Bartóks Herzog Blaubarts Burg 2010 an der Oper Frankfurt, Dvořáks Rusalka 2011 an der Komischen Oper Berlin oder Glucks Armide 2013 in Amsterdam – um nur drei Beispiele aus einer langen Reihe zu nennen – lassen in ihrer Sparsamkeit der Mittel und ihrer fast spartanisch zu nennenden Konzentration auf die Darsteller Attribute wie «Glamour» oder «Showeffekt» geradezu absurd erscheinen. Eine gemeinsame Marke lässt sich freilich auch für die drei letztgenannten Produktionen aufgrund ihrer so unterschiedlichen Ästhetik schwerlich finden.
In der Tat ist Barrie Kosky einer der wenigen Regisseure, der sich mit seinen Arbeiten jeglicher Festlegung auf einen einheitlichen (Personal)Stil entzieht und stattdessen immer wieder mit einer vollkommen neuen Ästhetik zu überraschen vermag. Sein Markenzeichen ist, dass er sich kein Markenzeichen aufkleben lässt. Die ganze Palette ästhetischer Möglichkeiten steht ihm zu Beginn einer jeden Inszenierungsarbeit ohne selbst auferlegte Beschränkungen zur Verfügung. Manchmal scheint es fast so, als suche sich das zu inszenierende Stück selbst die jeweilige eigene Ästhetik aus.
Am Anfang der Beschäftigung mit einem Stück steht bei Kosky bezeichnenderweise sehr oft ein einzelnes kraftvolles Bild. Bei Brittens Peter Grimes 2007 an der Staatsoper Hannover waren dies Hunderte von Holzkisten unbekannten Inhalts, die im Verlaufe des Stückes zu immer wieder neuen Anordnungen umgebaut, gestapelt, verschoben wurden.
Für Wagners Rheingold – ebenfalls an der Staatsoper Hannover – war es das Bild tanzender Showgirls mit üppigem weissem Federschmuck, die einen vor Geilheit lechzenden, als schwarz geschminkter MinstrelSänger kostümierten Alberich mit ihren Federfächern zum Niesen brachten. Im Orpheus, dem ersten Teil der MonteverdiTrilogie, mit der Kosky 2012 seine Intendanz an der Komischen Oper Berlin einläutete, war es das in Ovids Metamorphosen überlieferte Bild von Orpheus’ tragischem Ende – wilde Mänaden reissen den Körper des unglücklichen Sängers in Stücke –, das ganz am Anfang des kreativen Prozesses stand (und dann am Ende in einer von einem Figurenspieler geführten, zerlegbaren Orpheus-Puppe seine Umsetzung erfuhr).
Derlei UrBilder werden im Laufe des Vorbereitungsprozesses weiterentwickelt, sie erzeugen neue, weitere Bilder, werden modifiziert, verworfen, wiederaufgenommen, bis sich über einen längeren Zeitraum hinweg ein immer dichteres Gewebe an Bildern entwickelt hat, das am Ende das ganze Werk umspannt. In diesem Sinne ist Kosky kein Konzeptregisseur, der ein Stück zunächst rein theoretisch analysiert und aus dem darüber gefundenen Konzept eine bildnerische Umsetzung entwickelt. Im Zentrum seiner Arbeit steht vielmehr von Anfang an das theatrale Bild. Vielleicht ist genau dies das Geheimnis seines Erfolgs bei einem sehr breit gefächerten Publikum?!
Auf eine rational nicht immer nachvollziehbare Weise enthüllen die Ur-Bilder einer KoskyInszenierung gleichsam im Nachhinein ihre tiefere, über die offensichtliche Aussage weit hinausgehende Bedeutung, fügen sich die aus dem anfänglichen Bild entwickelten Bilder am Ende in der Tat zu einem stringenten Konzept zusammen. Denn was Kosky in einem ersten Schritt «aus dem Bauch heraus» zu erschaffen scheint, ruht auf dem Fundament einer umfassenden Bildung.
Als Enkel jüdischer Auswanderer aus Russland, Polen und Ungarn im australischen Melbourne aufgewachsen, ist Kosky ein wahrer Kosmopolit, dessen Bildungshorizont keinesfalls an den Grenzen der «Alten Welt» endet. Seine Inspirationen schöpft er aus südamerikanischer Literatur ebenso wie aus der europäischen Malerei, aus der Geschichte seines Heimatlandes Australien ebenso wie aus der jüdischen Kultur. Dass er ein begeisterter Kinogänger ist, versteht sich fast von selbst. Berühmt sind die Vergleiche zwischen Kunst und Esskultur, die der kulinarische Geniesser Kosky gerne zieht: Rameaus Castor et Pollux sei wie Monteverdis Orpheus, heisst es da, aber ohne Knoblauch! Eine gute Aufführung müsse wie eine Meringue Lemon Tarte sein: eine gute Mischung aus süssem Baiserschaum, säuerlicher Zitronencrème und festem Mürbteig. Und um seine Sicht auf ein Werk in wenigen Worten zu umreissen, mischt er gerne Vergleiche wie Zutaten zu einem Gericht: Da wird Mozarts Die Hochzeit des Figaro zu einer Mischung aus Luis Buñuels Der diskrete Charme der Bourgeoise und dem berühmten Marx Brothers Film Duck Soup (deutscher Titel: Die Marx Brothers im Krieg), in Cole Porters Kiss me, Kate treffen laut Kosky Edward Albees Wer hat Angst vor Virginia Woolf und die Muppets-Show aufeinander.
Wie er selbst sich in keine Schublade einordnen lässt, so ist auch Kosky jegliches Schubladendenken fremd. Er liebt Shakespeare genauso wie die Simpsons, die Marx Brothers nicht weniger als Mozart. Vor allem aber liebt er stets die Figuren des Stückes, an dem er gerade arbeitet, – und das ohne Ausnahme. Gerne führt Kosky Mozart, Janáček und Tschechow als Beispiele für Komponisten bzw. Autoren an, die keines der durch sie zum (Bühnen)Leben erweckten Geschöpfe be oder verurteilen. Das käme auch Barrie Kosky niemals in den Sinn. Er liebt Rusalka ebenso wie den Prinzen, der sie verrät, fühlt mit dem treulosen Grafen Almaviva ebenso wie mit dem schlauen Figaro, versteht die egozentrische Sängerin Tosca ebenso wie den sadistischen Polizeichef Scarpia.
Dass Richard Wagner im Gegensatz dazu mittels seiner Musik immer wieder für oder gegen die Protagonisten seiner Opern Stellung bezieht, ist sicherlich – neben dem offenen Antisemitismus in einigen seiner Werke – ein entscheidender Grund für Koskys immer wieder auch öffentlich bekundete Skepsis im Umgang mit dem Werk Wagners – wenngleich er ehrlicherweise die Faszination, die Wagners musikdramatischer Instinkt und seine oftmals aus einer visuellen Inspiration entstandene Musik ausüben, keinesfalls leugnet. Mit einem surreal verstörenden Fliegenden Holländer und einem nicht die Weite des Raums, sondern die (bürgerliche) Enge eines Zimmers auslotenden Tristan (beides am Aalto Theater Essen) und einem immer wieder mit neuen, ebenso fantasievollen wie irritierenden Bildwelten überraschenden Ring in Hannover hat Kosky durchaus neue Sichtweisen auf das Werk Wagners eröffnet. Vielleicht ist dies ein weiterer Grund für Koskys Erfolg gerade bei Operngängern in Europa: sein unbefangener, gleichwohl alles andere als ignoranter Blick von aussen auf scheinbar allzu Bekanntes, oft Interpretiertes – ein Blick, in dem die europäischen und die aussereuropäischen Wurzeln Koskys den Regisseur zu faszinierend neuen Sichtweisen führen.
Wagners epische Breite allerdings ist und bleibt für das Energiebündel Kosky ein Problem. Denn in allem, was er tut, ist er ein Rastloser. Kein Wunder, dass auch seine Inszenierungen in den meisten Fällen von Tempo und Energie nur so strotzen. Die Proben mit Barrie Kosky sind Hochleistungssport, wobei der Trainer selbst als wahrer «Einheizer» die meiste Energie verbrennt – die ihm auf beinahe mysteriöse Weise in offenbar unerschöpflichem Masse zur Verfügung zu stehen scheint. Wie er alle Figuren des zu inszenierenden Stückes liebt, so gilt Koskys Zuneigung auch seinen Darstellern – mit all ihren Ecken und Kanten! Mag am Anfang einer Inszenierungsarbeit ein ganz persönliches Bild des Regisseurs stehen, so steht am Ende für Kosky immer der Darsteller mit seinen individuellen Möglichkeiten. Niemals würde er am Darsteller «vorbei» inszenieren oder einem Sänger oder einer Sängerin eine Idee aufzwingen. Auch die schönste Idee, das schönste Bild werden verworfen, wenn sie sich in der Probenarbeit als wirkungslos erweisen. Und geändert wird bei Kosky tatsächlich bis zum Schluss, zur Not auch noch nach der Generalprobe!
Dass Barrie Kosky nicht müde wird, nach immer neuen ästhetischen Lösungen zu suchen, zeigt sich auch an der Wahl seiner Ausstatter: Anders als viele andere Regisseure arbeitet er nicht nur mit einem oder zwei Bühnen bzw. Kostümbildnern kontinuierlich zusammen, sondern mit vier bis fünf Teams, deren Ästhetik sich obendrein erheblich voneinander unterscheidet. Die oftmals kargen Bühnenwelten einer Katrin Lea Tag (Ausstatterin u.a. bei Dido and Aeneas/Herzog Blaubarts Burg, Armide oder der MonteverdiTrilogie) haben kaum etwas gemein mit den imposanten Räumen eines Klaus Grünberg (Bühnenbildner u.a. bei Kiss me, Kate, Rusalka, Der Ring des Nibelungen oder Ball im Savoy). Und selbst in dieser Vielfalt richtet sich Kosky nicht gemütlich ein, sondern ist fortwährend auf der Suche nach neuen, künstlerisch spannenden Partnern für seine Arbeiten: La fanciulla del West ist die erste gemeinsame Arbeit mit dem Bühnenbildner Rufus Didwiszus.
Die Liebe zu Puccini übrigens, die hat ihm seine ungarische Grossmutter eingepflanzt, als sie dem siebenjährigen Barrie eine Schallplatte von Madama Butterfly schenkte, um ihren Enkel damit auf dessen ersten Opernbesuch vorzubereiten. Aus der Liebe zu Puccini wurde schnell eine Liebe zum Genre Oper insgesamt. Kaum zu glauben, dass er erst jetzt zum allerersten Mal eine PucciniOper inszeniert – nämlich La fanciulla del West, laut Kosky eine Mischung aus Tennessee Williams, Sergio Leone und Janáčeks Aus einem Totenhaus.
Ulrich Lenz ist Chefdramaturg der Komischen Oper Berlin und hat in vielen Inszenierungen als Dramaturg eng mit Barrie Kosky zusammengearbeitet.
Die Einsamkeit:
In den Minen der Welt wühlen Männer bis heute Tag für Tag, ohne jedes Sonnenlicht, verdreckt und verschwitzt, unter schlimmen körperlichen Qualen in der Erde. Darin liegt etwas Tragisches. Die Männer sind getrieben von einem starken Eroberungswillen. Sie graben nach Reichtum in Form von Gold oder Diamanten. Sie wollen ihr Glück machen. Aber für die meisten von ihnen bleibt diese Suche eine Geschichte der Vergeblichkeit. Sie erleben nichts als Frustration und Verzweiflung. Oder sie sind von vornherein nur sklavengleiche Arbeiter ohne jede Hoffnung auf das grosse Glück, weil sie den Profit für ausbeuterische Arbeitgeber zutage fördern müssen. Auch die Goldgräber in der Oper La fanciulla del West sind gescheiterte Glückssucher. Das Stück spielt für mich nicht im Wilden Westen, sondern in einer grossen Einsamkeit.
Die Heimatlosen:
Eines haben alle Figuren in La fanciulla del West gemeinsam: Sie sind getrennt von ihren Familien und weit weg von zu Hause. Sie sind heimatlos. Man sagt, dass die moderne Welt die Menschen entwurzele und vielen die Heimat raube. Dafür gibt es viele aktuelle Beispiele, von den afrikanischen Flüchtlingen, die Woche für Woche auf der Insel Lampedusa stranden, bis zu den asiatischen Wanderarbeitern, die in den arabischen Emiraten Fussballstadien in die Wüste bauen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Heimatlosigkeit nur ein Phänomen der Moderne ist. Sie begleitet die menschliche Existenz über alle Zeiten hinweg und an alle Orte. Wir leben alle im Exil, und die Dinge, die uns vermeintlichen Halt geben, sind viel fragiler als wir wahrhaben wollen. Vielleicht hat diese Sicht mit meiner jüdischen Herkunft zu tun.
Das Tierische:
Wenn Männer unter sich sind, bricht in ihnen etwas Animalisches durch – die Gewaltbereitschaft des Rudels, ein archaischer Konkurrenzkampf, Kreatur gegen Kreatur, der zähnefletschende Streit um das letzte Stück Fleisch. In der Welt von La fanciulla del West gibt es nur eine einzige Frau, nämlich Minnie, die die Männer durch ihre Anwesenheit zähmt. Aber das Tierische kann in dieser Konstellation ganz schnell durchbrechen. Ich glaube überhaupt, dass die Zivilisation nur eine ganz dünne Haut über dem Barbarischen im Menschen ist. Sie kann jederzeit reissen. Es gibt keinen Fortschritt in der Zivilisation von der Steinzeit bis heute. Die Haut muss durch Liebe, Bildung, Kultur immer wieder neu gebildet werden, wie es Mininie tut.
Die grosse Leere:
Unsere La fanciulla del WestProduktion spielt in der letzten Bar im letzten Dorf im letzten Land am Ende der Welt. Der Ort ist von allem, was wir Zivilisation nennen, abgeschnitten. Gottverlassen, öde, freudlos. Es ist der Gegenort zum Paradies – ein AntiEden. Ich würde es nicht als Hölle bezeichnen, denn in der Hölle gibt es ja starke Anwesenheit, etwa von strafenden Mächten. Im AntiEden von La fanciulla herrscht nur grosse Abwesenheit, eine deprimierende Leere. Solche Orte findet man in der Wirklichkeit überall. Es kann der Vorort einer Megacity sein oder ein weltvergessenes Provinznest irgendwo im entlegenen Osteuropa, wie sie der geniale ungarische Filmemacher Bela Tarr in seinen Filmen gezeigt hat.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
Das Bühnenbild von La fanciulla del West stellt auf den ersten Blick kein technisches Problem dar: Die Wände und der Boden vom ersten und zweiten Bild sollen aus oxidierten Metallplatten bestehen, der dritte Akt soll eine nassfeuchte Erdlandschaft darstellen, die von alten, teilweise beschädigten weissen Wänden umgeben ist. Das klingt einfach, doch diese Wünsche stellen im Bühnenbetrieb komplexe Aufgaben dar. Eine Wand muss am Theater möglichst leicht und stabil gebaut werden. Leider sind Bleche entweder so schwer, dass kein Techniker sie tragen kann, oder so dünn, dass sie schnell Dellen bekommen. Andererseits haben Bleche einen bestimmten Glanz, den man mit einem andern Material so nicht hinbekommt. Unser Projektleiter Moritz Noll konstruierte deswegen die Wände aus leichten, stabilen Kunststoff-Platten, deren Oberfläche mit einer dünnen Metallschicht belegt ist. Diese Platten wurden in einer Druckerei mit dem von Bühnenbildner Rufus Didwiszus vorgegebenen Design einer oxidierten Zinkplatte bedruckt und von unserer Schreinerei auf Lattenrahmen geklebt.
Die Wände des dritten Aktes sollen aussehen wie dicke, weiss verputzte Holzplatten, die im Laufe der Jahre beschädigt und löchrig wurden. Die Ränder dieser Löcher wirken zerfasert und sind im Innern bereits modrig. Zerstörte Wände sind nicht einfach herzustellen. Meistens geben unsere Theater-Wände vor, etwas zu sein, was sie nicht sind: Sie sehen aus wie Ziegelsteine, Beton, Marmor oder eben Metall, sind aber aus viel leichteren Materialien gebaut. Wenn wir nun in unsere «Zinkwände» Löcher machen würden, sähe man sofort den Kunststoff, aus dem die Wände gebaut sind. Ausserdem brechen diese zähen Kunststoffplatten nicht, sondern verbiegen sich nur. Damit die beschädigten Wände nicht nach kaputten Sperrholzwänden aussehen, haben wir diese im Bereich der Beschädigungen aus Faserplatten gebaut. Diese wurden eigenhändig von Rufus und seinem Mitarbeiter Jan Freese eingeschlagen. Die übrig gebliebenen Ränder und Fetzen hat die Theaterplastik rückseitig mit Montageschaum so stabilisiert, dass sie beim Transport nicht weiter zerfallen. Dann wurden die Wände verputzt und von der Theatermalerei «vermodert».
Die nass-feuchte Erdlandschaft ist zunächst aus Styropor modelliert worden, der anschliessend mit Jute, Korkstückchen, flexibler Fassadenreperaturmasse und Torf beklebt wurde. Alle Materialien mussten gegen Feuer imprägniert werden. Darauf kam schwarze Farbe, teilweise so glänzend, dass es triefend nass aussieht. Das Ergebnis ist eine nachgiebige Oberfläche , die sich wie feuchte Erde verhält, aber die Kostüme nicht verdreckt, nicht brennt, keine Allergien auslöst, leicht ist, nicht schimmelt, nicht austrocknet und nicht schlecht riecht!
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Beitrag ist erschienen im MAG
MAG, das Magazin des Opernhauses, können Sie hier abonnieren.