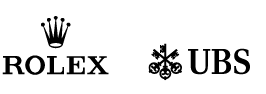Simon Boccanegra
Melodramma in einem Prolog und drei Akten von Giuseppe Verdi (1813-1901)
Libretto von Francesco Maria Piave, mit Ergänzungen von Giuseppe Montanelli,
nach dem Drama «Simón Bocanegra» von Antonio García Gutiérrez
Neufassung von Arrigo Boito
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 2 Std. 50 Min. inkl. Pause nach dem 1. Akt nach ca. 1 Std. 25 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Vergangene Termine
September 2024
Oktober 2024
Gut zu wissen
Simon Boccanegra
Kurzgefasst
Simon Boccanegra
Christian Gerhahers Rollendebüt als Simon Boccanegra am Opernhaus Zürich fand grosse öffentliche Beachtung: «Man spürt in jeder Sekunde, wie tiefschürfend er sich mit der Figur auseinandergesetzt hat», kommentierte 2020 etwa der Bayerische Rundfunk. Nun ist der gefeierte Bariton zurück und steht erneut im Zentrum von Verdis Partitur, die ganz von düsteren Stimmungen und Konflikten zwischen tiefen Männerstimmen geprägt ist.
Die Oper aus Verdis mittlerer Schaffensphase ist ein historisch inspiriertes Drama um den gesellschaftlichen Aussenseiter Simon Boccanegra, der im 14. Jahrhundert zum ersten Dogen der Stadt Genua gewählt wird. Sein Konkurrent ist der Bass Jacopo Fiesco, der die Macht des Adels repräsentiert. Vor diesem politischen Konflikt zwischen zwei Gesellschaftsschichten interessiert sich Verdi aber auch für die zerrütteten Familienstrukturen Boccanegras, der vom Tod seiner Geliebten erfahren muss und auch seine verlorene Tochter wiederfindet. Die dritte tiefe Stimme in diesem emotional aufwühlenden Drama ist der Bassbariton Paolo Albiani, der sich von Boccanegras Freund zu dessen Todfeind wandelt und das tragische Ende dieser Oper herbeiführt.
Andreas Homokis Inszenierung fokussiert sich in Christian Schmidts labyrinthartiger Bühne ganz aufs Kammerspiel. Homoki schuf differenzierte Charaktere und einen stringenten und spannungsgeladenen Erzählbogen. Den verschiedenen Zeitebenen der Handlung entsprechend, öffnet seine Inszenierung aber auch imaginäre Räume der Erinnerung.
Interview mit Andreas Homoki

Dieser Artikel erschien im Dezember 2020.
Andreas Homoki, die Oper Simon Boccanegra wurde 1857 am Teatro la Fenice in Venedig uraufgeführt und war zunächst kein Erfolg. Noch heute hat sie den Ruf, «ein Verdi für Kenner» zu sein. Woran liegt das?
Ein zentraler Grund dafür ist sicher die ungewöhnliche Figurenkonstellation dieses Stücks, das wie Il trovatore auf einem Drama des Spaniers Antonio García Gutiérrez basiert. Diese Konstellation unterläuft die Erwartungen, die man an eine Oper des 19. Jahrhunderts für gewöhnlich hat. Im Fokus steht hier nicht die Dramatik eines Liebespaars, das gegen gesellschaftliche Widerstände ankämpft, wie etwa in La traviata. Stattdessen entwickelt sich die Handlung im Spannungsfeld zwischen zwei politisch wie privat verfeindeten Männern, dem Bariton Simon Boccanegra und dem Bass Jacopo Fiesco.
Der Librettist Arrigo Boito, der 1881 zusammen mit Verdi eine stark überarbeitete Neufassung schuf, attestiert dem Stück «viel Intrige und nicht viel Zusammenhang». Empfindest du das als Regisseur auch so?
Nein. Es geht in der Handlung oft um Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen: Die Vorgeschichte um eine frühere Episode in Simon Boccanegras Leben wird retrospektiv in einem Prolog erzählt, der 25 Jahre vor der eigentlichen Handlung stattfindet. Diese sprunghafte Dramaturgie kann man als Problem auffassen. Als Regisseur empfinde ich sie aber als eine Bereicherung, weil sie mir die Möglichkeit gibt, von der realen Erzählebene wegzugehen und imaginäre Räume der Erinnerung und der Sehnsucht aufzumachen. Das war auch sehr früh konstituierend für das Bühnenbild von Christian Schmidt, das diese imaginären Räume auf einfache Weise herstellen kann.
Fordert Verdis Oper nicht ohnehin eher starke theatralische Situationen als eine realistische Erzählweise?
Stimmt. Verdi hält sich im Gegensatz zu den Komponisten der Generation von Boito oder später Puccini nie mit beschreibendem Kolorit oder der Schilderung eines Milieus auf. Sein szenisches Denken ist ausgesprochen anti-naturalistisch. Man staunt immer wieder, wie unglaublich offen Verdi ist in dem, was er von einer Bühne verlangt. Es zeigt sich da eine grosse Nähe und Geistesverwandtschaft zu Shakespeare, von dessen Stücken er fasziniert war. Man kann deshalb eigentlich jede Verdi-Oper mit ganz einfachen Bühnenmitteln aufführen. Vor 25 Jahren habe ich in Freiburg die erste Fassung des Simon Boccanegra inszeniert. Die Bühne bestand einfach aus einer grossen Treppe – eine typische Shakespearebühne.
In Zürich inszenierst du nun die revidierte Fassung, die 1881 an der Mailänder Scala zum ersten Mal gespielt wurde. Was sind die entscheidenden Unterschiede?
Sie entspricht ein bisschen mehr dem, was damals als modern empfunden wurde. Arrigo Boito hat viele Szenen detailreicher ausgearbeitet, was den von Verdi stets geforderten Prinzipien Einfachheit und Natürlichkeit eigentlich widerspricht. Das fand ich in früheren Auseinandersetzungen mit dieser Fassung eher ärgerlich. Die eigentliche Stärke der Fassung von 1881 ist aber ihr musikalischer Reichtum, der von Verdis fortgeschrittener Erfahrung als Komponist zeugt. Ganz besonders spüre ich im Finale des ersten Akts, das Verdi und Boito für diese Fassung komplett neu geschrieben haben, den Einfluss des Requiems, das Verdi in der Zwischenzeit komponiert hatte. Für mich ist das Requiem ein Schlüsselwerk in der kompositorischen Entwicklung Verdis, weil es durch und durch theatralisch gedacht ist, ohne an dramaturgische Notwendigkeiten einer äusseren Handlung gebunden zu sein. Ich habe das Gefühl, dass Verdi sich da musikalisch noch einmal eine neue Dimension erschlossen hat. Und aus dieser Erfahrung kann er bei der Neufassung von Simon Boccanegra nun schöpfen. Das grosse Concertato im Finale des ersten Aktes ist in seiner Darstellung einer kollektiven Situation und in der Entfaltung von Emotionen einfach atemberaubend. Allein deshalb ist es richtig, dass wir diese zweite Fassung spielen.
Wie fast immer bei Verdi sind die privaten Schickale auch in dieser Oper stark in einen politischen Kontext eingebunden. Was ist das in diesem Fall für ein Hintergrund?
Die Handlung bezieht sich auf ein historisches Ereignis im 14. Jahrhundert, als der Korsar Simon Boccanegra zum ersten Dogen von Genua gewählt wurde. Tatsächlich ist es aber eine zeitlose, geradezu archaische Konstellation des Übergangs von einer bis dahin fast rein aristokratischen Herrschaftsform hin zur politischen Einbeziehung anderer Gesellschaftsschichten. Das aristokratische System wird dadurch ausgehebelt, dass mit Simon Boccanegra ein Bürgerlicher, der als Seefahrer noch dazu ein politischer Aussenseiter ist, an die Macht kommt. Die Adeligen, zu denen Boccanegras Erzfeind Jacopo Fiesco gehört, versuchen sich im Verlauf der Handlung gegen den neuen Herrscher zu verbünden, gegen ihn zu putschen und ihn abzusetzen. Es ist eine klassische Situation, wie sie im Mittelalter durch das Vordringen des Bürgertums an mehreren Orten stattgefunden hat.
Eine solche Bewegung gab es im 14. Jahrhundert auch hier in Zürich: Rudolf Brun stürzte 1336 mithilfe der Handwerkszünfte den alten Rat, der bis dahin aus Adeligen und Notabeln bestand. Brun wurde der erste Bürgermeister von Zürich und regelte die Beteiligung der Zünfte an der Stadtregierung in einer Verfassung. In der Folge führte das aber auch zu blutigen Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern.
Vor dem politischen Hintergrund tut sich eine puzzlehafte dramaturgische Konstellation von privaten Zusammenhängen auf, die sich für die einzelnen Figuren erst im Lauf der Handlung aufklären... Was wird im Prolog erzählt, den Boito als «dicht und dunkel wie ein Stück Basalt» beschrieben hat?
Der Prolog beschreibt den Moment, in dem es einer bürgerlichen Mehrheit gelingt, den Aussenseiter Simon Boccanegra an die Macht zu bringen. Zufällig erfährt Boccanegra gerade in diesem Moment, dass seine Geliebte Maria – Fiescos Tochter, mit der er ein uneheliches Kind hat – gestorben ist. Das Ende des Prologs bildet also den grösstmöglichen Kontrast zwischen einem absoluten Triumph im Politischen und einer absoluten Katastrophe im Privaten: «Una tomba» hört man Boccanegra sagen, während Paolo Albiani, der Simone zur Macht verholfen hat, ruft: «un trono».
Das ist sehr wirkungsvoll, aber ein bisschen konstruiert...
Finde ich nicht. Verdi ist in seiner Gestaltung von Situationen immer viel glaubwürdiger, als es die Konstruktion des Librettos vermuten lässt. Durch Vereinfachung und musikalische Zuspitzung vermag er die Emotionen solcher Situationen sehr klar zu vermitteln. Man ist gut beraten, sich nicht zu sehr an der Oberfläche des Textes aufzuhalten, sondern auf die Musik zu hören. Da kommt dann eben dieses Shakespearehafte zum Tragen und das, was sich im Requiem in so purer Energie entfaltet.
Das gemeinsame Kind mit Maria, das zunächst verloren scheint, findet Simon Boccanegra 25 Jahre später wieder. Es trägt aber den Namen Amelia Grimaldi und liebt einen Adeligen namens Gabriele Adorno...
Der öffentliche politische Konflikt wird in der Fortsetzung der Handlung sozusagen in die Familie hineingetragen: Boccanegras Tochter ist als Waisenkind in die Familie Grimaldi aufgenommen worden, wurde adelig sozialisiert und hat sich in einen Adeligen verliebt. Die beiden politischen Extrempole spitzen sich also weiter zu, zumal Boccanegra es für besser hält, die wahre Identität seiner Tochter vorerst für sich zu behalten. Boccanegras Freund Paolo, der an Amelia interessiert ist, durchschaut diesen Zusammenhang nicht; und dieser private Umstand führt letztlich zu einer Intrige gegen den Dogen mit tödlichem Ausgang. Der politische Zwiespalt, der das Stück durchzieht, erlaubt es Verdi, Simon Boccanegra als einen klugen Herrscher zu zeichnen, der darauf bedacht ist, extreme Spannungen auszugleichen. Für Verdi spiegelte sich in dieser Thematik natürlich der Risorgimento-Gedanke in Italien wider, in dem er stets für das Vereinende eintrat, nie für das Trennende.
Im neugeschriebenen Finale des ersten Akts verstärken Verdi und Boito diesen Risorgimento-Gedanken, indem sie Boccanegra Worte des Renaissance-Humanisten Francesco Petrarca in den Mund legen, die zu Vereinigung, Liebe und Frieden aufrufen. Interessant ist allerdings, dass Boccanegra dem Volk, das in dieser Szene seinen Palast bedrängt, mit einer zweifelnden Haltung gegenübertritt...
Die zweite Fassung der Oper ist entstanden, nachdem Verdi sich für die Einigung Italiens stark gemacht und 1861 sogar kurze Zeit als Abgeordneter im ersten italienischen Parlament gesessen hatte. Er war in der Folge vom Ausbleiben eines sozialen Fortschritts aber schwer enttäuscht, und das zeigt sich hier auch. Verdi hatte keinen romantisch verklärten Begriff vom «Volk»; er weiss, dass es aus unterschiedlichsten Menschen besteht, dass es wankelmütig sein kann, und dass es eine wahnsinnig zerstörerische Kraft bis hin zu Bürgerkriegen entwickeln kann, wenn es gespalten ist, oder, wie in einer Diktatur, unterdrückt wird. Eine gute Regierung muss sich dessen bewusst sein und dafür sorgen, alle Interessen soweit auszugleichen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist.
Amelia ist die einzige weibliche Figur auf dieser von Männern dominierten Bühne. Sie wird als Tochter, Enkelin und Geliebte beansprucht und deshalb oft als passive und leidende Figur aufgefasst. Ist das auch deine Sicht?
Nein. Dass die Frauenfiguren in der Oper des 19. Jahrhunderts schwach seien, ist ein hartnäckiges Vorurteil. Das Gegenteil ist der Fall! Die Frauen hatten im 19. Jahrhundert in der Realität eine Stellung, die sie sowohl vom politischen Einfluss ausschloss als auch der Willkür der Familien auslieferte. Im Kontext dieser unglaublich begrenzten Möglichkeiten betrachtet, sind viele weibliche Figuren im Opernrepertoire des 19. Jahrhunderts unglaublich stark: Sie wachsen über die ihnen zugetrauten Rollenbilder hinaus, begehren dagegen auf, indem sie gegen die Gesellschaft Stellung beziehen, und begeben sich für die Verwirklichung ihrer Bedürfnisse nach Liebe und einer erfüllten Partnerschaft in hoffnungslose Situationen oder sogar in den Tod.
Das Jahrhundert Verdis prägt diese Oper also in verschiedenerlei Hinsicht. Hast du deshalb auch entschieden, die Mittelalter-Handlung ästhetisch näher an unsere Zeit heranzurücken?
Es war uns wichtig, die 25 Jahre, die zwischen Prolog und Haupthandlung vergehen, kenntlich zu machen. Der ästhetische Bruch zwischen 1335 und 1360 ist für den Zuschauer von heute aber überhaupt nicht nachvollziehbar. Eine vergleichbare und uns eher vertraute politische Situation, in der die aristokratischen Eliten vom Bürgertum verdrängt wurden, ist der 1. Weltkrieg. Deshalb siedeln wir die Handlung etwa zwischen 1895 und 1920 an, was uns erlaubt, den Zeitsprung von 25 Jahren deutlich und aus heutiger Perspektive nachvollziehbar zu erzählen.
Das Bühnenbild von Christian Schmidt hast du bereits angesprochen. Wie sieht Genua bei ihm aus?
Christian hat einen architektonischen Raum gestaltet, der sowohl private Innenräume als auch öffentliche Aussenräume darstellen kann, ohne Innen und Aussen allzu konkret voneinander abzugrenzen. Es ist ein geradezu labyrinthisch wandelbarer Raum, der uns eben auch erlaubt, mehrere Zeitebenen miteinander zu verbinden. Historische Architektur ist ja immer auch ein stummer Zeuge für Geschehnisse, die dort stattgefunden haben. So zeigen wir beispielsweise ein Bootswrack, das Assoziationen zu Boccanegras früherer Zeit als Seefahrer, aber auch zum Meer herstellt, das in der Hafenstadt Genua omnipräsent ist. Es wehen also auch Erinnerungen in diesen Raum.
Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist es nicht möglich, den Chor auf der Bühne auftreten zu lassen. Wie begegnest du diesem Problem?
Da es in diesem Stück explizit um die Kraft einer grossen Volksmasse geht, konnte ich es mir ohne Chorpräsenz auf der Bühne zunächst gar nicht vorstellen. Bei der genaueren Beschäftigung habe ich aber festgestellt, dass der Chor, insbesondere in seiner zentralen Szene am Ende des ersten Aktes, eine Kraft ist, die von aussen hereindringt. Indem wir nun nicht 60 ChoristInnen auf der Bühne zeigen, die «das Volk» repräsentieren sollen, sondern eine unbestimmte Menge von draussen hörbar machen, wird diese Volksmasse in der Vorstellung des Publikums eigentlich grösser! Ich würde es jetzt nicht zur Grundregel machen, Simon Boccanegra so zu inszenieren, aber unsere Version hat für mich eine volle Berechtigung und Gültigkeit, auch über die Corona-bedingten Abstandsregelungen hinaus.
Die Oper endet tragisch mit dem Tod von Simon Boccanegra. Sein einstiger Freund Paolo verwandelt sich in einen Intriganten, wird in einer spektakulären Selbstverdammungsszene schwer gedemütigt und vergiftet daraufhin den Dogen. Bleibt am Ende auch ein Hoffnungsschimmer?
Simon Boccanegra erreicht kraft seiner Persönlichkeit eine temporäre Beruhigung der bürgerkriegsähnlichen Wirren, und es kommt vor seinem Tod zu einer Versöhnung mit den Adeligen. In gewisser Weise kann man das als hoffnungsvolles Ende sehen. Leider gibt es unter den Überlebenden aber keinen einzigen Bürgerlichen. Man könnte das Ende also auch so auffassen, dass der Demokratisierungsversuch gescheitert ist, und eine leicht reformierte adelige Minderheit mit Adorno an der Spitze die Macht wieder übernimmt. Aber am Ende überwiegt einfach die Traurigkeit um das Leid und den Tod dieses stets um Ausgleich bemühten Menschen. Es bleibt die Aufforderung an uns alle, es weiter zu versuchen.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche
Pressestimmen
«Christian Gerhaher trägt viel dazu bei, dass dieser Simon Boccanegra besser ist als sein Ruf, vielschichtiger, stimmiger, persönlicher auch.»
Tages-Anzeiger, 08.12.20«Die Momentaufnahmen, die das Stück kontrastreich montiert, offenbaren Homokis genauen Blick für die einzelnen Figuren, die in ihren Nöten befangen sind. Die sich von ihren Illusionen blenden, von ihren Begierden treiben lassen.»
BR Klassik, 07.12.20«Wie Christian Gerhaher sich in die Rolle hineingekniet, vertieft hat – das kommt grandios rüber»
SWR, 07.12.20«Gerhaher legt gesanglich jeden Ton auf die Goldwaage, keine Wendung entgleitet ihm […] Alles wird rasend kompliziert und detailliert. Sehr fesselnd.»
Frankfurter Rundschau, 10.12.20
Interview

Ein Herrscher, der die Macht nicht will
Der gefeierte deutsche Bariton Christian Gerhaher gab im Dezember 2020 in Zürich sein Rollendebüt als Simon Boccanegra, und wie in seinen Liederabenden schaut er auch dieser Verdi-Figur ganz tief in die Seele. Ein Gespräch über die vielen Facetten eines scheiternden Regenten.
Dieser Artikel erschien im Dezember 2020.
Christian, wer ist dieser Simon Boccanegra, den du in Verdis Oper darstellst?
Verdi zeigt ihn in einer Handlungskonstruktion, die ich hochinteressant finde und die Seltenheitswert in der Opernliteratur besitzt. Man lernt Simon Boccanegra nämlich in einem Prolog kennen, in dem er als junger, kraftvoller Typ auftritt. Ein Held, der sich in Seeschlachten ausgezeichnet hat und – nach dem politischen Kalkül seines machthungrigen Ratgebers Paolo – der Doge von Genua werden soll. Das wird er auch am Ende des Prologs. Aber dann kommt der erste Akt, der spielt 25 Jahre später, und Simon Boccanegra ist ein völlig anderer Mensch. Das finde ich dramaturgisch grossartig: In einem prägnanten Prolog wird eine Figur angelegt und vorgestellt, die später so gar nicht mehr vorkommt.
Der Zeitsprung von 25 Jahren markiert einen Bruch in der Figur?
Genau. Der junge Simon will im Prolog überhaupt nicht Doge werden, die Macht interessiert ihn nicht. Aber er hat eine nicht standesgemässe Liebesbeziehung mit Maria, der Tochter des Patriziers Fiesco, aus der bereits ein Kind, eine Tochter, hervorgegangen ist. Sein Ratgeber Paolo führt ihm vor Augen, dass er diese Beziehung als Doge mit dem Ansehen, das das Amt mit sich bringt, legitimieren kann. Das ausschliesslich ist der Grund, warum Simon sich für die Dogenwahl zur Verfügung stellt. Kurz bevor er tatsächlich zum Dogen ausgerufen wird, erfährt er dann aber, dass seine Maria gestorben ist. Das heisst, es gibt für ihn keinen Grund mehr, Doge zu werden. Er verbindet keinerlei Ziele mit dieser Regentschaft. Er tritt das Amt aber trotzdem an und regiert während dieser 25 Jahre, die in der Oper nicht vorkommen. Was werden das für lange Jahre der Regentschaft gewesen sein? Ich stelle mir vor, dass er seinen Dienst als Doge ohne inneres Wollen im Hinblick auf Macht-Eitelkeiten und Selbstverwirklichung, auch ohne persönliche Liebe und Begehren vollkommen vernunftgesteuert und dennoch mit erheblichem Ethos versehen hat.
Es ist ja ein typischer Verdi-Moment, wenn im Prolog die beiden ambivalenten Informationen zusammenschiessen und Simone fast zeitgleich vom Tod der Geliebten und dem politischen Wahltriumph erfährt. Was geht da in seinem Kopf vor?
Ich weiss gar nicht, ob es wichtig ist, was er denkt. Das Entscheidende ist, dass in dem Moment seine ganze Lebenskonstruktion zusammenbricht. Alles ist vorbei. Seine Liebe ist tot. Die Zukunftspläne sind dahin. Ihm bleibt die Macht eines Amts, das er nicht will. In unserer Inszenierung zeigt Andreas Homoki das als einen Moment grosser persönlicher Bedrängnis. «Via fantasmi, via!» (Weg mit euch, Gespenster! Weg!) singt er an der Stelle.
Verdi entwirft also die Figur eines Herrschers, der ein völlig selbstentfremdetes Verhältnis zur Macht hat.
Das klingt jetzt ein bisschen negativ. Ich würde eher so sagen: Es ist ein Verhältnis zur Macht, das weniger durch persönliche Beweggründe motiviert, als eher von kühler, aber hingebungsvoller Rationalität geprägt ist.
Woraus leitest du seine Rationalität ab?
Er war wahrscheinlich impulsiv, stürmisch und gedankenlos, als er sich in diese problematische Liebe gestürzt hat, wie man halt ist, wenn man jung ist. Und er hat wohl auch einen Riesenfehler gemacht, sich der Liebe einfach so hinzugeben, ohne weiter zu denken, zumal er auch noch ein Kind mit Maria gezeugt hat. Marias Vater Fiesco wird ja oft als böse dargestellt. Aber ich kann ihn verstehen. An seiner Stelle wäre ich wahrscheinlich auch sauer über eine schwangere Tochter in einer solchen Beziehung. Und plötzlich ist diese ganz Liebe nur noch Geschichte, es gibt nur noch die Pflichten des Dogenamts. Was bleibt einem da anderes als der Verstand?
Simon Boccanegra ist einer, der gesellschaftlich von unten kommt. Er ist Seefahrer, kein Patrizier. Emporkömmlinge haben ja eigentlich ein sehr libidinöses Verhältnis zur Macht. Sie geniessen es, wenn sie oben ankommen.
Aufstiegsehrgeiz kann ich bei Simon als Triebfeder überhaupt nicht erkennen. Es ist schon erstaunlich, dass er sich als Herrscher so lange an der Macht hält, obwohl ihn kein Ehrgeiz treibt. Ich erkenne in der Figur nicht nur einen Realpolitiker, sondern auch einen, der fast schon rührend selbstvergessen handelt und ganz bewusst Verzicht übt.
Welchen?
Verzicht auf Selbstverwirklichung. Doge zu werden, war ja nicht sein Projekt. Er wollte eine Liebe leben. Mir kommt seine Amtsausübung wie eine Art Bussübung für den Tod seiner Geliebten vor. Das hat fast etwas Mönchisches.
Was ist das für ein Modell von Macht, das Verdi mit dem Dogen Boccanegra entwirft?
Simon mag eine in sich gebrochene Figur sein, aber Verdi hat ihn als einen guten Machthaber angelegt, als einen, der für Ideale einsteht. Er setzt sich dafür ein, dass die Feindschaft zwischen Venedig und Genua ein Ende hat. Wird das zurückgewiesen, legt er ein schmetterndes Bekenntnis zur Einigung Italiens ab. Verdis Wunsch zur politischen Versöhnung, zur Einigung und zur Gleichbehandlung aller Menschen spricht sich in Simon aus. In meinen Augen steht er fast für eine Art Sozialdemokratie. Klar gibt es auch Dinge, die diesem Bild widersprechen. Offenbar hat er den Vater von Gabriele Adorno ins Gefängnis gesteckt und umgebracht. Aber vielleicht ist das gar kein Zeichen für Tyrannei, sondern eher für Staatsräson mit den Mitteln der damaligen Zeit.
Ist dieser Simon Boccanegra auch eine Einsamkeitsfigur? Hat er Züge von Shakespeares Lear? Verdi hat sich ja mit dem Gedanken getragen, Lear zu vertonen.
Einsam ist Simon schon. Aber anders als bei Lear ist das bei ihm selbstgewählt, als eine Art Selbstbestrafung.
Selbstbestrafung wofür?
Es gibt einen dunklen Punkt in seiner Biografie: Er war seiner Tochter, die er gemeinsam mit Maria hat, kein guter Vater. Wir erfahren, dass die Tochter in der Fremde von einer Amme grossgezogen wurde und Simon offenbar nur ab und zu bei ihr vorbeigeschaut hat. Er hat sich nicht gekümmert und sein Abenteurerleben weitergelebt. Das holt ihn ein. Dass seine verlorene Tochter plötzlich in seinem Leben auftaucht, ist nach dem Tod seiner Geliebten Maria der zweite tragische Schock. Das wirft ihn aus der Bahn.
Die Tochter heisst Amelia und wuchs als Findelkind in der adeligen Familie der Grimaldis auf. Sie liebt ausgerechnet Gabriele Adorno, einen erklärten Feind von Simon Boccanegra.
Wenn er Amelia als seine Tochter erkennt, sieht er sich plötzlich mit seinen persönlichen Versäumnissen konfrontiert, und die wiegen schwer. Ich glaube, dass sie als Schuld auf ihm lasten, und dass sie womöglich viel eher der Grund für sein Sterben-Müssen sind als die Tatsache, dass er den ehrgeizigen Paolo enttäuschen muss, der ihn daraufhin vergiftet.
Du siehst also in der Vergiftung Simons weniger die Gewalttat des Verschwörers Paolo, als viel eher eine innere Selbstvergiftung?
Vielleicht kommt da das eine zum anderen wie eine schicksalhafte Fügung. Simon geht im dritten Akt nicht nur an der Wirkung des Gifts zugrunde, sondern auch an seinem gescheiterten Privatleben. Andreas Homoki hat sich in seiner Inszenierung früh darauf festgelegt, dass der Moment von Simons Wiederbegegnung mit Amelia und das Erkennen der Familienbande kein ausschliesslich freudiger, sondern ein konfliktbeladener ist. Bei ihm bleiben die beiden auf Distanz, und das hat an dieser Stelle ausnahmsweise nichts mit den Corona-Abständen zu tun. Es steht einfach zu viel zwischen den beiden, Schuldbewusstsein und dennoch eine Erwartungshaltung auf seiner, Vorwürfe und dennoch eine unmittelbare Tochterliebe auf ihrer Seite. Das ist ein hochbelastetes Vater-Tochter-Verhältnis. Nicht der Machtkampf mit Paolo fällt Simon, sondern seine privaten Probleme.
Eine Figur voll von Schattierungen und grosser dramatischer Fallhöhe, die Verdi da komponiert hat.
Ja. Spannend ist auch, dass die Handlung mit so vielen Rückblenden arbeitet. Immer wieder wird von Dingen erzählt, die vergangen sind. Das Entscheidende ist bereits Geschichte. Die Handlung findet, obwohl sie hochdramatisch ist, grossenteils in den Köpfen der Protagonisten statt, abgesehen von den schier unentwirrbaren Tumulten. Sie vollzieht sich weniger als in vergleichbaren Tragödien zwischen den Menschen als in den Menschen selbst und da vor allem natürlich in der Hauptfigur. Diese Selbstbescheidung Simons ist einfach aussergewöhnlich. Ich kenne keinen echten und überzeugt handelnden Machthaber im Opernrepertoire, der so alles von sich wegschneidet. Das finde ich unglaublich interessant. Deshalb wollte ich diese Rolle machen.
Was heisst das für dein Singen und dein Spiel?
Das weiss ich noch nicht, das finden wir gerade in den Proben heraus. Die Partie ist von zwei Klangwelten geprägt, auf der einen Seite gibt es viele dramatische Ausbrüche – vor allem im Finale des ersten Akts, wenn Simon für seine politischen Ideale eintritt. Da ist die Kraft des jungen Boccanegra noch spürbar. Demgegenüber stehen die etwas verhaltenen Töne – in der skelettartigen Dramatik des zweiten Akt-Finales, vor allem aber im dritten Akt, wenn er vergiftet ist. Auch das Duett mit Amelia ist sehr lyrisch. Und was ich sehr an dieser Partie schätze, ist das Deklamatorische, das den Übergang zum späteren Verdi ja generell kennzeichnet.
Wie singt man das Vergiftetsein?
Diese langen Sterbeszenen machen mir eigentlich keinen Spass. Das gehört für mich zu den Punkten, bei denen ich immer so meine Vorbehalte gegen Verdi hatte. Das nimmt ja kein Ende bei Gilda in Rigoletto, bei Violetta in La traviata, bei Rodrigo in Don Carlo. Mich nervt das an sich erst einmal. Aber dann spüre ich natürlich auch, dass es wie eine Verkörperung der Todesproblematik ist, dass der Tod, der bei Verdi eine zentrale Rolle spielt, in langen Szenen reflektierend beleuchtet wird. So gehe ich auch bei Simon an den dritten Akt heran. Ich versuche, mich nicht einen ganzen Akt lang siechend dahinzuschleppen. Das Sterben wird nicht zelebriert, sondern beleuchtet – so hat es Andreas auch szenisch angelegt. Simon geht am Ende ab, bevor er laut Partitur stirbt. Um zu vermeiden, dass die Sterbeszenen sentimental werden, kann man szenisch versuchen, eher nüchtern in den Gesten zu bleiben, und auch musikalisch finde ich es sinnvoll, etwa dem Schluss-Ensemble im dritten Akt eher sachlich zu begegnen und es auf keinen Fall mit Schmalz zu überziehen. Ich habe ja viel Schubert gesungen, da finde ich eine klangliche Sachlichkeit auch die beste Herangehensweise. Ich habe von Schubert nicht nur Lieder, sondern auch die Messen und beispielweise seine Oper Alfonso und Estrella gesungen. Und die kam mir damals schon in vielen Passagen wie früher Verdi vor. Hier wie da gibt es diese Kombination von Leichtigkeit und Höhe bei den Baritonen, die grausam schwer zu singen ist. Und dann gibt es diese wunderbar schwebenden Ensembles: Im Schluss-Quartett in Simon Boccanegra spüre ich auch wieder sehr stark diese Nähe zu Schubert. Das Quartett hat auch so eine ungebundene, abhebende Qualität. Und bei manchen melodiösen Einfällen denke ich oft: Das könnte auch ein Vorspiel für ein Schubert-Lied sein.
Nochmal zu den Sterbeszenen bei Verdi. Ich finde spannend an ihnen, dass sich da grosse innere Räume auftun, dass plötzlich ganz weit gedacht wird und sich Utopisches zeigt. Ist das bei Simon Boccanegra nicht auch so?
Doch. Der dritte Akt hat etwas von einem eschatologischen Gebilde, zumindest ab dem Moment, in dem Simon sich unerwartet mit Fiesco versöhnt. Diese Versöhnung zwischen Simon und Fiesco, bei der das Gute nochmals – unter allerdings sehr schwarzen Fahnen – siegt, finde ich hinreissend. Ob man den Schluss allerdings so positiv sehen kann, wie du ihn beschreibst, weiss ich nicht. Ich vernehme da schon viel Düsternis. Es stirbt halt einer, mit Aus- und Rückblick auf die letzten Dinge.
Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Verdi allgemein? Viele Partien hast du noch nicht gesungen, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich bin Sänger geworden wegen des Lied-Gesangs, wegen des deutschsprachigen zumal, und da liegt Verdi stilistisch doch ziemlich weit weg. Ich kann ja nicht einfach an ein italienisches Opernhaus gehen und sagen: Ich bin Schubert-Sänger, lasst mich doch mal den Nabucco singen. Nein, ich bin froh für das, was ich als Deutscher überhaupt im Verdi-Repertoire singen darf. Bisher habe ich nur den Posa in Don Carlo gemacht.
Simon Boccanegra ist deine zweite Verdi-Rolle überhaupt?
Naja, ich habe bisher auch nur zwei Wagner-Rollen gesungen. Ich muss ja nicht alles in der Oper singen, denn ich bin vor allem im Konzert zu Hause.
Aber du machst jetzt keinen Bogen um Verdi?
Ich wäre wegen Verdi nicht Sänger geworden. Der Wunsch, Verdi-Sänger zu werden, war in mir nicht angelegt. Aber ich lerne diese ganz besondere Welt ja jetzt erneut kennen – und schätze sie wahnsinnig. Wie könnte man das auch nicht, wenn man sich damit beschäftigt. Mir war bei Verdi früher immer ein Rätsel, was die Musik im Vergleich zum Inhalt eigentlich aussagen soll. Ich spüre da eine grosse Diskrepanz zwischen dem Darstellenden und dem Dargestellten, denn Verdis Musik erfüllt keine für mich unmittelbar ersichtliche Abbildfunktion, es gibt in ihr oft nur eine wenig augenfällige klanglich semantische Entsprechung zu der in der Handlung propagierten Welt, wenn es sowas überhaupt gibt. Das ist bei Wagner in meiner Wahrnehmung anders. Da gibt es eine inhaltlich-klangliche Homogenität, die vielleicht schneller einleuchtet.
Aber das ist ja gerade das Spannende an Verdi. Dass es ihm nicht darum ging, einen Stoff naturalistisch auszupinseln, sondern er sich immer für die theatralische Situation, den starken szenischen Moment interessiert hat.
Schon. Aber nicht unmittelbar, sondern übersetzt, und das immer in einer sehr typischen Klangsprachlichkeit. Jetzt, wo ich es singen darf, denke ich mir allerdings: Ist doch völlig egal. Es macht Spass. Ich finde es grossartig, das machen zu können. Verdi-Partien interessieren mich auch wegen der stimmlich-physiologischen Herausforderungen, an die seine Musik geknüpft sind – wie sie sich mir als Neuling eben darstellen. Man kann da nicht einfach nur herumbrüllen. Wenn du Verdi nicht wirklich schön singst, wenn du zu sehr stemmst oder zu eng in die Maske singst, ist die Musik in ihrer Substanz sehr schnell gefährdet. Man muss diesen offenen Klang produzieren, rund und gross. Je ungepresster die Stimme fliessen kann, desto sinnfälliger werden die Figuren. Das finde ich bei Wagner keine so stark ausgeprägteGefahr.
Gibt’s noch andere Verdi-Partien, die du gerne machen würdest?
Es ist nichts geplant. Aber interessieren würden mich schon noch ein paar Sachen, Rigoletto zum Beispiel oder der Renato in Un ballo in maschera. Wie realistisch das dann am Ende wirklich ist, muss man sehen.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Die geniale Stelle
Dieser Artikel erschien im Dezember 2020.
Anagnorisis nennt die Fachliteratur jene dramatische Standard-Situation, wo sich zwei Menschen nach langer Trennung überraschend wiederfinden und erkennen. Situationen dieses Typs finden sich seit der Antike in zahlreichen Dramen, und natürlich hat sich auch die Oper die emotionale Wirkung solcher Szenen nicht entgehen lassen. Ein besonders ergreifendes Beispiel findet sich im ersten Akt von Giuseppe Verdis Simon Boccanegra. Der Doge von Genua will Amelia Grimaldi mit seinem Günstling Paolo verheiraten. Als er ihr diesen Plan offenbart, stellt sich heraus, dass die vermeintliche Amelia seine seit mehr als 20 Jahren verschollen geglaubte Tochter Maria ist.
Wenn schon nach der Uraufführung der ersten Fassung von 1857 Stimmen laut wurden, die den «krausen» Handlungsaufbau der Oper bemängelten, der allen Regeln der klassischen Dramaturgie Hohn spricht, war sicher auch diese Szene gemeint, gegen die man durchaus vorbringen kann, dass sie wie mit der Brechstange in das Stück gehievt wirkt, weil sie nicht ausreichend vorbereitet ist und überdies nach der Regel in der Mitte des 2. Akts und nicht im ersten stehen müsste. Solche, zweifellos gut und richtig begründeten Einwände liessen sich noch lange fortsetzen. Und sicher spielten sie eine Rolle für Verdis Entschluss, das Libretto der Oper für die Wiederaufführung von 1881 durch Arrigo Boito, der zu dieser Zeit schon am Otello arbeitete, einer gründlichen Überarbeitung unterziehen zu lassen. Boitos Bestreben, die Handlung «logischer» aufzubauen und die scheinbare Sorglosigkeit der Dramaturgie zu steuern, waren freilich Grenzen gesetzt. Und das war vielleicht gut so, denn all die zweifellos gut und richtig begründeten Einwände werden durch die emotionale Wucht der Oper zunichte.
Und wie schon eine knappe Analyse dieser Szene zeigt, löst sich auch der oft erhobene Vorwurf der mangelnden dramaturgischen Sorgfalt sofort in Luft auf, wenn man die musikalische Gestaltung in die Betrachtung einbezieht. Wer sich dem erschütternden Sog dieser Szene aussetzt: vom Anfang mit der scheinbar harmlosen Konversation in B-Dur über den Moment der ersten Enthüllung («Ich bin keine Grimaldi»), der eine erste Unterbrechung setzt, durch die g-Moll-Passage der Erzählung über die Kindheit der Verschollenen mit der ergreifenden so überaus zärtlichen Wendung nach G-Dur, wenn vom Tod der Pflegemutter die Rede ist, über die anrührende Kantilene des Vaters, der seine Hoffnung kaum zu denken wagt, über die harmonisch unruhige Passage in stetig steigendem Tempo, die die Spannung ins Unerträgliche steigert, bis zur Explosion des vollen Orchesters in einem einzigen blendend hellen C-Dur-Akkord, der den Moment der Erkenntnis, des höchsten Glücks und des tiefsten Schreckens, markiert – wer sich dem aussetzt, wer diese Musik durch sich hindurch gehen lässt – nicht nur durch seinen Verstand, sondern auch durch seinen Körper – der wird keine erbsenzählerischen Einwände mehr erheben und gern zugestehen, dass es einfach falsch ist, ein Kunstwerk an Kriterien zu messen, denen es nicht gehorchen will.
Verdis Dramaturgie liegt wenig am Zusammenhang, um so mehr an der genauen Ausarbeitung der einzelnen Situationen. In ihnen verwirklicht sich das Schicksal der Figuren, ihnen gehört die ganze Liebe und Sorgfalt des Komponisten. Da es um die starke emotionale Wirkung der einzelnen Momente geht, die etwas darüber sagen, was es heisst, in dieser Welt Mensch zu sein, kann dem Zusammenhang geringere Bedeutung beigemessen werden, wie es bei einer Juwelenkette auf die Edelsteine ankommt, nicht auf die Schnur, die sie zusammenhält.
Werner Hintze
Fragebogen

Dieser Artikel erschien im Dezember 2020
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Aus den Vereinigten Staaten, wo ich im sonnigen Florida lebe! Simon Boccanegra ist meine erste Produktion nach einer endlos langen Liste von coronabedingten Absagen. Im Sommer habe ich viele Online-Meisterkurse für junge Künstler:innen auf der ganzen Welt abgehalten. Mit der Fort Worth Opera haben wir eine virtuelle «Artist Residence» auf die Beine gestellt mit Meisterkursen, die grosse Persönlichkeiten aus der Oper geleitet haben. Danach habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der junge KünstlerInnen auf ihre – ebenfalls virtuellen – Vorsingen vorbereiten sollte. Zusätzlich habe ich beim International Summer Opera Festival in Morelia in Mexiko und an meiner ehemaligen Universität, der Baldwin Wallace Universität, unterrichtet. Sommer und Herbst waren also ganz dem Unterrichten der nächsten Generation von Sängern gewidmet. Das war für mich sehr beglückend.
Was wollten Sie als Kind gerne werden?
Ich wollte unbedingt Köchin werden. Als Teenager habe ich für meine Familie gekocht – meine Spezialitäten waren Omelettes und Crêpes. Jetzt ist das Kochen mein tägliches Hobby geworden – es ist sehr entspannend für mich und hat eine therapeutische Wirkung. Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren und neue zu erfinden. Ich dachte immer, ich würde eine Kochlehre machen, doch dann stellte sich heraus, dass Musik und Oper meine wahre Leidenschaft sind.
Worauf freuen Sie sich in der Neuproduktion Simon Boccanegra besonders?
Es ist eines der herausforderndsten Werke, die Verdi je geschrieben hat – und eine seiner schönsten Opern. Ich freue mich, diese fantastische Musik auf der Bühne zum Leben zu erwecken. Und bei dieser Gelegenheit wieder mit Fabio Luisi zusammenzuarbeiten. Er ist mein Lieblingsdirigent. Er haucht den Stücken so viel Leben und Kreativität ein. Wir haben zuletzt in Florenz Mahlers «Sinfonie der Tausend» gemeinsam aufgeführt, und ich bin überglücklich, erneut mit ihm zu musizieren.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Während meines Studiums nahm ich an einem Austauschprogramm des Teatro Colón teil und kam so nach Buenos Aires. Mein Gastvater nahm mich am zweiten Abend in die Traviata mit. Ich hatte noch nie zuvor eine komplette Oper gesehen, und sie versetzte mich regelrecht in Trance. Es war eine unkonventionelle Aufführung in einer grossen Sportarena mit Kameramännern auf der Bühne, die ein Video auf gigantische Bildschirme projizierten. Während der ganzen Vorstellung sass ich gebannt auf der Stuhlkante. Ich war so berührt, dass ich zu meinem Gastvater sagte: «Das ist es, was ich tun muss!» Am nächsten Tag ging ich in die Bibliothek des Teatro Colón und lieh mir die Noten der Traviata aus.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Ich bin besessen von Lin-Manuel Mirandas Hamilton! Ich höre mir das Musical immer und immer wieder an. Ich liebe auch den Film, der im vergangenen Sommer herausgekommen ist, und könnte ihn mir ständig ansehen. Die Mischung der musikalischen Stile fasziniert mich sehr.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Der Lieblingsort meines Hauses ist der Swimmingpool. Das ist nun eher ein Outdoor-Objekt, aber ich vermisse ihn wirklich, wenn ich nicht zuhause bin. Wir leben im schönen Fort Myers in Florida, wo der Pool im Gegensatz zum Rest des Landes absolut notwendig ist. Mein Mann und ich haben dort draussen einen Fernseher aufgestellt und schauen während des Schwimmens Football – der Fernseher ist dann wohl eher ein überflüssiger Gegenstand?
Mit welcher Künstlerin würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Am liebsten mit der grossen türkischen Sopranistin Leyla Gencer, um sie über unser gemeinsames Fach auszufragen. Sie ist mein Idol. Immer wenn ich eine neue Rolle lerne, lasse ich mich von ihren Aufnahmen inspirieren. Ihre Einspielung von Simon Boccanegra mit Tito Gobbi ist für mich eine absolute Referenzaufnahme. Ihre Stimme war pure Magie – kräftig und durchdringend, wenn es sein musste, dann wieder sanft und delikat und mit dem staunenswertesten Pianissimo. Gerne möchte ich ihr Geheimnis hinter dieser perfekten Technik erfahren, das Geheimnis ihres Atems bei ihrem unglaublichen Legato und ihrer durchdringenden Spitzentöne, aber auch das Geheimnis ihrer leidenschaftlichen und tiefgründigen Rolleninterpretationen.
Was können Sie überhaupt nicht?
Ich kann absolut nicht zeichnen oder malen, liebe es aber, in Museen zu gehen. Ich kann ausserdem keinen Knopf annähen und bewundere deshalb umso mehr diejenigen, die Kostüme oder Mode kreieren können.
Haben Sie einen musikalischen Traum, der wohl nie in Erfüllung gehen wird?
Die Lucia di Lammermoor zu singen! Es ist die Rolle, von der ich immer geträumt habe. Ich begann zwar als Koloratursopran und sang am Konservatorium auch die Königin der Nacht, die Zerbinetta und sogar die Lucia – ich liebte diese Rolle, diese Musik und den Charakter so sehr – denn wer will nicht einmal die Wahnsinnsszene singen? Aber die Rolle der Lucia bleibt ein Traum, den ich nur unter der Dusche verwirkliche.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Weil wir auf der ganzen Welt Liebe, Kunst und Kultur kennen, sogar in Zeiten der Pandemie. Die Kreativität der Theater und der Künstler, die jetzt trotz allem weiterarbeiten, ist bewundernswert und motiviert mich. Die Unterstützung unseres Publikums, weiter Kunst zu machen, wenn auch in einem virtuellen Raum, zeigt doch, wie tief die Kultur in unserer Welt verankert ist. Das macht das Leben wirklich schön!
Essay
Dieser Artiekl erschien im Dezember 2020.
Am 20. August 2020 fliegt der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny von Tomsk nach Moskau. Kurz nach dem Start fühlt er sich plötzlich unwohl. Er geht zur Toilette. Wenig später hören Mitreisende schmerzerfüllte Schreie. Nawalny verliert das Bewusstsein. Das Flugzeug muss notlanden. Die Angehörigen des Politikers, der als scharfer Kreml-Kritiker bekannt ist, hegen sofort den Verdacht, dass es sich um einen Giftanschlag handeln könnte. Russische Ärzte dementieren diese Vermutung. Erst in der Berliner Charité, wohin Nawalny transportiert wird und wo er noch tagelang im Koma liegt, wird nachgewiesen, dass er mit einer bisher unbekannten Version des Nervengifts Nowitschok vergiftet wurde.
Der aufsehenerregende Fall aus jüngster Zeit könnte aus einem Thriller stammen, und diese Nähe zur Fiktion spricht Nawalny gleich selbst an, als er im Oktober 2020 dem Reportagen-Magazin The New Yorker ein ausführliches Interview gibt: Den Moment, in dem er vergiftet wurde, vergleicht er mit dem Kuss eines Dementors, eines jener todbringenden magischen Wesen aus Harry Potter, deren Gesichter stets unter einer grossen schwarzen Kapuze versteckt bleiben.
Giftstoffe üben seit jeher eine grosse Faszination aus: «Es gab keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der nicht Gifte durch ihre dämonische Eigenart schon an sich, und besonders dann Eindruck auf Menschen gemacht haben, wenn sie, gewollt oder ungewollt, ihre Kraft in ihnen entfalteten», so der deutsche Toxikologe Louis Lewin (1850-1929) in seinem Werk Die Gifte in der Weltgeschichte, in dem er Vergiftungsfälle seit der Antike untersucht. Alt und umfangreich ist auch die Bearbeitung des Topos für die Bühne: Schon der Mythos um Medea, den Euripides dramatisierte, erzählt, wie Kreons Tochter in einem vergifteten Kleid einen grauenvollen Tod findet; exzessive Ausmasse nehmen die Giftintrigen in William Shakespeares Hamlet oder Victor Hugos Lucrèce Borgia an. Oft sind es Frauen, die über die nötigen Gift-Kenntnisse verfügen: Auf der Opernbühne beispielsweise auch Schostakowitschs Katerina Ismailowa, jene Lady Macbeth von Mzensk, die dem Pilzgericht ihres Schwiegervaters eine Prise Rattengift beimischt.
Mit einem Gifttod endet auch Giuseppe Verdis Oper Simon Boccanegra. Wie im Fall von Alexei Nawalny wird auch dort ein Politiker Opfer eines Giftanschlags. Modell für Verdis Drama stand allerdings kein Oppositionspolitiker, sondern der erste Doge der Republik Genua, auf den in der Realität mehrere Giftanschläge verübt wurden – der letzte, 1363, mit tödlichem Ausgang.
Die Wirkung eines Giftes kann sehr leise einsetzen. Nawalny glaubt, dass er die Nowitschok-Substanz irgendwo angefasst haben muss. Auf einem Türgriff vielleicht. Diese Unsichtbarkeit und die Gefahr, potenziell überall verborgen zu sein, macht Gift als Waffe so unheimlich. «Es erschreckt Menschen sehr effektiv», sagt Nawalny.
Ganz ähnlich hat das 1818 schon E. T. A. Hoffmann in seiner Erzählung Das Fräulein von Scuderi geschildert. Der Anlass ist dort ein «geheimnisvolles Kästchen», das mitten in der Nacht für das Fräulein abgegeben wird. Der Erzähler berichtet von «verruchtesten Greueltaten», die sich damals abspielten, zu denen «die teuflischste Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel» bot: Einem Italiener namens Exili, so der Erzähler weiter, gelang es nämlich, «jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt, und alle Kunst, alle Wissenschaft der Ärzte täuscht, die den Giftmord nicht ahnend, den Tod einer natürlichen Ursache zuschreiben müssen.»
Die Erzählung des Schriftstellers und Juristen E. T. A. Hoffmann steigt hinauf «ins Fantastische», ist aber trotzdem «auf geschichtlichen Grund gebaut»: Der Untertitel weist nämlich auf das Zeitalter Ludwigs XIV. hin und damit auf eine spektakuläre Serie von Giftmorden, in der die Marquise von Brinvillier eine zentrale Rolle spielte. Besonders perfide war, wie Hoffmann einflicht, dass sich das Töten mit Gift damals zu einer Art Leidenschaft entwickelte: «Ohne weiteren Zweck, aus Lust daran, wie der Chemiker Experimente macht zu seinem Vergnügen, haben oft Giftmörder Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen völlig gleich sein konnte.»
In seinen toxikologischen Untersuchungen nennt Louis Lewin auch den konkret verwendeten Wirkstoff in dieser Affäre des 17. Jahrhunderts: Poudre de succession wurde er in Frankreich ironisch genannt, Erbschaftspulver: «Es wirkte nicht jäh, sondern täuschte vor, dass eine Krankheit in dem Opfer wüte. In den allermeisten Fällen wurde Arsenik gebraucht.» Die giftige Wirkung von Arsen, wie diese chemische Verbindung umgangssprachlich genannt wird, ist seit der Antike bekannt und war über Jahrhunderte hinweg der mit Abstand am häufigsten verwendete Giftstoff: «Seine Wirkungsäusserungen sind so vielgestaltig, ähneln so oft Krankheiten aus inneren Gründen und treten so sicher ein, seine vergiftenden Dosen sind so klein, seine Beibringung so leicht zu bewerkstelligen», zählt Lewin auf, «dass er allen damals und später bekannten pflanzlichen Giftzubereitungen als Vergiftungsmittel unendlich überlegen ist».
Über Giftmorde mit Arsen im 14. Jahrhundert, in dem in Genua der Doge Simone Boccanegra getötet wurde, ist laut Lewin «wenig absolut Sicheres» bekannt. Hinweise ergäben sich jedoch aus toxikologischen Berichten, «die zwar über die Art des verwendeten Giftes nichts melden, wohl aber Giftwirkungen erwähnen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Arsen als Verursacher hinweisen». Mit diesem Ansatz hat der brasilianische Chemiker und Opernkenner João Paolo André in neuerer Zeit verschiedene Opernhandlungen untersucht und ist im Fall von Verdis Simon Boccanegra zum Schluss gekommen, dass es sich auch hier um eine giftige Arsen-Verbindung handeln muss.
Konkrete Hinweise sind bei Verdi allerdings spärlich. Der Vergiftungsprozess nimmt seinen Anfang im 2. Akt der Oper: Paolo Albiani, einst ein guter Freund und politischer Unterstützer Simon Boccanegras, ist tief gekränkt: Seit Boccanegra in Amelia seine verloren geglaubte Tochter wiedergefunden hat, verweigert er Paolo, sie zu heiraten. Paolo hat sie deshalb entführt, wird aber entlarvt und vom Dogen gezwungen, sich selbst zu verdammen. Um sich zu rächen, hat er sich nun in den Dogenpalast geschlichen und schüttet ihm mit den Worten «Hiermit bereite ich dir einen langen, qualvollen Todeskampf» heimlich den Inhalt eines Fläschchens ins Trinkglas. Simon Boccanegra nimmt das Gift wenig später fast beiläufig zu sich. Nur seine Bemerkung «Sogar das Quellwasser schmeckt bitter auf den Lippen des Herrschenden» verrät, dass soeben ein schleichender Prozess eingesetzt hat, der unausweichlich zum Tod führen wird. Die ersten Anzeichen der Vergiftung äussern sich als Müdigkeit. Der Doge schläft ein, ist ansonsten aber noch nicht stark beeinträchtigt. Bei seinem nächsten und letzten Auftritt im 3. Akt erscheint Simon Boccanegra jedoch deutlich geschwächt. Das Gift wirkt also, wie Louis Lewin es für Arsen beschreibt, «nicht jäh», sondern einer Krankheit täuschend ähnlich.
Die realistische Schilderung einer von Arsen ausgelösten Vergiftung findet sich bei Verdi nicht: Der Musikdramatiker interessiert sich weniger für medizinische Details als für die Bühnenwirksamkeit eines schleichenden Todes: So versöhnt sich Simon Boccanegra in seinen letzten Lebensmomenten noch mit seinem politischen Erzfeind Jacopo Fiesco. Verdi wünschte sich für diese Szene eine konsequent erlöschende Lichtdramaturgie, «bis beim Tod des Dogen alles in tiefem Dunkel liegt». Neben der ergreifend gestalteten Todesszene Boccanegras sind in Verdis Partitur aber auch kleine Details zusammenhangsreich gestaltet: Ein wiederkehrendes Giftmotiv findet sich, wie der Verdi-Biograf Julian Budden beschreibt, zum ersten Mal explizit in der Szene, in der Paolo Gift in das Trinkglas des Dogen schüttet – das chromatische absteigende Motiv stammt jedoch aus dem Ende des 1. Akts, wo Paolo sich auf Geheiss des Dogen selbst verdammt: «Der Fluch des Dogen wendet sich nun gegen ihn selbst zurück», kommentiert Budden. Während dem letzten Auftritt des Dogen erscheint dasselbe Motiv in variierter Form, nun schleppend auf- und absteigend: «Es erzählt nicht nur, dass Boccanegra krank ist, sondern auch warum.»
Ein deutlich realistischeres Bild einer Arsenvergiftung ist in literarischer Form übrigens im selben Jahr erschienen, in dem Verdis erste Fassung von Simon Boccanegra in Venedig uraufgeführt wurde: 1857 erschien in Paris der skandalumwitterte Roman Madame Bovary. Gustave Flaubert, Sohn eines Arztes, schildert die Vergiftungssymptome der Bovary, die sie sich in diesem Fall selbst zugeführt hat, in fast unerträglicher Akribie. Anders als Simon Boccanegra nimmt die unglückliche Emma Bovary das Arsen in Form eines Pulvers ein. Auch sie hat aber zunächst keine Schmerzen und schläft vorübergehend ein. Ausserdem erinnert ein kleines Detail an die Worte des genuesischen Dogen im Moment seiner Vergiftung: Als sie wieder aufwacht, fühlt Emma Bovary einen «bitteren Geschmack im Mund». Ihren Todeskampf hat Flaubert, anders als Verdi, unerbittlich und grausam geschildert: «Heftiges Zittern durchbebte ihre Schultern, und sie wurde bleicher als das Laken, in das sich ihre steifen Finger krallten. Ihr unregelmässiger Puls war kaum noch zu fühlen.»
Als der eilig geöffnete Abschiedsbrief der Bovary erkennen lässt, dass sie sich mit Arsen vergiftet hat, erscheint im Text ein beachtenswertes Detail, und zwar schlägt Monsieur Homais, der Pharmazeut, vor, «es müsste eine Analyse gemacht werden». Eine Analyse, das heisst Arsen im Körper eines Menschen nachzuweisen, war 1857 aber noch ein Novum. Erst 1836 nämlich hatte der britische Chemiker James Marsh eine Methode entdeckt, mit der sich Arsen sicher nachweisen lässt. Und das wiederum erklärt, warum Arsen über Jahrhunderte hinweg das bevorzugte Mordgift war...
In der Folge dieser sogenannten Marshschen Probe kam Arsen als Mordwaffe allmählich aus der Mode. Nicht jedoch der Giftanschlag, wie es auch der Fall um Nawalny jüngst wieder gezeigt hat. Das in Russland entwickelte Nervengift Nowitschok – übersetzt: «Neuling» – kann, wie Nawalny erzählt, heute von «vielleicht nur siebzehn» hochspezialisierten Labors nachgewiesen werden. Und seine Folgen sind grausam; Nawalny berichtet von schockierenden körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. «Konventionelle Waffen», sagt er, «können benutzt werden, um Menschen zu töten, aber auch um sie zu beschützen; diese Substanzen sind nur dazu bestimmt, Menschen einen schmerzvollen Tod sterben zu lassen – sie sind ein Ding aus der Hölle».
Ein Essay von Fabio Dietsche
Simon Boccanegra
Synopsis
Simon Boccanegra
Prolog
Paolo Albiani und Pietro treffen sich nachts heimlich in den Strassen von Genua. Die beiden Vertreter der Volkspartei planen, den Korsaren und politischen Aussenseiter Simon Boccanegra zum Dogen der Stadt zu wählen und die verhasste Regierung des Adeligen Jacopo Fiesco zu stürzen.
Simon Boccanegra ist an dem politischen Amt, das ihm Paolo vorschlägt, nicht interessiert. In der privaten Hoffnung, seine Geliebte Maria wieder zu erlangen, die deren Vater Fiesco ihm vorenthält, stimmt er jedoch zu. Paolo und Pietro überzeugen die Volksvertreter, einstimmig Simon Boccanegra zu wählen.
Jacopo Fiesco beklagt das Schicksal seiner Tochter Maria, die soeben in seinem Palast gestorben ist. Er ist wütend auf Boccanegra, der Maria verführt hat. Als die beiden Männer aufeinandertreffen, bittet Boccanegra Fiesco um Verzeihung. Fiesco wäre dazu bereit, wenn Boccanegra ihm das gemeinsame Kind mit Maria überlassen würde. Doch Boccanegra kann diesen Wunsch nicht erfüllen: Seine Tochter ist auf rätselhafte Weise verschwunden. Die beiden Männer gehen ohne Versöhnung auseinander.
Boccanegra will Maria sehen und geht in den Palast Fiescos, der verlassen ist und offensteht. Während er in der Stadt zum Dogen ausgerufen wird, entdeckt er die Leiche seiner toten Geliebten Maria.
Erster Akt
Simon Boccanegra ist seit nunmehr 25 Jahren Doge von Genua.
Amelia Grimaldi erwartet ihren Geliebten Gabriele Adorno. Als er eintrifft, stellt sie ihn zur Rede: Er bringe sich durch seine Beteiligung an einer Verschwörung gegen den Dogen leichtfertig in Gefahr. Gabriele versucht, sie zu beschwichtigen. Als unerwartet ein Besuch des Dogen angekündigt wird, vermutet Amelia, dass dieser kommt, um für seinen Günstling Paolo um sie zu werben.
Von Fiesco, der seit dem Tod seiner Tochter als Mönch unter dem Namen Andrea unerkannt in Genua lebt, erfährt Gabriele, dass Amelia keine echte Grimaldi, sondern ein Waisenkind ist, das in diese angesehene Patrizierfamilie aufgenommen wurde.
Amelia gesteht dem Dogen ihre Abneigung gegenüber Paolo, der es auf ihren Reichtum abgesehen hat, und enthüllt ihm das Geheimnis ihrer Herkunft: Sie ist in der Obhut einer alten Frau als Waisenmädchen an der Küste aufgewachsen. Nach dem Tod der Frau wurde sie in ein Kloster in Pisa aufgenommen und kam so ins Haus der Grimaldi. Zutiefst gerührt erkennt Simon Boccanegra in Amelia Grimaldi seine verloren geglaubte Tochter Maria wieder. Er verweigert daraufhin Paolo ihre Hand. Schwer gekränkt entscheidet Paolo, Amelia zu entführen.
Im Dogenpalast mahnt Simon Boccanegra die Genueser zum Frieden mit Venedig. Paolo protestiert und fordert Krieg. Von draussen ist eine aufgebrachte Volksmenge zu hören. Gabriele flüchtet vor der wütenden Menge in den Palast und berichtet, dass Amelia entführt wurde. Ihren Entführer habe er getötet. Im Sterben habe dieser bekannt, dass ein mächtiger Mann hinter dieser Tat stehe, ohne jedoch den Namen preiszugeben. Gabriele beschuldigt den Dogen, selbst der Auftraggeber gewesen zu sein, und will ihn töten. Amelia, die sich inzwischen befreien konnte, tritt dazwischen und bittet für ihn um Gnade. Simon Boccanegra nimmt Gabriele in Haft und hat aus Amelias Schilderungen geschlossen, dass Paolo hinter der Entführung steht: Er zwingt seinen alten Vertrauten dazu, sich selbst zu verfluchen.
Zweiter Akt
Paolo will sich rächen. Er lässt Gabriele und Fiesco, der ebenfalls in Haft genommen wurde, holen und versucht, sie zum Mord an Boccanegra zu bewegen. Um sicher zu gehen, will er den Dogen zudem heimlich vergiften. Fiesco lehnt Paolos Mordplan ab, Gabriele willigt eifersüchtig ein, nachdem er erfahren hat, dass sich Amelia beim Dogen befindet. Paolo lässt ihn in die Gemächer des Dogen.
Als Amelia dort auf ihren Geliebten trifft, versucht sie, seine rasende Eifersucht zu besänftigen. Da sie aus politischen Gründen ihr wahres Verhältnis zu Boccanegra noch nicht aufklären darf, ist Gabriele – blind vor Eifersucht – zum Mord entschlossen. Als der Doge erscheint, gelingt es Amelia im letzten Moment, ihren Geliebten zu verstecken.
Im vertrauten Gespräch enthüllt Amelia ihrem Vater den Namen ihres Geliebten und Boccanegra ist entsetzt, dass es sich ausgerechnet um seinen Feind Gabriele Adorno handelt. Von der aufrichtigen Liebe seiner Tochter berührt, verspricht er ihr, nach einem Weg zu suchen, ihn zu begnadigen. Er fordert sie auf, ihn allein zu lassen, und schläft ein.
Eigentlich zum Mord entschlossen, zögert Gabriele zunächst, den schlafenden Dogen zu töten. Als er sich doch zur Tat entschliesst, kann Amelia im letzten Moment dazwischentreten und den Mord verhindern.
Boccanegra gibt sich seinem Feind als Vater Amelias zu erkennen. Beschämt bittet Gabriele um Verzeihung. Von draussen hört man Rufe eines beginnenden Aufstands, aber Gabriele entscheidet sich dafür, an Boccanegras Seite für den Frieden zu kämpfen. Boccanegra verspricht ihm die Hand seiner Tochter.
Dritter Akt
Der Aufstand gegen den Dogen ist gescheitert. Paolo wird als Verräter zu seiner Hinrichtung geführt und trifft auf den freigelassenen Fiesco. Er gesteht ihm, den Dogen vergiftet zu haben.
Fiesco lauert dem bereits geschwächten Dogen auf, um sich ihm als sein alter Feind zu erkennen zu geben. Doch Simone zeigt sich glücklich, dem Vater seiner verstorbenen Geliebten mit Amelia nach 25 Jahren die verloren geglaubte Enkeltochter zuführen zu können. Erschüttert enthüllt Fiesco ihm, dass Paolo ihn vergiftet hat.
Das soeben getraute Paar Amelia und Gabriele treffen auf die versöhnten Feinde und erfahren vom unvermeidlich bevorstehenden Tod Boccanegras. Bevor er stirbt, erklärt Boccanegra Gabriele Adorno zum neuen Dogen und segnet die Verbindung zwischen ihm und seiner Tochter Maria.
Biografien

Paolo Arrivabeni, Musikalische Leitung
Paolo Arrivabeni
Paolo Arrivabeni stammt aus Italien. Er studierte am Boito-Konservatorium in Parma Komposition bei Camillo Togni und Dirigieren bei Daniele Gatti. Von 2008 bis 2017 war er Musikdirektor der Opéra Royal de Wallonie in Liège. Sein Repertoire umfasst Opern italienischer Komponisten des 19. Jahrhunderts, insbesondere Rossini, Donizetti und Verdi, sowie Werke von Wagner, Strauss und Mussorgski. Er arbeitet regelmässig an der Staatsoper Unter den Linden, der Deutschen Oper Berlin, dem Opernhaus Leipzig, der Bayerischen Staatsoper München, der Semperoper Dresden, der Staatsoper Hamburg, der Deutschen Oper am Rhein, der Wiener Staatsoper, dem Grand Théâtre de Genève, der Opéra Bastille, dem Théâtre des Champs-Élysées und dem Théâtre du Capitole. Weitere Engagements führten ihn an die Opéra de Montecarlo, das Teatro Nacional de Sao Carlos in Lissabon, das Teatro de la Maestranza in Sevilla, das Teatro San Carlo in Neapel, das Teatro La Fenice in Venedig, die Oper in Rom, das Rossini Opera Festival, das Festival Verdi in Parma sowie an die Metropolitan Opera in New York. An der Oper Marseille dirigierte er u. a. La straniera, I due Foscari, Moïse et Pharaon, Simon Boccanegra, Lohengrin, Macbeth, Nabucco, Attila sowie zuletzt Un ballo in maschera. In jüngerer Zeit dirigierte er u. a. Tosca, La bohème, Rigoletto und Norma an der Staatsoper Hamburg, Tosca, Cavalleria rusticana und Pagliacci an der Deutschen Oper Berlin, La bohème, Nabucco sowie La traviata an der Semperoper Dresden und debütierte mir Madama Butterfly an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf, wo er seither auch Cavalleria rusticana und Pagliacci dirgiert hat.

Andreas Homoki, Inszenierung
Andreas Homoki
Andreas Homoki wurde als Sohn einer ungarischen Musikerfamilie 1960 in Deutschland geboren und studierte Schulmusik und Germanistik in Berlin (West). 1987 ging Andreas Homoki als Regieassistent und Abendspielleiter an die Kölner Oper, wo er bis 1993 engagiert war. In den Jahren 1988 bis 1992 war er ausserdem Lehrbeauftragter für szenischen Unterricht an der Opernschule der Musikhochschule Köln. Hier entstanden erste eigene Inszenierungen. 1992 führte ihn seine erste Gastinszenierung nach Genf, wo seine Deutung der Frau ohne Schatten internationale Beachtung fand. Die Inszenierung, die später auch am Pariser Théâtre du Châtelet gezeigt wurde, erhielt den französischen Kritikerpreis des Jahres 1994. Von 1993 bis 2002 war Andreas Homoki als freier Opernregisseur tätig und inszenierte u. a. in Köln, Hamburg, Genf, Lyon, Leipzig, Basel, Berlin, Amsterdam und München. Bereits 1996 debütierte er an der Komischen Oper Berlin mit Falstaff, es folgten Die Liebe zu drei Orangen (1998) sowie im Jahre 2000 Die lustige Witwe. 2002 wurde Andreas Homoki als Nachfolger von Harry Kupfer zum Chefregisseur der Komischen Oper Berlin berufen, deren Intendant er 2004 wurde. Neben seinen Regiearbeiten an der Komischen Oper Berlin inszenierte er u. a. am Théâtre du Châtelet in Paris, an der Bayerischen Staatsoper München, am New National Theatre Tokyo, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und der Hamburgischen Staatsoper. Im Juli 2012 inszenierte er unter der musikalischen Leitung von William Christie David et Jonathas von Marc-Antoine Charpentier für das Festival in Aix-en-Provence – eine Produktion, die später auch u. a. in Edinburgh, Paris und New York gezeigt wurde. Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Homoki Intendant des Opernhaus Zürich und inszenierte hier u. a. Der fliegende Holländer (Koproduktion mit der Mailänder Scala und der Norwegischen Staatsoper Oslo), Fidelio, Juliette, Lohengrin (Koproduktion mit der Wiener Staatsoper), Luisa Miller (Hamburgische Staatsoper), Wozzeck, My Fair Lady (Komische Oper Berlin), I puritani, Medée, Lunea (von der Zeitschrift Opernwelt zur «Uraufführung des Jahres 2017/18» gekürt), Iphigénie en Tauride, Nabucco, Simon Boccanegra, Les Contes d’Hoffmann, Salome, den Ring des Nibelungen und Carmen. Andreas Homoki ist seit 1999 Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Christian Schmidt, Ausstattung
Christian Schmidt
Christian Schmidt studierte Bühnenbild bei Erich Wonder an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. 1992 arbeitete er zum ersten Mal mit Claus Guth zusammen, woraus sich eine intensive künstlerische Partnerschaft entwickelte. Zahlreiche Inszenierungen Guths hat er mittlerweile als Bühnen- und Kostümbildner ausgestattet, darunter Iphigénie en Tauride und Le nozze di Figaro (Salzburger Festspiele), Der fliegende Holländer (Bayreuther Festspiele), Fierrabras, Radamisto, Ariane et Barbe-Bleue, Tristan und Isolde und Parsifal für das Opernhaus Zürich sowie Mozarts Lucio Silla (Wiener Festwochen). Auch durch Uraufführungen hat sich das Team einen Namen gemacht, darunter Czernowins Pnima und Stauds Berenice für die Münchener Biennale, Ruzickas Celan in Dresden, Oehrings Unsichtbar Land in Basel und Czernowins Heart Chamber an der Deutschen Oper Berlin. Für Hans Neuenfels’ Inszenierungen von Zemlinskys Der König Kandaules an der Wiener Volksoper (1997) und Die Entführung aus dem Serail in Stuttgart (1998) entwarf Schmidt die Ausstattung (Auszeichnung «Inszenierung des Jahres» durch die «Opernwelt»). 2003 kürte ihn die «Opernwelt» zum «Bühnenbildner des Jahres», 2005 zum «Kostümbildner des Jahres». Für das Bühnenbild zu Simon Boccanegra in Hamburg erhielt er 2006 den Rolf-Mares-Preis. 2010 arbeitete er erstmals mit Christof Loy zusammen (Die lustige Witwe in Genf). Für Christian Spuck schuf er in Stuttgart das Bühnenbild zu Glucks Orphée et Eurydice sowie zu Romeo und Julia und Messa da Requiem in Zürich. Seit 2011 arbeitet er auch mit Andreas Homoki zusammen (Das schlaue Füchslein, Komische Oper Berlin und Juliette, Opernhaus Zürich) und verantwortet mit ihm den neuen Zürcher Ring.

Florian Schaaf, Künstlerische Mitarbeit Bühnenbild
Florian Schaaf
Florian Schaaf, geboren 1969 in Gräfelfing, studierte in München Architektur. Eine langjährige künstlerische Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Bühnenbildner Christian Schmidt. Er wirkte bei zahlreichen Produktionen an internationalen Opernhäusern mit, u.a. am Teatro alla Scala in Mailand, am Teatro Real Madrid, an der Opéra de Paris, der Staatsoper Wien, der Staatsoper Berlin sowie zuletzt beim Ring des Nibelungen am Opernhaus Zürich. Im Deutschen Theatermuseum schuf er als szenografische Arbeit die Ausstellung «150 Jahre Gärtnerpatztheater». 2019 arbeitete er als Bühnenbildner mit Falko Herold an Schnitzlers Reigen in der Inszenierung von Alexandra Liedtke bei den Bregenzer Festspielen. Am Theater Wiesbaden entwarf er gemeinsam mit Duri Bischoff die Bühnenbilder für Kirschgarten in der Inszenierung von Evgeny Titov sowie für Vater, Wassa Schelesnova und Der eingebildete Kranke.

Franck Evin, Lichtgestaltung
Franck Evin
Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u. a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieito und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.

Janko Kastelic, Choreinstudierung
Janko Kastelic
Janko Kastelic ist ein kanadisch-slowenischer Dirigent, Chorleiter, Pianist und Organist. Er begann seine musikalische Ausbildung in Kanada am Royal/Western Conservatory of Music und der St. Michael’s Choir School. Er hat einen Abschluss in Dirigieren, Komposition und Musiktheorie von der Universität Toronto und setzte sein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien fort. Seit 2017 ist er Chordirektor am Opernhaus Zürich. Er war einer der Kapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle, Studienleiter des JET-Programms für junge Sänger am Theater an der Wien und Assistent bei den Bayreuther Festspielen sowie Gastchordirektor an der Hamburgischen Staatsoper. Zu den Positionen, die er im Lauf seiner Karriere bekleidet hat, gehört auch die Stelle des Generalmusikdirektors und Operndirektors am Slowenischen Nationaltheater Maribor, des Zweiten Chordirektors an der Wiener Staatsoper sowie des Korrepetitors an der Opéra National de Paris. Er war Assistenzprofessor an der Universität Ljubljana und Mentor an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Seine künstlerischen Leistungen sind dokumentiert auf mehreren Live-Aufnahmen, darunter Tschaikowskis Pique Dame und Schönbergs Moses und Aron. Er arrangierte und dirigierte auch Werke für die Feierlichkeiten zum Mozartjahr 2006. Zu seinen Arbeiten beim Klangbogen-Festival in Wien gehört die europäische Erstaufführung von Blochs Macbeth. Janko Kastelic ist auch ein engagierter Pädagoge, der sich der Förderung der nächsten Generation von Musikerinnen und Musikern verschrieben hat.

Fabio Dietsche, Dramaturgie
Fabio Dietsche
Fabio Dietsche studierte Dramaturgie an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Querflöte bei Maria Goldschmidt in Zürich und bei Karl-Heinz Schütz in Wien. Erste Erfahrungen als Dramaturg sammelte er 2012/13 bei Xavier Zuber am Konzert Theater Bern, wo er u.a. Matthias Rebstocks Inszenierung von neither (Beckett/Feldman) in der Berner Reithalle begleitete. Seit 2013 ist er Dramaturg am Opernhaus Zürich, wo er sein Studium mit der Produktionsdramaturgie von Puccinis La bohème abschloss. Hier wirkte er u.a. bei den Uraufführungen von Stefan Wirths Girl with a Pearl Earring und Leonard Evers Odyssee, an der Kammeroper Jakob Lenz von Wolfgang Rihm und an der Schweizerischen Erstaufführung von Manfred Trojahns Orest mit. Er arbeitete u.a. mit Robert Carsen, Tatjana Gürbaca, Rainer Holzapfel, Andreas Homoki, Ted Huffman, Mélanie Huber, Barrie Kosky, Hans Neuenfels und Kai Anne Schuhmacher zusammen. Zurzeit studiert er berufsbegleitend Kulturmanagement an der Universität Zürich.

Christian Gerhaher, Simon Boccanegra
Christian Gerhaher
Christian Gerhaher studierte Medizin und Gesang und rundete seine Ausbildung in Meisterkursen bei Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf und Inge Borkh ab. Während des Studiums entstand eine enge Partnerschaft mit dem Pianisten Gerold Huber. Seit mehr als 30 Jahren setzen die beiden Massstäbe in der Liedinterpretation. Die Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, Andris Nelsons, Antonio Pappano, Kirill Petrenko, Simon Rattle und Christian Thielemann führte ihn zu Orchestern wie dem London Symphony Orchestra und den Wiener Philharmonikern. Er ist regelmässig zu Gast bei den Festivals in Edinburgh, Luzern, Salzburg, dem Rheingau Musik Festival und den BBC Proms. Zu seinen wichtigsten Opernpartien zählen Wolfram (Tannhäuser), Posa (Don Carlo), Germont (La traviata), Il Conte di Almaviva (Le nozze di Figaro), Orfeo, Don Giovanni, Simon Boccanegra, Pelléas, Henzes Prinz von Homburg sowie Lenau in Holligers Lunea. Als Meilenstein gilt seine Darstellung des Wozzeck am Opernhaus Zürich. Mit Gerold Huber veröffentlichte er u. a. Liederzyklen von Schubert und Mahler. Ihre Einspielung Robert Schumann: Alle Lieder wurde 2022 mit einem OPUS Klassik ausgezeichnet. Zuletzt veröffentlichte er Mahlers Lied von der Erde in der Klavierfassung sowie sein erstes Buch, Lyrisches Tagebuch, ein Kompendium zur Liedinterpretation. Christian Gerhaher ist Professor für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik und Theater München und unterrichtet an der Royal Academy of Music in London.

George Petean, Simon Boccanegra
George Petean
George Petean wurde in Cluj-Napoca (Rumänien) geboren und studierte Klavier, Posaune und Gesang. Sein Bühnendebüt gab er 1997 an der Oper in Cluj-Napoca als Don Giovanni. 1999 erhielt er den Grossen Preis des internationalen Gesangswettbewerbes Hariclea Darclée. 2000 gab er sein Debüt als Marcello (La bohème) am Teatro dell’Opera di Roma, 2002 bis 2010 war er Ensemblemitglied der Hamburgischen Staatsoper. Seitdem ist er freischaffend tätig. Engagements führten ihn u. a. an das Royal Opera House Covent Garden, die Wiener Staatsoper, die Opéra de Paris, die Bayerische Staatsoper München, die New Yorker Met, das Gran Teatro del Liceu Barcelona, die Berliner Opernhäuser, die Semperoper Dresden, die Oper Amsterdam sowie zu den Bregenzer Festspielen. Sein Repertoire umfasst Partien wie Figaro (Il barbiere di Siviglia), Silvio (Pagliacci), Conte di Luna (Il trovatore), Rodrigo, Marquis von Posa (Don Carlo), Lord Enrico Ashton (Lucia di Lammermoor), Giorgio Germont (La traviata), Amonasro (Aida), Simon Boccanegra und Rigoletto. Am Opernhaus Zürich war er zuletzt u.a. als Macbeth, als Simon Boccanegra sowie konzertant als Carlo Gérard (Andrea Chénier) zu erleben. In der Spielzeit 2024/25 wird er ausserdem als Rigoletto in Turin, als Conte di Luna in Hamburg und an der Staatsoper Berlin sowie als Rodrigo in München zu erleben sein.

Jennifer Rowley, Amelia Grimaldi
Jennifer Rowley
Jennifer Rowley studierte am Baldwin Wallace College Conservatory of Music, an der Indiana University School of Music und am Instituto Superior de Arte, Teatro Colón. Sie war Mitglied der Scuola dell’Opera Italiana am Teatro Comunale in Bologna, wo sie 2009 als Magda in La rondine debütierte. Sie ist Preisträgerin zahlreicher renommierter Gesangswettbewerbe, darunter u.a. der Richard Tucker Career Grant sowie der Licia Albanese Puccini Foundation Preis. Ihre internationale Karriere begann, als sie 2010 kurzfristig beim Caramoor International Music Festival in der Titelpartie von Donizettis Maria di Rohan einsprang. Seither steht sie regelmässig auf den grossen internationalen Opernbühnen der Welt. In den vergangenen Spielzeiten war sie u.a. an der Metropolitan Opera New York als Roxanne (Cyrano de Bergerac) sowie als Tosca, Adriana Lecouvreur, Leonora (Il trovatore) und Musetta (La bohème), am Teatro del Liceu in Barcelona als Aida, beim Maggio Musicale in Florenz, an der Staatsoper Berlin, der Opéra de Paris und der Opéra de Rouen als Leonora (Il trovatore), an der Semperoper Dresden als Valentine (Les Huguenots) sowie als Tosca und am Nationaltheater Prag als Amelia (Un ballo in maschera) zu erleben. In jüngster Zeit gab sie als Leonora (Il trovatore) ihr Debüt an der Staatsoper Unter den Linden, Berlin, debütierte als Cio-Cio-San (Madama Butterfly) an der Palm Beach Opera und als Minnie (La fanciulla del West) am Teatro Regio Torino, sang Cio-Cio-San am Teatro Carlo Felice in Genua und zuletzt Minnie am National Center for the Performing Arts in Peking.

Christof Fischesser, Jacopo Fiesco
Christof Fischesser
Christof Fischesser studierte Gesang in Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 gewann er den ersten Preis beim Bundeswettbewerb für Gesang in Berlin, worauf er an das Staatstheater Karlsruhe engagiert wurde. 2004 wechselte er an die Staatsoper Berlin, von 2012 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich, mit dem ihn seither eine enge Zusammenarbeit verbindet. Er gastierte ausserdem an der Wiener Staatsoper, am Royal Opera House London, an der Opéra Bastille Paris, dem Teatro Real in Madrid, der Staatsoper München, der Komischen Oper Berlin, der Semperoper Dresden, der Opéra de Lyon, am Théâtre du Capitole de Toulouse, an der Houston Grand Opera, der Lyric Opera Chicago sowie den Opernhäusern von Antwerpen, Kopenhagen und Göteborg. Sein breitgefächertes Repertoire umfasst u.a. Rollen wie König Marke (Tristan und Isolde), Landgraf (Tannhäuser), König Heinrich (Lohengrin), Gurnemanz (Parsifal), Sarastro (Zauberflöte), Figaro (Le nozze di Figaro), Rocco (Fidelio), Banquo (Macbeth), Mephisto (Faust) und Baron Ochs von Lerchenau (Der Rosenkavalier). Zahlreiche CDs und DVDs dokumentieren sein künstlerisches Schaffen, so z.B. Beethovens Fidelio unter Claudio Abbado (mit Nina Stemme und Jonas Kaufmann), Massenets Manon unter Daniel Barenboim (mit Anna Netrebko und Rolando Villazón) oder Wagners Lohengrin unter Kent Nagano (mit Anja Harteros und Jonas Kaufmann). In Zürich war er u. a. als König Heinrich, Orest (Elektra), Kaspar, Daland, Gremin, Gurnemanz (Parsifal), Il Marchese di Calatrava, Padre Guardiano (La forza del destino), Hunding (Die Walküre) sowie als Jacopo Fiesco (Simon Boccanegra) zu erleben.

Omer Kobiljak, Gabriele Adorno
Omer Kobiljak
Omer Kobiljak stammt aus Bosnien und wurde von 2008 bis 2013 von David Thorner am Konservatorium Winterthur ausgebildet. Er besuchte Meisterkurse bei Jane Thorner-Mengedoht, David Thorner und Jens Fuhr und erhielt 2012 beim Thurgauer Musikwettbewerb den Ersten Preis mit Auszeichnung. Im Jahr darauf sang er bei den Salzburger Festspielen einen Lehrbuben (Die Meistersinger von Nürnberg) unter Daniele Gatti. Ab 2014 studierte er an der Kalaidos Fachhochschule Aarau Gesang bei David Thorner. 2016 debütierte er als Baron von Kronthal (Lortzings Der Wildschütz) an der Operettenbühne Hombrechtikon. 2017 sang er an der Mailänder Scala in Die Meistersinger von Nürnberg. Ab 2017/18 war er Mitglied im Internationalen Opernstudio am Opernhaus Zürich. In der Spielzeit 2018/19 sang er hier u. a. Lord Arturo Buklaw in Lucia di Lammermoor. Seit der Spielzeit 2019/20 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich und war hier u.a. als Abdallo in Nabucco, als Nathanaël in Les Contes d’Hoffmann, als Macduff in Macbeth, als Froh in Das Rheingold sowie in Il trovatore und in I Capuleti e i Montecchi zu erleben. Bei den Bregenzer Festspielen sang er Il principe Yamadori in Madama Butterfly, den Fürsten Alexis in Umberto Giordanos Siberia sowie Don Riccardo in Ernani. Zuletzt gab er am Opernhaus Zürich seine Rollendebüts als Alfredo (La traviata) und Gabriele Adorno (Simon Boccanegra) und sang ausserdem Tybalt in Roméo et Juliette.

Andrew Moore, Paolo Albiani
Andrew Moore
Andrew Moore, Bass-Bariton, stammt aus New Jersey. Er studierte an der Rutgers University und am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Er war 2017 Finalist beim New Jersey State Opera Alfredo Silipigni Wettbewerb und sang im gleichen Jahr mit den New Jersey Chamber Singers die Baritonpartie im Requiem von Fauré. 2018 nahm er am Merola Opera Program in San Francisco teil, wo er u.a. beim Schwabacher Summer Concert und in The Rake’s Progress sang. 2019 war er Teilnehmer der Metropolitan Opera National Council Auditions und erreichte das New England Region Finale, wo er mit dem Susan Eastman Encouragement Award ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr sang er an der Santa Fe Opera in den Produktionen La Bohème, Così fan tutte und Jenůfa. Weitere Auftritte hatte er als Vicar (Albert Herring), Fiorello (Il barbiere di Siviglia), Talpa (Il tabarro), Figaro (Le nozze di Figaro), Guglielmo (Così fan tutte), Rocco (Fidelio), L’Arbre (L’Enfant et les sortilèges) und Adonis (Venus und Adonis). Von 2020 bis 2022 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios und sang hier u.a. Mamma Agata in Viva la mamma, Gouverneur (Le Comte Ory), Masetto in Don Giovanni sowie die Titelpartie in Die Odyssee. Seit der Spielzeit 2022/23 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich. In der Spielzeit 2024/25 ist er als Paolo Albiani (Simon Boccanegra), Max (In 80 Tagen um die Welt), Don Fernando (Fidelio), Paqui / Vertreter (Das grosse Feuer) und Marullo (Rigoletto) in Zürich zu erleben.

Brent Michael Smith, Pietro
Brent Michael Smith
Brent Michael Smith stammt aus den USA. Er studierte Gesang an der Academy of Vocal Arts in Philadelphia und der University of Northern Iowa sowie Klavier am Hope College. 2021 gewann er den 3. Preis beim Concorso Lirico Internazionale di Portofino, war Finalist beim Queen Sonja International Music Competition und gewann das Förderstipendium der Zachary L. Loren Society, 2020 war er Halbfinalist bei den Metropolitan Opera Council Auditions, 2018 war er Preisträger des Opera Index Wettbewerbs und der Opera Birmingham International Competition, ausserdem gewann er Preise bei der Giargiari Bel Canto Competition. In der Spielzeit 2016/17 sang er am Michigan Opera Theatre Zuniga (Carmen), den British Major (Silent Night von Kevin Puts), Friedrich Bhaer (Little Women) und Ashby (La fanciulla del West). In der gleichen Spielzeit debütierte er an der Toledo Opera als Antonio (Le nozze di Figaro) und beim Glimmerglass Festival als Ariodante (Xerxes). An der Santa Fe Opera war er als Lakai (Ariadne auf Naxos) zu erleben. An der Opera Philadelphia sang er 2019 Celio (Die Liebe zu den drei Orangen) und Peter Quince (A Midsummer Night’s Dream). Nach einer Spielzeit im Internationalen Opernstudio gehört er seit 2020/21 zum Ensemble des Opernhauses, wo er bisher u.a. in Boris Godunow, Simon Boccanegra, I Capuleti e i Montecchi, im Ballett Monteverdi, als Graf Lamoral (Arabella), als Raimondo Bidebent (Lucia di Lammermoor), als Pistola (Falstaff), Angelotti (Tosca), Gualtiero Raleigh (Roberto Devereux), Gremin (Jeweni Onegin), Frère Laurent (Roméo et Juliette), Fafner (Das Rheingold) und Samuel (Un ballo in maschera) zu hören war.

Maria Stella Maurizi, Magd Amelias
Maria Stella Maurizi
Maria Stella Maurizi begann ihr Studium am Rossini-Konservatorium in Pesaro. Sie war Gewinnerin des jeweils ersten Preises beim Internationalen Wettbewerb «Young Musicians – Città di Treviso» 2020 und beim 75th Competition for Young Opera Singers «European Community» am Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Im Jahr 2021 sang sie Cio-Cio-San (Madama Butterfly) in Spoleto und Perugia; 2022 war sie in der europäischen Erstaufführung von Philip Glass’ The Passion of Ramakrishna mit dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer zu hören, sang Micaëla (Marius Constants Tragédie de Carmen) in Spoleto und Donna Anna (Don Giovanni) in Spoleto und Perugia. Im selben Jahr erhielt sie den «Premio Nazionale delle Arti» der italienischen Regierung. Im Jahr 2023 gewann sie Preise beim Concorso Lirico Internazionale «Anita Cerquetti» und beim Concorso Lirico Internazionale Riccardo Zandonai. Seit der Spielzeit 2023/24 ist sie Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und war u.a. als Helena (A Midsummer Night’s Dream) zu erleben.

Maximilian Lawrie, Hauptmann der Armbrustschützen
Maximilian Lawrie
Maximilian Lawrie studierte am Magdalen College der University of Oxford und an der Royal Academy of Music in London. Dort war er als Tanzmeister in Ariadne auf Naxos, Interrogator 2 in Witch, als Rodolfo in La bohème, als Rinuccio in Gianni Schicci, als First Sailor in Dido and Aeneas, als Don Ottavio in Don Giovanni, als Nemorino in L’elisir d’amore, als Lysander in A Midsummer Night’s Dream, in der Titelrolle von Werther und als Faust in Mefistofele zu hören. Zudem sang er Rodolfo an der Rogue Opera sowie Don José in Carmen an der Rogue Opera und der Cambridge University Opera Society. Seit der Spielzeit 2022/23 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich.