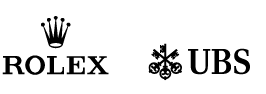Tonhalle-Orchester Zürich meets Philharmonia Zürich
Die beiden Zürcher Dirigenten Gianandrea Noseda und Paavo Järvi sind befreundet. Sie sehen in ihrem parallelen Wirken am Opernhaus und an der Tonhalle keine Konkurrenz, sondern einen Anstoss für intensiven Austausch, aber auch für ein wenig freundschaftliche Rivalität. Jetzt bekräftigen sie ihre künstlerische Freundschaft und tauschen die Positionen: Paavo Järvi wird die Philharmonia Zürich dirigieren und Gianandrea Noseda das Tonhalle-Orchester. Programmatisch soll es mehr werden als eine Geste: Die beiden Orchesterchefs spannen für einen Rachmaninow-Zyklus zusammen aus Anlass des 150. Geburtstags des Komponisten, der ab 1930 regelmässig in seiner Villa am Schweizer Vierwaldstättersee komponierte. Im Zentrum der vier über das Kalenderjahr 2023 verteilten Orchesterkonzerte stehen die monumentalen Klavierkonzerte Rachmaninows. Als Solist:innen sind in diesem Zyklus international gefeierte Stars wie Yuja Wang oder Yefim Bronfman zu hören.

Noseda im Opernhaus
So 12 Feb 2023, 11.15 Opernhaus4. Philharmonisches Konzert
Gianandrea Noseda Dirigent
Janko Kastelic Choreinstudierung
Yefim Bronfman Klavier
Elena Stikhina Sopran
Sergei Skorokhodov Tenor
Alexey Markov Bariton
Philharmonia Zürich
Chor der Oper Zürich
Sergei Rachmaninow
Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30
Die Glocken op. 35
«Ich freue mich darauf, Rachmaninows 150. Geburtstag gemeinsam mit dem Tonhalle-Orchester Zürich und mit Paavo Järvi, einem von mir sehr bewunderten Kollegen und Freund, zu feiern. Die Musik Sergeij Rachmaninows in den Mittelpunkt einer Kooperation der beiden wichtigsten Orchester der Stadt Zürich zu stellen, wird zeigen, dass wir durch Zusammenarbeit ein grosses künstlerisches Ergebnis erreichen und Menschen im Namen der Musik, der Schönheit und des Respekts zusammenbringen können».
Gianandrea Noseda, Generalmusikdirektor Opernhaus Zürich
«Es ist ein glücklicher Zufall, dass Gianandrea Noseda und ich beide in Zürich gelandet sind; wir kennen und mögen uns schon lange. Und wir lieben Rachmaninow: Ich bin als Este mit russischer Musik aufgewachsen, Gianandrea hat lange in St. Petersburg gewirkt. So ist Rachmaninows 150. Geburtstag eine sehr schöne Gelegenheit für eine freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Tonhalle Zürich und Opernhaus Zürich».
Paavo Järvi, Music Director Tonhalle-Orchester Zürich
Noseda in der Tonhalle
Mi 8 Nov 2023, 19.30 + Fr 10 Nov 2023, 19.30 TonhalleGianandrea Noseda Dirigent
Francesco Piemontesi Klavier
Tonhalle-Orchester Zürich
Sergei Rachmaninow
Klavierkonzert Nr. 4 g-Moll op. 40
Sinfonie Nr. 1 d-Moll op. 13
Järvi im Opernhaus
Sa 11 Nov 2023, 19.00 OpernhausPaavo Järvi Dirigent
Francesco Piemontesi Klavier
Philharmonia Zürich
Sergei Rachmaninow
Rhapsodie über ein Thema von Paganini a-Moll, op. 43
Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27
Volker Hagedorn trifft...
«Hat er geraucht?» «Kette», sagt sie, «eine Zigarette nach der anderen.» Wir stehen vor dem Gärtnerhaus, der Nieselregen hat kurz mal aufgehört, unterm Himmelsgrau hören wir von der Villa her einen Laubsauger brummen. Gärtnerhaus? Es ist selbst eine kleine Villa von dezenter Eleganz, kubisch, einstöckig, Flachdach, weiss, die Längsseite zum geschwungenen Parkweg hin, der Eingang unter dem rund umlaufenden Balkon versteckt. Das erste Gebäude, das er auf diesem Anwesen bezog, 1931. Von hier aus überwachte er den Bau der Villa Senar, benannt nach Sergei und Natalja Rachmaninoff. Mit ff. So stand es auf seiner Visitenkarte, so wird er hier am Vierwaldstättersee buchstabiert.
Auch von Andrea Loetscher, der Konzertflötistin und Kulturmanagerin, mit der ich rund um die Villa unterwegs bin, die für die Sergei Rachmaninoff Foundation das Kulturprogramm leitet und realisieren wird, nach der Renovierung. Wenn die Villa fertig ist, zum zweiten Mal. Noch wird das kubische Wunderwerk von einem Gerüst umschlossen und überdacht, von einem Aussenskelett, durch das schon die neu aufgebrachte Originalfarbe leuchtet, goldwarmes Ocker. Im Gärtnerhaus sind die Möbel zwischengelagert. Da findet man ein grüngepolstertes Stahlrohrsofa à la Corbusier, aber auch Neobarockes und Art déco, eine biedermeierliche Standuhr, einen schlichten Arbeitstisch, eine gewaltige Truhe – nein, das ist der Überseekoffer. Der Deckel mit grünem Leder bezogen und mit Messing beschlagen, das Innere blau und leer.
So stand er wohl auch in diesem Haus, frisch ausgepackt, als es losging. Wir sind seinem Besitzer jetzt vielleicht näher als in einer wohlsortierten Schau. In einer seltsamen Zwischenwelt bewegen wir uns an diesem frühen Tag des Jahres, in dem er 150 Jahre alt geworden wäre, in einer Mittagsstunde, aus der sich die Gegenwart zurückgezogen hat wie die Sonne hinter die Wolken über dem See. Dafür ist Rachmaninoff überall. Alles hier erzählt von ihm, auch die Bäume, auch der sanfte Schwung des Terrains. Denn er bestimmte jedes Detail.
«Er hat sogar einen Felsen abtragen lassen, den sie hier ‹Gibraltar› nannten», sagt Andrea Loetscher, während wir zum See hinabgehen. «Es sollte vermutlich mehr wie in Iwanowka aussehen.» Wie jenes Landgut 600 Kilometer östlich von Moskau, das Rachmaninoff 1917 zum letzten Mal sah, ehe er das ins Chaos gestürzte Russland verliess. Iwanowka, wo er die meisten seiner Werke komponierte und sich in die Cousine verliebte, die er 1902 heiratete, Natalja. Mit ihr suchte Sergei, als Pianist einer der bestbezahlten seiner Zeit, diesen Flecken der Schweiz im Jahr 1930 aus, als er 57 war und sie 53. Er suchte Ruhe in einem Europa, in dem schon wieder die politische Spannung wuchs.
Von oben gesehen, auf der Landkarte oder vom Satelliten aus, ähnelt die Halbinsel eine halbe Schiffsstunde östlich von Luzern dem Kopfprofil eines Löwen mit halb aufgerissenem Maul, nach links gewandt. Etwa da, wo das Auge wäre, befindet sich das Areal von 20’000 Quadratmetern, das der Musiker für 250’000 Schweizer Franken kaufte. Heute ist das eine der teuersten Lagen des Planeten. Wären nicht die Denkmalschutzauflagen für ein unschätzbares Kulturerbe, hätten Rachmaninoffs Erben das ganze Anwesen wohl für 30 Millionen Franken verkaufen können. Der Kanton Luzern konnte es aber für acht Millionen erwerben und bezahlte noch mal drei Millionen für die Renovierung. Das klingt viel einfacher, als es zustandekam…
Wir sind am Ufer, an einem Ausblicksplatz mit Steinbänken. Andrea Loetscher zeigt ins Grau über dem leicht bewegten Wasser: «Das ist der schönste Blick, den man am Vierwaldstättersee überhaupt haben kann.» Ohne Wolken sähe man drüben den Pilatus. «Es ist noch schöner, wenn’s nicht schön ist, wie jetzt» fügt sie hinzu. Mit Sonne sei es nämlich fast schon kitschig. Vom See aus konnte man früher bei gutem Wetter bequem die Villa sehen, jetzt verstellen die kanadischen Fichten den Blick, die der Musiker am Uferweg anpflanzen liess, wie auch die Scheinzypresse hinter der perfekt platzierten Steinbank, wie, im Park weiter oben, die Lärchen, Birken, Silbertannen, den Tulpenbaum und noch viel mehr, wovon er 1932 in einem Brief an seine Schwägerin schwärmt. Ein Stück weiter nach Süden ist das Bootshaus, darin schaukelte bis 1939 sein überlanges Motorboot, in dem er auf einem Foto fast etwas verloren sitzt. Er liebte die Moderne in der Technik so, wie er sie in der Musik ablehnte. Im Frühjahr 1930 lässt er seinen nagelneuen Lincoln mit V8-Motor von New York nach Le Havre einschiffen und steuert das Luxusauto von dort bis in die Schweiz. Für seine Villa verpflichtet er Schweizer Architekten, die zu den besten des «Neuen Bauens» zählen, Möri & Krebs, und lässt für ihren Entwurf ein Chalet abräumen. Man könnte meinen, der Mann verfüge über unbegrenzte Mittel – aber die Weltwirtschaftskrise trifft auch ihn, im Januar 1933 telegrafiert er: «Bau stoppen». Drei Wochen später gibt er wieder grünes Licht, gut ein Jahr später, im März 1934, steht der Bau.
«Vielleicht doch zu schnell gebaut», meint Andrea Loetscher, als wir zur Villa hochgehen über ein wunderbar geschwungenes Treppchen. Die Renovierungsbedürftigkeit des Baus geht eben nicht nur auf die jüngeren Jahrzehnte zurück, als zwar der Enkel des Künstlers hier nach dem Rechten sah, es aber an Mitteln fehlte. Rachmaninoff scheint es eilig gehabt zu haben mit seinem Paradies, das er sich sogar als letzte Ruhestätte dachte. Es gibt Briefe und Berichte aus den 1930ern, die von nachlassender Gesundheit und nicht mehr ganz zuverlässiger Virtuosität zeugen. Es gibt aber auch die geniale Rhapsodie über das Thema von Paganinis 24. Caprice, die er hier gleich nach dem Einzug schrieb, am neuen D-Flügel mit ein paar Extras, den ihm Steinway & Sons zum 60. Geburtstag geschenkt hatte. «Der stand da links.» Wir stehen draussen vor dem riesigen, sprossenlosen Glasfenster des «Studiums», wie Rachmaninoff den für ihn wichtigsten Raum nannte, sein Studio, drei Stufen tiefer als das Hauptgebäude und diesem nach Westen vorgelagert.
Drinnen sieht man jetzt nur Malerutensilien. Ich denke sie mir weg und stelle mir vor, wie er von hinten aus dem Salon kommt, der «sehr grosse, hagere, ernste Gentleman», wie ein New Yorker Kritiker ihn 1935 beschreibt, sich mit dem Rücken zu uns an den Flügel setzt, mit Blick auf die Fotografien über dem Bücherregal, und seinem fernen, nahen Kollegen Paganini huldigt, indem er dessen berühmtes Thema zwischen Ironie und Pathos dekonstruiert, ein letztes Mal für Klavier und Orchester komponierend, nicht zufällig in Konzertlänge.
Andrea Loetscher telefoniert inzwischen mit einem, der den Schlüssel zum Haus haben könnte. Denn die Handwerker sind gerade nicht da, und wie vor einem richtigen Umzug muss halt auch improvisiert werden. Ich tröste uns damit, dass man sich Claude Debussys Haus in Paris nicht mal auf Sichtweite nähern kann, weil es einer saudischen Prinzessin in einer gated community gehört. Ausserdem hat es etwas schön Konspiratives, hinter einer Bauplane bis zur Haustür mit seinen Initialen in Stahl zu gelangen: «SR». Der Eingang fürs Personal ist links davon und tiefer. «Es ist sehr hierarchisch», sagt Andrea Loetscher fast etwas entschuldigend. Naja, er hat wenigstens dazu gestanden, der antirevolutionäre Grossbürgersohn aus dem Zarenreich. Heute werden Hierarchien kaschiert, ohne verschwunden zu sein. Verrückt nur, wie sich das hier mit einer Architektur verbindet, die alles Herrschaftliche, allen Pomp abgeworfen hat.
«Ich gehe durchs Haus und fühle mich wie ein Millionär – obwohl nicht jeder Millionär so ein Haus hat», schrieb er nach dem Einzug. In der Tat haben die allerwenigsten Millionäre so einen guten Geschmack. Und es ist mehr als geschmackvoll. Das ganze Ensemble, der Park, die Bauten, die Pflanzen sind ein Werk, ein wunderbares Spätwerk, eine Komposition in Balance von Form und Detail. Und komponiert man nicht eigentlich für alle? Insofern steht der Villa Senar ihre Uraufführung erst noch bevor, weiter wachsend in der Zeit wie die kanadischen Fichten am Ufer. Ihr Schöpfer konnte Senar nur fünf Jahre lang geniessen. Im August 1939 spielt er noch bei den Luzerner Festwochen; zu der Zeit hat er sich, besorgt über die deutsche Expansionspolitik, schon eine Wohnung in New York gesichert, wohin er mit Natalja am 23. August aufbricht.
Der Mann mit dem Schlüssel kann doch nicht kommen. Egal. Holen wir in Gedanken schon mal die Möbel aus dem Gärtnerhaus, stellen den Esstisch und Stühle für acht Personen aufs Parkett in den hellen Salon. Denken wir uns unter die Gäste, die vom – wie immer bei Rachmaninoff – russischen Personal bedient werden, den 36jährigen Pianisten Vladimir Horowitz aus der Ukraine, der sich später mit dem Gastgeber ans Klavier setzen wird – denn das tat er – und selbst einer von dessen besten Interpreten ist. Hoffen wir auf vergleichbare Begegnungen in der Zukunft und rauchen vorm Gärtnerhaus noch eine mit SR. Es nieselt wieder. «Es ist nützlich zu wissen», hat er zu Beginn der Bauarbeiten geschrieben, «dass hier wie überall die regnerischen Leute überwiegen. Die sonnigen sind selten.» Könnte sein, dass Rachmaninoff seine Meinung ändert, wenn hier an seinem Geburtstag am 1. April sein Flügel wieder erklingt…
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 98, Februar 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hier gelangen Sie zur Website der Villa Senar

Sie kennen sich schon lange, und sie verstehen sich gut, die Dirigenten Paavo Järvi und Gianandrea Noseda. Als sie sich in Zürich wiederfanden, der eine als Music Director beim Tonhalle-Orchester, der andere als Generalmusikdirektor am Opernhaus, war die Idee deshalb naheliegend: Warum nicht etwas zusammen planen? Zum Beispiel einen grossen Konzertzyklus zu Rachmaninows 150. Geburtstag, der in beiden Häusern stattfinden könnte?
Gut möglich, dass den beiden beim Aushecken dieses Plans nicht bewusst war, was eine solche Aktion bedeutet. Denn sie waren noch Studenten und weit weg von Zürich, als man 1985 die einst eng verbundenen Häuser zwar einvernehmlich, aber durchaus nicht ganz friedlich auseinanderdividierte.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es in Zürich ein einziges grosses Orchester gegeben. Tonhalle- und Theaterorchester (TTO) hiess es und umfasste 167 zentral organisierte und bezahlte Musiker:innen, die in zwei Formationen aufgeteilt waren: 87 von ihnen spielten als «blaue» Formation vorwiegend im Opernhaus, 80 als «rote» vor allem in der Tonhalle. Aber bei Bedarf machten alle alles, und das funktionierte – nun ja, eben so, dass schon ziemlich früh die Idee einer vollständigen Trennung der beiden Klangkörper aufkam.
Denn ein Opernorchester und ein sinfonisches Orchester, das sind zwei ganz unterschiedliche Organismen: In der Oper arbeitet man wochenlang auf eine Premiere hin, danach bleiben die Produktionen lange im täglich wechselnden Repertoire. Man spielt also an einem Abend Monteverdi, am nächsten Strauss und bereitet derweil eine Mozart-Produktion vor. Der sinfonische Betrieb dagegen ist blockweise organisiert: Drei Tage Proben, darauf die Konzerte – und dann ist das nächste Programm dran.
Organisatorisches Puzzle
Jürg Keller, damals Kaufmännischer Direktor der Tonhalle-Gesellschaft Zürich, erinnert sich gut an das organisatorische Puzzle, das zu bewältigen war. Problematisch wurde es vor allem, wenn im Opernhaus gross besetzte Werke aufgeführt wurden: «Dann holte man Musiker:innen aus der Tonhalle-Formation, die aber bei den Proben nicht dabei gewesen waren, weil sie ja ihre eigenen Programme zu spielen hatten.» Simon Styles, der als Tubist zur «roten» Formation gehörte, aber oft in der Oper aushalf, bestätigt das: «Man wusste nie, neben wem man sitzen würde.»
Ideal war das nicht, das hatten schon die Tonhalle-Chefdirigenten Rudolf Kempe und Gerd Albrecht festgestellt. Und auch viele Gastdirigenten waren nicht begeistert über die wechselnden Besetzungen: «Leinsdorf bekam deswegen seine berühmten Wutanfälle. Krips schaute ironisch in die Runde: ‹Hab' ich heute vielleicht meine Leute?›». So stand es am 29. März 1984 in der «Züri Woche».
Daher waren sich grundsätzlich alle einig: Wenn die beiden Häuser auf internationalem Niveau eine Rolle spielen wollten, wenn die Klangkörper ein eigenständiges Profil entwickeln und die Musiker:innen sich mit «ihrer» Institution wirklich identifizieren sollten – dann kam man um eine Orchestertrennung nicht herum.
«Ein Affront sondergleichen»
Das bedeutete allerdings auch, dass die Subventionen, die bis dahin in einen einzigen «Topf» kamen, verteilt werden mussten. Und da zeigte sich, wie unterschiedlich sich Zahlen interpretieren liessen: Die Tonhalle-Gesellschaft ging von der Anzahl der Musiker:innen als «Währung» aus, die damalige Theater AG dagegen bezog sich auf die Anzahl der geleisteten Dienste – wodurch das eigentlich sauber verhandelte Verhältnis 40:60 zu verschiedenen Resultaten führte. Die Folge war ein Streit, der so heftig und ausdauernd geführt wurde, dass der damalige Zürcher Stadtpräsident Thomas Wagner irgendwann die Geduld verlor und brieflich drohte, «dass mit der offensichtlichen Unfähigkeit, einen Konsens zwischen den beteiligten Institutionen zu erreichen, unter Umständen auch die Subventionsverträge gefährdet werden».
Dieser und viele weitere Briefe aller Beteiligten an diesem komplizierten Prozess liegen heute im Stadtarchiv. Es sind etliche Kilo Papier, die zwischen der Tonhalle, dem Opernhaus und der Stadt hin- und hergeschickt wurden. Da wurde gerechnet, nachgerechnet, argumentiert und gewettert. Man liest von einem «Affront sondergleichen», von «hochgezogenen Augenbrauen» und «faustdicker Skepsis». Und immer wieder verrät der sprachliche Schwung die Emotionen, mit denen diese Schreiben verfasst wurden: Die Tonhalle schulde dem Opernhaus nichts, «kein Geld, keine Formationsdienste, keine Musiker», schrieb der damalige Tonhalle-Direktor Richard Bächi. Max Koller, Verwaltungspräsident im Opernhaus, konterte an die Adresse der Stadt, es sei «wirklich nur schwer einzusehen, warum die Theater AG noch mehr dafür bezahlen sollte, dass sie von der Tonhalle-Gesellschaft weniger Dienste erhält».
Bemerkenswert ist auch, dass sich die Direktoren persönlich und betont höflich um alle möglichen administrativen Details kümmerten. «Sehr geehrter Herr Bächi», schrieb Opernhaus-Direktor Claus Helmut Drese, «da die Trennung der Orchesterformationen ja wohl bevorsteht, möchten wir Sie ersuchen, uns raschmöglichst die Vertragsunterlagen derjenigen Musiker zuzustellen, die der Theaterformation zugeteilt sind.» Und Richard Bächi antwortete dem «sehr geehrten Herrn Dr. Drese»: «Es ist Ihnen am besten gedient, wenn wir Fotokopien der Gagenblätter erstellen.»
Freundschaftliche Beziehungen
Am Ende wurde eine Kompromisslösung gefunden. Die Tonhalle-Gesellschaft erhielt weniger Geld, als sie gefordert hatte, aber mehr, als das Opernhaus zunächst abtreten wollte. In den Jahren danach konnten beide Orchester die Besetzung, die nach der Trennung allzu knapp war, vergrössern. Was man erhofft hatte – Qualitätsschub, Schärfung des Profils, Identifikation der Musiker:innen mit «ihrem» Haus – traf ein. Und auch wenn es keine offiziellen Verbindungen mehr gab: Inoffiziell war und ist das Verhältnis zwischen den beiden Häusern und ihren Orchestern friedlich.
So kommt es immer wieder vor, dass Musiker:innen des einen Orchesters beim anderen einspringen. Gelegentlich führen Karrieren von hier nach da: So wechselte zum Beispiel die Geigerin Elisabeth Harringer von der Oper in die Tonhalle, der Konzertmeister Bartłomiej Nizioł schlug den entgegengesetzten Weg ein, und Jürg Keller schaffte als Kaufmännischer Direktor sogar den Rundlauf: Tonhalle-Opernhaus-Tonhalle. Es gibt Paare, von denen der eine hier und die andere dort spielt, und freundschaftliche Verbindungen – nicht nur zwischen den Chefdirigenten Paavo Järvi und Gianandrea Noseda. Seit ein paar Jahren bieten die Häuser auch ein Kombi-Abo an.
Und nun wird also erstmals wieder ein gemeinsames musikalisches Projekt realisiert. Auf zwei Saisons ist der Rachmaninow-Zyklus angelegt, im November 2023 werden die Dirigenten dabei auch die Pulte tauschen. Und man wird hören, welchen Luxus es gibt in Zürich: Zwei grossartige, hoch spezialisierte Orchester in einer Stadt – die zudem noch gut auskommen miteinander.